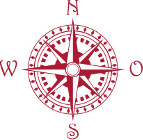Dörr,
Familie
Daniel:
* 1788 Sonnenberg (Wiesbaden-Sonnenberg/D),
† 4.1.1837 Wieden (Wien IV).
Klaviermacher. Der Gründer der Klaviermacherdynastie ist 1817 erstmals in Wien nachweisbar, als er um eine Klaviermacherbefugnis ansuchte. Im folgenden Jahr fertigte er ein Probeinstrument an. Das Bürgerrecht erhielt er am 27.5.1818 verliehen (Konskriptionsbogen). Am 14.6. des Jahres heiratete er im Alter von 30 Jahren die um zwei Jahre jüngere Theresia (geb. Turry, * ca. 1790 Rappottenstein/NÖ, † 11.11.1881 Wien). D. starb laut Totenprotokoll im Alter von 48 Jahren an Auszehrung. Er hinterließ zehn Kinder. Der älteste Sohn, Wilhelm, der später Geschäftsnachfolger werden sollte, war zum Zeitpunkt des Todes des Vaters noch minderjährig, und daher führte die Witwe zunächst den Betrieb weiter. Den Angaben in der Verlassenschaftsabhandlung nach zu schließen dürfte dieser nicht sehr groß gewesen sein. D. hinterließ nämlich außer den persönlichen Gegenständen „3 Gesellenbetten mit Bettgewand" sowie „3 alte Hobelbänke samt hizu gehörige alte Werkzeug“. Weiters befanden sich in der Werkstätte „1 halb fertiges Corpus“, aber keine Holzvorräte. Der gesamte Nachlass wurde auf 69 fl. CM geschätzt; diesen standen Außenstände an Zulieferer für Klavierbestandteile und Materialien in Höhe von ca. 600 fl. gegenüber.Sein Sohn
Wilhelm (I): * 15.4.1819 Wieden, † 30.10.1890 Wien. Klavierbauer. Erhielt am 15.3.1850 eine Befugnis verliehen und scheint ab dem folgenden Jahr als Firmeninhaber auf. Zunächst auf der Wieden tätig, eröffnete er im Juni 1867 eine neue „Klavier-Fabriks-Niederlage und Leih-Anstalt“ in Wien I, Stallburggasse 2. Ab 1875 befand sich D’s „Clavier-Etablissement und Leihanstalt“ dann in Wien VI, Hofmühlgasse 3. Ca. 1866 war er Vorstand-Stellvertreter der Wiener Genossenschaft der Klaviermacher und Orgelbauer, 1874 wurde er zum 2. Vorstand-Stellvertreter des Reformvereins der Wiener Clavier- und Orgelbauer gewählt. Am 20.12.1876 erhielt er ein Patent für ein sog. Solo-Pedal für Klaviere, das Ende 1878 erlosch. D. stellte u. a. bei der Londoner Industrieausstellung 1861 und bei der Weltausstellung in Paris 1878 aus.
Ehrungen
Bronzene Preis-Medaille bei der 3. allgemeinen österr. Gewerbe-Ausstellung 1845; Ehrenvolle Anerkennung bei der Wr. Arbeiter-Industrie-Ausstellung 1869; Verdienstmedaille Nr. 3 bei der Wr. Weltausstellung 1873.
Bronzene Preis-Medaille bei der 3. allgemeinen österr. Gewerbe-Ausstellung 1845; Ehrenvolle Anerkennung bei der Wr. Arbeiter-Industrie-Ausstellung 1869; Verdienstmedaille Nr. 3 bei der Wr. Weltausstellung 1873.
Wilhelms (I) ältester Sohn
Wilhelm (II) Hermann: * 25.5.1851 Wien, † 30.1.1908 Wien. Pianist, Chorleiter, Pädagoge, Komponist. W. D. studierte 1867/68 Violine, 1869/70 Komposition (Nebenfächer: Italienisch, Mündlicher Vortrag, Chorschule) und 1870/71 Klavier (Nebenfächer: Komposition, Literaturgeschichte) am Konservatorium der GdM; im erst- und letztgenannten Studienjahr trat er ohne Abschluss aus. 1868/69 besuchte er E. Stoibers Klasse für höheres Orgelspiel des Vereins zur Beförderung echter Kirchenmusik, wo er auch noch 1870 als Orgelschüler genannt wird. Im Sommer 1869 hielt er sich als „Musiker“ in (Bad) Ischl auf. 1873–75 war D. Chormeister des Sängerbundes der Wiener Polytechniker, 1875/76 und 1880 des MGV „Wiener Liederkranz“, 1876–78 des Wiener Sängerbunds (in der Nachfolge von E. Stoiber) sowie 1883 des Wiener Kaufmännischen Gesangvereins; 1878–80 Dirigent der Musikgesellschaft Euterpe. Ca. 1880 spielte D. auch Orgel unter L. Eder an St. Augustin und an der Altlerchenfelder Kirche (Wien VII) unter J. A. Rotter. Ab Mitte der 1880er-Jahre regelmäßige Zusammenarbeit mit J. Böhm und der Chorakademie des Wiener St.-Ambrosius-Vereins und in den 1880/90er-Jahren mehrmalige Mitwirkung bei Konzerten von Th. Kretschmann. Als Pädagoge wirkte er 1878–95 an der Horak-MSch. (Klavier, später auch Vorbereitungskurs für die Staatsprüfung aus Klavier und Gesang), ab 1896/97 am Theresianum (noch 1906, ab 1904? hier als Musikinspektor für den gesamten musikalischen Unterricht verantwortlich) und ab 1896 am Konservatorium der GdM (1896–1903 Klavier, 1897–1900 und 1905/06 Chorschule, 1900–05 praktische Musiklehre, 1903–08 Harmonielehre, 1906–08 Begleiten, Transponieren und Präludieren); 1898–1901 Mitglied der Prüfungs-Kommission für das Musiklehramt. Über sein 1881 uraufgeführtes Streichquartett äußerte sich E. Hanslick wenig schmeichelhaft.
Werke
Messe (mit Einlagen) 1882, Messe in f-Moll 1886, Graduale f. tiefe Stimme und Org. 1886, Ave Maria f. Singstimme und Org. 1886, Männerchöre (Gute Nacht, Sandmännchen, Der Delphin 1883), 5 Lieder 1881, Wahlspruch des MGV „Wiener Liederkranz“, Streichquartett a-Moll 1881; Hg. von Klavierwerken von G. F. Händel.
Messe (mit Einlagen) 1882, Messe in f-Moll 1886, Graduale f. tiefe Stimme und Org. 1886, Ave Maria f. Singstimme und Org. 1886, Männerchöre (Gute Nacht, Sandmännchen, Der Delphin 1883), 5 Lieder 1881, Wahlspruch des MGV „Wiener Liederkranz“, Streichquartett a-Moll 1881; Hg. von Klavierwerken von G. F. Händel.
Wilhelms (I) drittgeborener Sohn
Carl Eduard: * 30.10.1856 Wien, † 5.5.1934 Wien. Klaviermacher. Erlernte im väterlichen Betrieb das Klavierbauhandwerk und übernahm 1887 die Firma. Sie bestand am oben genannten Standort bis zu seinem Tod und wurde 1936 gelöscht.
Ehrungen
Kammerlieferant der Erzhzg.in Maria Immaculata.
Kammerlieferant der Erzhzg.in Maria Immaculata.
Die Klaviere der Firma genießen bis heute einen Ruf als solide, konservativ gebaute Qualitätsinstrumente. Die Seriennummern lassen auf eine durchschnittliche Jahresproduktion von ca. 250–300 Einheiten schließen.
Literatur
Hopfner 1999; Ottner 1977; B. Pierce, Piano Atlas 81982, 86; Eisenberg 1893; [Fs.] Hundertjähriger Bestand der Klavierfabrik D., 1817–1917; Kosel 1902; Bericht über die dritte allgemeine österr. Gewerbe-Ausstellung in Wien 1845, 1846, 826; Wr. Ztg. 9.1.1837, 36, 3.11.1861, 3984, 25.1.1877, Amtsbl., 175, 16.6.1877, 8, 15.1.1878, Amtsbl., 115, 30.4.1879, Amtsbl., 891, 6.11.1890, 10, 6.11.1897, 4, 4.9.1898, 3, 8.1.1899, 1. Verzeichnis, 2; Fremden-Bl. 13.6.1867, 16, 21.7.1870, 5, 21.8.1872, 3, 28.2.1873, 6, 24.8.1876, 8; Morgen-Post 4.10.1869, 5; Bll. f. Musik, Theater und Kunst 29.8.1873, 114; NFP 4.12.1873, 6, 31.3.1878, 6, 27.5.1878, 2, 14.9.1878, 10, 4.10.1878, 5, 19.6.1880, 4, 26.1.1881, 2, 18.10.1881, 6, 3.6.1882, 5, 25.6.1883, 2, 25.9.1886, 5, 29.3.1906, 11, 1.2.1908, 9; Dt. Ztg. 15.2.1874, 5; Morgen-Post 14.2.1875, 4; Die Presse 17.2.1875, 8, 23.3.1876, 11, 25.10.1876, Abendbl., 3, 9.10.1878, 10, 11.7.1880, 15, 30.9.1883, 12, 21.2.1885, 11, 7.10.1885, 11, 5.9.1893, 8, 2.9.1894, 8, 1.9.1895, 6; Dt. Musik-Ztg. 15.10.1875, [11]; Neues Fremden-Bl. 11.12.1875, 10; Dt. Kunst- & Musik-Ztg. 11.7.1877, 3, 1.1.1880, 5, 18.2.1880, 37ff und Musikbeil., 4, 8.5.1880, 101, 30.1.1882, 40, 15.9.1897, 215; Wr. Sonn- und Montags-Ztg. 1.4.1878, 3; Das Vaterland 17.11.1881, 7, 19.2.1885, 7, 7.2.1886, 9, 21.2.1886, 5, 1.4.1887, 6, 25.10.1888, 7, 1.9.1889, Beibl., 7, 31.10.1890, 7; Wr. Allgemeine Ztg. 13.2.1883, 2, 9.3.1883, 6; Neues Wr. Abendbl. 19.10.1883, 2; Neues Wr. Tagbl. 1.10.1886, 6, 18.9.1888, 14, 28.3.1892, 3, 11.4.1894, 7, 31.1.1908, 13f, 16.12.1934, 20; Neuigkeits-Welt-Bl. 25.9.1887, 15, 28.11.1897, 5; Montags-Ztg. 3.4.1893, 1; Ostdt. Rundschau 22.12.1896, 6; Die Lyra 1.1.1897, 6; Prager Tagbl. 1.2.1908, 11; Grazer Tagbl. 2.2.1908, 6; Trauungsbuch 1817–26 der Pfarre Wieden (Wien IV), fol. 26; Taufbuch 1817–21 der Pfarre Wieden, fol. 197; Taufbuch der Evangelischen Gemeinde A. B. (Wien I) 1848–51, 1851, RZ 127, 1855–58, 1856, RZ 220; Sterbebuch der Evangelischen Gemeinde A. B. (Wien I) 1836–46, 1837, RZ 4, 1934, RZ 85; Sterbebuch 1881 der Pfarre Gumpendorf (Wien VI), RZ 618; Sterbebuch 1899–1919 der Pfarre St. Augustin (Wien I), fol. 100; WStLA (Konskriptionsbogen Wieden 447; TBP 1837; Verlassenschaftsabhandlung 182/1837; Kartei der Ausgeschiedenen; Handelsregister 1935, E 37/247 [Reg.bd., 247]); Magistrat der Stadt Wien, Wiener Heimatrolle; Archiv ÖAW (Bestand St. Anna, G14); eigene Recherchen (Jahresberichte des Konservatoriums der GdM; www.anno.onb.ac.at; Kat.e ÖNB-Musikslg. und WStLB).
Hopfner 1999; Ottner 1977; B. Pierce, Piano Atlas 81982, 86; Eisenberg 1893; [Fs.] Hundertjähriger Bestand der Klavierfabrik D., 1817–1917; Kosel 1902; Bericht über die dritte allgemeine österr. Gewerbe-Ausstellung in Wien 1845, 1846, 826; Wr. Ztg. 9.1.1837, 36, 3.11.1861, 3984, 25.1.1877, Amtsbl., 175, 16.6.1877, 8, 15.1.1878, Amtsbl., 115, 30.4.1879, Amtsbl., 891, 6.11.1890, 10, 6.11.1897, 4, 4.9.1898, 3, 8.1.1899, 1. Verzeichnis, 2; Fremden-Bl. 13.6.1867, 16, 21.7.1870, 5, 21.8.1872, 3, 28.2.1873, 6, 24.8.1876, 8; Morgen-Post 4.10.1869, 5; Bll. f. Musik, Theater und Kunst 29.8.1873, 114; NFP 4.12.1873, 6, 31.3.1878, 6, 27.5.1878, 2, 14.9.1878, 10, 4.10.1878, 5, 19.6.1880, 4, 26.1.1881, 2, 18.10.1881, 6, 3.6.1882, 5, 25.6.1883, 2, 25.9.1886, 5, 29.3.1906, 11, 1.2.1908, 9; Dt. Ztg. 15.2.1874, 5; Morgen-Post 14.2.1875, 4; Die Presse 17.2.1875, 8, 23.3.1876, 11, 25.10.1876, Abendbl., 3, 9.10.1878, 10, 11.7.1880, 15, 30.9.1883, 12, 21.2.1885, 11, 7.10.1885, 11, 5.9.1893, 8, 2.9.1894, 8, 1.9.1895, 6; Dt. Musik-Ztg. 15.10.1875, [11]; Neues Fremden-Bl. 11.12.1875, 10; Dt. Kunst- & Musik-Ztg. 11.7.1877, 3, 1.1.1880, 5, 18.2.1880, 37ff und Musikbeil., 4, 8.5.1880, 101, 30.1.1882, 40, 15.9.1897, 215; Wr. Sonn- und Montags-Ztg. 1.4.1878, 3; Das Vaterland 17.11.1881, 7, 19.2.1885, 7, 7.2.1886, 9, 21.2.1886, 5, 1.4.1887, 6, 25.10.1888, 7, 1.9.1889, Beibl., 7, 31.10.1890, 7; Wr. Allgemeine Ztg. 13.2.1883, 2, 9.3.1883, 6; Neues Wr. Abendbl. 19.10.1883, 2; Neues Wr. Tagbl. 1.10.1886, 6, 18.9.1888, 14, 28.3.1892, 3, 11.4.1894, 7, 31.1.1908, 13f, 16.12.1934, 20; Neuigkeits-Welt-Bl. 25.9.1887, 15, 28.11.1897, 5; Montags-Ztg. 3.4.1893, 1; Ostdt. Rundschau 22.12.1896, 6; Die Lyra 1.1.1897, 6; Prager Tagbl. 1.2.1908, 11; Grazer Tagbl. 2.2.1908, 6; Trauungsbuch 1817–26 der Pfarre Wieden (Wien IV), fol. 26; Taufbuch 1817–21 der Pfarre Wieden, fol. 197; Taufbuch der Evangelischen Gemeinde A. B. (Wien I) 1848–51, 1851, RZ 127, 1855–58, 1856, RZ 220; Sterbebuch der Evangelischen Gemeinde A. B. (Wien I) 1836–46, 1837, RZ 4, 1934, RZ 85; Sterbebuch 1881 der Pfarre Gumpendorf (Wien VI), RZ 618; Sterbebuch 1899–1919 der Pfarre St. Augustin (Wien I), fol. 100; WStLA (Konskriptionsbogen Wieden 447; TBP 1837; Verlassenschaftsabhandlung 182/1837; Kartei der Ausgeschiedenen; Handelsregister 1935, E 37/247 [Reg.bd., 247]); Magistrat der Stadt Wien, Wiener Heimatrolle; Archiv ÖAW (Bestand St. Anna, G14); eigene Recherchen (Jahresberichte des Konservatoriums der GdM; www.anno.onb.ac.at; Kat.e ÖNB-Musikslg. und WStLB).
Autor*innen
Rudolf Hopfner
Christian Fastl
Christian Fastl
Letzte inhaltliche Änderung
9.8.2023
Empfohlene Zitierweise
Rudolf Hopfner/Christian Fastl,
Art. „Dörr, Familie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
9.8.2023, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001cbdd
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.
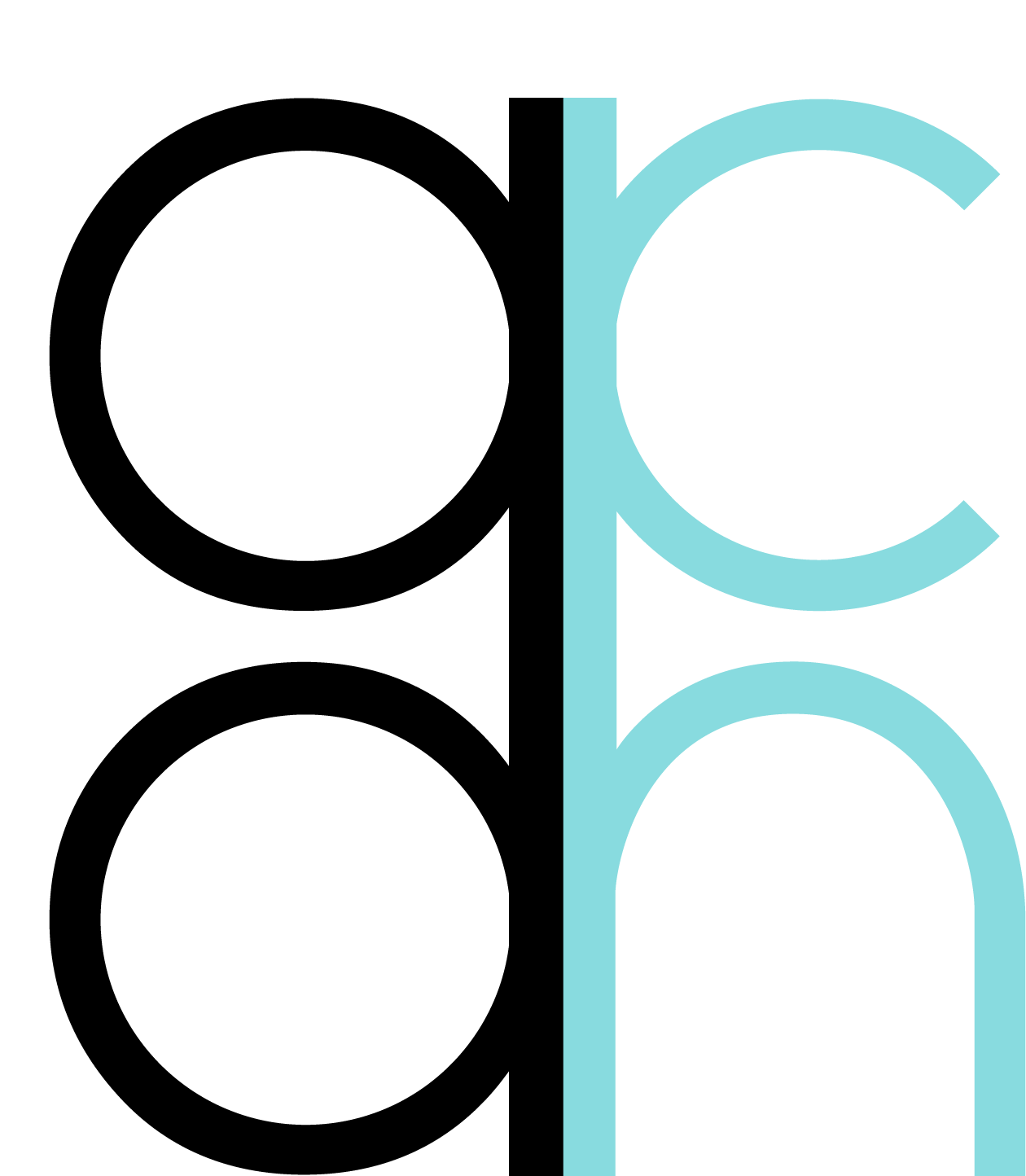


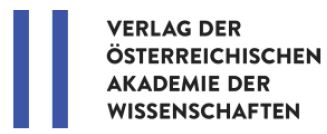
![Fremden-Bl. 13.6.1867, [16]© ANNO/ÖNB Fremden-Bl. 13.6.1867, [16]© ANNO/ÖNB](/ml/image/Doerr_Wilhelm_1867.jpg)
![Dt. Kunst- & Musik-Ztg. 15.10.1875, [11]© ANNO/ÖNB Dt. Kunst- & Musik-Ztg. 15.10.1875, [11]© ANNO/ÖNB](/ml/image/Doerr_Wilhelm_1875.jpg)
![Neuigkeits Welt-Bl. 25.9.1887, [15]© ANNO/ÖNB Neuigkeits Welt-Bl. 25.9.1887, [15]© ANNO/ÖNB](/ml/image/Doerr_Carl_1887.jpg)
![Wilhelm (II) Dörr (Dt. Kunst- & Musik-Ztg. 18.2.1880, [1])© ANNO/ÖNB Wilhelm (II) Dörr (Dt. Kunst- & Musik-Ztg. 18.2.1880, [1])© ANNO/ÖNB](/ml/image/Doerr_Wilhelm_II_1880.jpg)