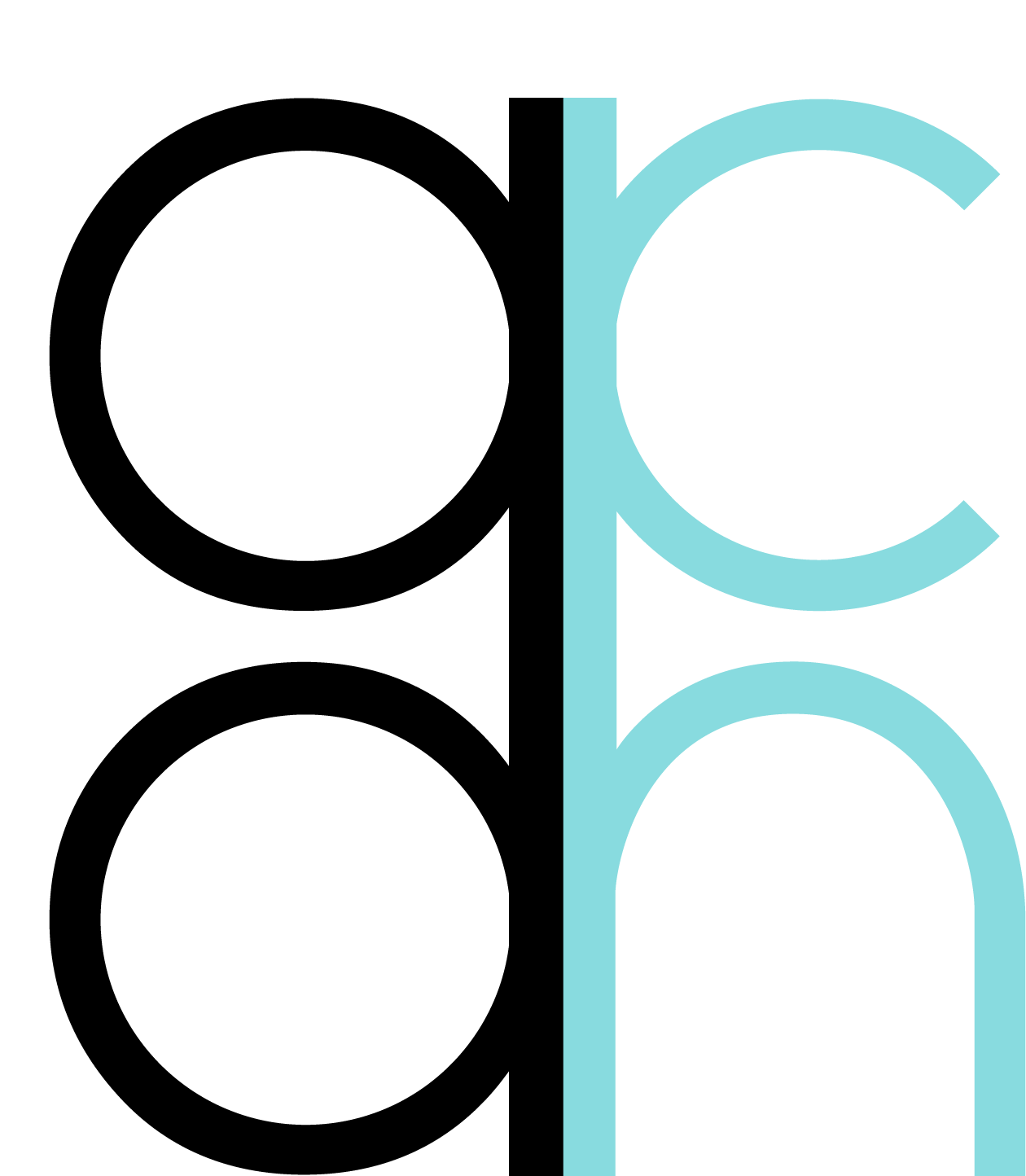Musikkritik
Kritische Auseinandersetzung mit Musik in unterschiedlichen Publikationsorganen, über die in einem gewissen Sinne als Gegenstück zu verstehenden Programmeinführungen weit hinaus gehend. Wie alle Komposita ist M. ein schillernder Begriff, der nicht nur im Laufe der Zeiten, sondern auch in Relation zu bestimmten Absichten seine Bedeutung ändert. Einerseits bezieht sich M. auf das musikalische Kunstwerk selbst und versucht eine Art Primäranalyse vorzugeben, andererseits kümmert sie sich ausschließlich um die musikalische Wiedergabe (Konzert) oder berichtet wertend – wie nahezu immer in Kunstfragen notwendig – über Erscheinungen des Musiklebens allgemein.M. ist in Österreich in konsequenter, aber verspäteter Verfolgung deutscher Phänomene ab ca. 1800 nachzuweisen: einerseits in lehrhaften Auseinandersetzungen mit klangästhetischen Problemen, die einen Fachmann als Autor verlangten, andererseits als eine Art von Berichterstattung, die allerdings sporadisch schon wesentlich früher anzutreffen war und bereits zu W. A. Mozarts Lebzeiten zum lokaljournalistischen Alltag gezählt hatte. Der Beginn der österreichischen Fachjournalistik wird gewöhnlich mit der Musikalischen Monats-Schrift (1803) von F. X. Glöggl verknüpft, die E. Hanslick als „Ahnfrau des österreichischen Zeitschriftgeschlechts“ bezeichnete (Musikzeitschriften).
Allerdings ist die Vorstellung, dass es eine Art Entwicklung des Genres bis zur Gegenwart in linearer Konsequenz gegeben hätte, irrig. Stattdessen wechseln Aufführungsberichte einer relativ unpersönlichen Berichterstattung mit einer individuell profilierten Fachkritik, die sich v. a. dem Werk widmet und die Umstände von Aufführungsanlass, Schauplatz, Publikum etc. eher vernachlässigt. Mit der 1848 (Revolution) errungenen Pressefreiheit entstand so etwas wie ein ungebrochenes Selbstbewusstsein der Feuilletonisten, die mehr oder weniger begründet ihre private Meinung maschinell verbreiteten und damit durchaus gewissen Erfolg in der Rezeptionssteuerung zeitigen konnten. Als Form diente der Essay, der wie in der Neuen freien Presse prominent in sechs Spalten auf die Titelseite und die nächste Seite gesetzt war und eine Art ausführlichen kommentatorischen Charakter aufweisen musste. Wichtig war damals nicht nur die genaue Kenntnis des Werkes (weswegen sich nahezu alle Kritiker schon vor der Aufführung Partituren oder Klavierauszüge besorgten), sondern auch der Vergleich mit anderen Werken.
Gewiss konnte der Kritiker um die Mitte des 19. Jh.s (beispielhaft E. Hanslick, F. v. Hausegger) nicht die eigene Position verleugnen, die – wie im Fall Rich. Wagner und A. Bruckner – durchaus antipodisch angelegt war. Dieser Umstand war aber offengelegt und gab so dem Leser die Möglichkeit, den einen oder anderen Standpunkt argumentativ einzunehmen. Mit der zunehmenden Ideologisierung der Musik zugunsten außermusikalischer Kriterien (Programme, Nationen, Tendenzen, Feieranlässe etc.) ging es nicht mehr um handwerkliche Argumente allein, die noch vor 1800 den Kunstkritiker als „Kunstrichter“ auftreten ließen, sondern um verschiedenartige ästhetische und kunstphilosophische Grundlagen, die sowohl auf das Objekt der Betrachtung projiziert wurden als auch dem Betrachter selbst eigen waren. Das Ergebnis dieser Entwicklung war zweifellos ein Auseinanderdriften in der Frage der Aufgabenzuweisung von Musik, der sich zu einem letztlich bis heute andauernden Parteienstreit auswuchs und beispielsweise damals bei „Wagnerianern“ und „Brahminen“ (J. Brahms), später Expressionisten und Konstruktivisten ausdrückte.
Seit dem Beginn des 20. Jh.s und dem Auftreten von pluralistischen musikalischen Wirklichkeiten, die nahezu nichts mehr miteinander zu tun haben, konnte sich zwar der M.er aus seiner starren ästhetischen Position befreien, weil er mit der einfachen Parteilichkeit nicht mehr kompetent genug erschien, andererseits aber verlor er soweit die Fachmaße seiner Beurteilung, dass zunehmend Identifikation oder völliges Nichtverstehen die Szene beherrschte. Dieses Unverständnis für das künstlerische Angebot führte meistens zur polemischen Aggression oder Flucht in außermusikalische Faktoren, für deren Repräsentanz oft die Reaktion des Publikums herhalten musste. Die politische Vereinnahmung der Ästhetik durch die staatsprägenden Parteien trieb diesen Zustand soweit auf die Spitze, dass selbst ausgewiesene Musikologen (beispielsweise im Nationalsozialismus) ihre eigene Zunft (Musikwissenschaft) durch Hasstiraden und erklärt offene Lügen desavouierten.
Der Zerfall dieser Parteilichkeit nach 1945 brachte, gewiss auch – gestützt von den alliierten Befreiern vom Nationalsozialismus und der Not der Nachkriegszeit – in einer Aufbruchsstimmung in Richtung Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung eine Art journalistischer „Besinnung auf das Humanum“. Es ist wohl einmalig in der internationalen Pressegeschichte, dass M.er auf diesem Weg zu Chefredakteuren von großen österreichischen Tages- und Wochenzeitungen wurden und ihr Wort auch im üblichen Tagesgeschehen großen Einfluss hatte (z. B. Eberhard Strohal, K. Löbl).
Der Weg in die Informationsgesellschaft, der nicht nur parallel mit der elektronischen Medialisierung, sondern auch der Entwicklung zum Wohlstandsstaat verlief, wo Konsum zum höchsten Gut avancierte, prägte auch der M. den Stempel des Marketing auf. Zunehmend wurden M.er nicht nur kritische Berichterstatter von Werken, Interpretationen und Institutionen, sondern auch zu „Agenten für ...“, wodurch sich die Positionen zum Marketing hin verschoben und die Methodik des Schreibens samt Newswert gegenüber dem noch immer vorhandenen Kunstobjekt in Richtung „public relations“ veränderte. So wie Musikveranstaltungen – v. a. jene mit den höchsten Kartenpreisen –, von ihrem Programm unabhängig, die Priorität in der Veröffentlichung einnahmen, wurde auch die Personalisierung der Interpretation immer weiter vorangetrieben und wurden ohne Scheu Kehrtwendungen in den Werteinschätzungen durchgeführt (z. B. H. v. Karajan), wenn nur die Marktrichtung stimmte. Diesbezüglich ist logisch nachvollziehbar, dass es nicht lange dauern konnte, bis man mit dem alten Markt der Kunstmusik nicht mehr auskam und zunehmend die neuen Märkte der Pop- und Filmmusik und als Brücke Cross-over-Dimensionen als gleichwertig berichtenswert etablierte. Die Beschäftigung mit dem Neuen, die einstmals vornehmste Aufgabe der M., ist Fachzeitschriften (z. B. ÖMZ) überantwortet worden, die Mühe haben, eine entsprechende Leserklientel für die durchaus schwierige und komplexe Behandlung neuester ästhetischer Phänomene zu gewinnen.
Diese Marketing-Positionierung hat auch längst anstelle des Komponisten den Interpreten zum Trendsetter gekürt, dessen persönliche Umstände bis ins kleinste Detail und mit schärfstem Bildobjekt verbreitet werden, ja wenn man so will, Musik überhaupt nur mehr unter dem Label des Interpreten marktfähig erscheint. Die Substanz der geistigen Arbeit des ursprünglichen Schöpfers ist damit so weit uninteressant geworden, dass sich auch die Sprache von der ästhetischen Fachterminologie zu einem emotionell die Massen ansprechenden Allerweltsvokabular gewandelt hat. Alle Befragungen des Publikums der letzten zehn Jahre zeugen (2003) allein im Nichtwissen über zeitgenössische Musik davon, dass sich die Outputs der Musikinstitutionen grosso modo mehr oder weniger Interpret und Medieninformant teilen, nebenbei bemerkt ein Phänomen, das sich auch in anderen Sparten der medialen Erzeugnisse zunehmend beobachten lässt. Dies geht so weit, dass im üblichen Sprachgebrauch das Wort Künstler überhaupt nur mehr dem Interpreten, sei es Sänger, Dirigent, Instrumentalist oder Schauspieler vorbehalten ist (Musiker/Musikant) und der Produzent des Kunstwerkes, der Komponist, hinter all dem anonym verschwindet.
Literatur
MGG 6 (1997); R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker 1854 u. ö.; E. Hanslick, Concerte, Componisten und Virtuosen 1886; M. Faller, Johann Friedrich Reichardt und der Anfang der musikalischen Journalistik 1929; P. A. Scholes in P. A. Scholes, The Oxford Companion to Music 1938; M. Graf, Composer and Critic: Two Hundred Years of Musical Criticism 1945; P. Mies, Von Sinn und Praxis der musikalischen Kritik 1950; H. H. Stuckenschmidt, Glanz und Elend der M. 1957; A. Della Corte, La critica musicale e i critici 1961; A. Walker, An Anatomy of Musical Criticism 1966; V. Thomson, Music Reviewed 1967; H. Kaufmann (Hg.), Studien zur Wertungsforschung 1 (1968) u. 2 (1969); M. Wagner, Gesch. der österr. M. in Beispielen 1979; E. D. Schuschitz, Die Wiener M. in der Ära Gustav Mahler 1897 bis 1907, Diss. Wien 1978; H. Ullrich in ÖMZ 26 (1971); M. Wagner, Kultur und Politik, Politik und Kunst 1991.
MGG 6 (1997); R. Schumann, Gesammelte Schriften über Musik und Musiker 1854 u. ö.; E. Hanslick, Concerte, Componisten und Virtuosen 1886; M. Faller, Johann Friedrich Reichardt und der Anfang der musikalischen Journalistik 1929; P. A. Scholes in P. A. Scholes, The Oxford Companion to Music 1938; M. Graf, Composer and Critic: Two Hundred Years of Musical Criticism 1945; P. Mies, Von Sinn und Praxis der musikalischen Kritik 1950; H. H. Stuckenschmidt, Glanz und Elend der M. 1957; A. Della Corte, La critica musicale e i critici 1961; A. Walker, An Anatomy of Musical Criticism 1966; V. Thomson, Music Reviewed 1967; H. Kaufmann (Hg.), Studien zur Wertungsforschung 1 (1968) u. 2 (1969); M. Wagner, Gesch. der österr. M. in Beispielen 1979; E. D. Schuschitz, Die Wiener M. in der Ära Gustav Mahler 1897 bis 1907, Diss. Wien 1978; H. Ullrich in ÖMZ 26 (1971); M. Wagner, Kultur und Politik, Politik und Kunst 1991.
Autor*innen
Manfred Wagner
Letzte inhaltliche Änderung
14.3.2004
Empfohlene Zitierweise
Manfred Wagner,
Art. „Musikkritik‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
14.3.2004, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001da95
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.