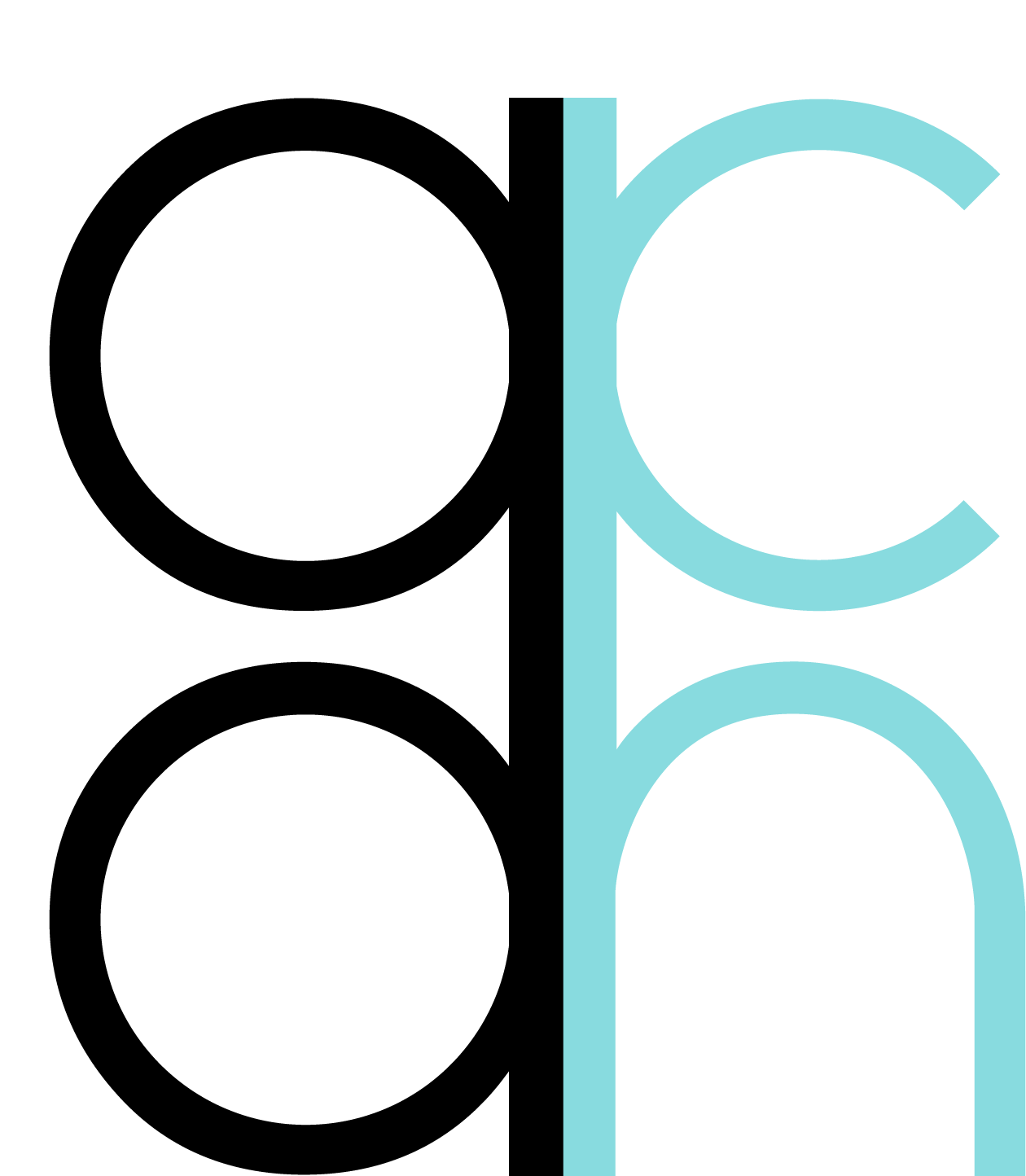Fuge
Im landläufigen Wortsinn eine Komposition, die in einem polyphonen, strengstimmigen Satz ein oder gelegentlich mehrere Themen verarbeitet; wobei zu Beginn die Stimmen sukzessive mit dem Thema eintreten und in der Folge das Thema aufgreifende Abschnitte (sog. Durchführungen) mit themenfreien Partien (sog. Episoden) abwechseln. Die F. kann als selbständiges, und dann in den allermeisten Fällen instrumentales, Musikstück auftreten oder in diversen vokal- oder instrumentalmusikalischen Gattungen den Teil eines Werks bilden. Weiterhin kann innerhalb eines Werkverlaufs ein Abschnitt fugenmäßig gestaltet sein (sog. Fugato). Die mit der F. verbundenen Vorstellungen sind auch heute noch wesentlich durch das Œuvre J. S. Bachs bestimmt, dessen F.n (v. a. aus dem Wohltemperierten Clavier) im späteren 18. und frühen 19. Jh. in den Rang klassischer Meisterwerke erhoben wurden und seither als Modell in Praxis, Theorie bzw. Didaktik dienen. Eine historisch adäquate Betrachtung, die sich von dieser rezeptionsgeschichtlich bedingten Verengung des Blicks löst, hat es freilich mit einem vielschichtigen und wandlungsreichen Phänomen zu tun. Grundsätzlich zu unterscheiden sind die Begriffsgeschichte von „F.“, worunter im Laufe der Jh.e durchaus verschiedene Erscheinungen verstanden wurden, und die (Real-)Geschichte polyphoner, imitierender (instrumentaler) Musikformen, die zur F. in dem seit dem 18. Jh. gebräuchlichen Sinn hinführen, die bis dahin aber mit diversen Benennungen versehen wurden.Der Terminus „Fuga“, der erstmals im 14. Jh. nachweisbar ist, bezieht sich bis um die Mitte des 15. Jh.s ausschließlich auf Stücke, die zur Gänze oder zwischen einzelnen Stimmen kanonisch gebaut sind. Beispiele für diese Begriffsverwendung finden sich auch in Quellen aus dem österreichischen Raum (sog. Wolkenstein-Hss. und Trienter Codices 90 und 93). Parallel zur Entwicklung des durchimitierenden, homogenen Satzes in der 2. Hälfte des 15. Jh.s erweitert sich die Bedeutung von „Fuga“: es wird darunter nun auch die Technik der Imitation ganz allgemein oder ein auf der Durchimitation eines Motivs beruhender Abschnitt einer Komposition verstanden. Die Musiktheorie reagiert darauf teils durch Einführung von Unter- bzw. spezifizierenden Begriffen, teils durch neuerliche Bedeutungseinschränkung. Gioseffo Zarlino 1558 behält den Ausdruck „fuga“ der diastematisch exakten (und dementsprechend auf perfekte Konsonanzen als Einsatzintervalle beschränkten) Imitation vor; davon wird die in der Intervallabfolge abweichende „imitatione“ unterschieden. Bei beiden Kategorien differenziert Zarlino weiterhin zwischen einer „gebundenen“ und einer „freien“ Art (Fuga/imitatione „legata“ oder „sciolta“), je nachdem, ob der Melodiezug von der nachfolgenden Stimme zur Gänze, also kanonisch, oder nur teilweise wiederholt wird. Zarlinos Begriffsbestimmung wirkt – wenngleich in oft weitgehender Modifikation und mit Umakzentuierungen – in der italienischen und italienisch beeinflussten Musiktheorie bis in das 18. Jh. nach.
In das 16. Jh. fällt die Ausbildung von durchimitierenden instrumentalen Kompositionstypen für Ensemble oder Tasteninstrumente, die anfänglich an vokalen Vorbildern orientiert waren, nach und nach aber eine den Bedingungen und Möglichkeiten der Textlosigkeit bzw. der Bestimmung für Instrumente entsprechende, spezifische Ausgestaltung erfuhren (Tendenz zur Monothematik bzw. Durchhalten eines Hauptthemas, instrumentalidiomatische Formulierungen). Zu diesen Formen, von denen eine kontinuierliche Entwicklung zur F. des 18. Jh.s führt, zählt insbesondere das Ricercar. Die auf Adrian Willaert zurückgehende venezianische Ricercartradition begann bereits während der 2. Hälfte des 16. Jh.s nach Österreich einzuwirken: Mit J. Buus und A. Padovano waren zwei ihrer wichtigsten Vertreter an habsburgischen Höfen tätig. Um 1600 kommt im deutschen Sprachraum der Usus auf, Instrumentalstücke, die in der Art des Ricercars aus einer Folge von imitativen Durchführungen eines oder mehrerer Themen, also aus „fugae“ bestehen, pars pro toto als „Fuga“ zu bezeichnen. Prinzipiell handelt es sich dabei aber um einen mit Termini wie „Ricercar“ und teilweise auch „Fantasia“ austauschbaren Ausdruck, wie nicht zuletzt die im Fall von Parallelüberlieferung häufig wechselnde Benennung zeigt. Die Ricercar/F.n/Fantasia-Produktion im süddeutsch-österreichischen Raum schließt um 1600 weiterhin eng an das venezianische Vorbild (insbesondere A. Gabrieli) an. Die einschlägigen, nunmehr vorrangig oder ausschließlich für Tasteninstrumente bestimmten Kompositionen kennzeichnet eine oft erstaunliche Länge, die Beschränkung auf wenige Themen, mitunter sogar Monothematik, die Anwendung kontrapunktischer Techniken (Umkehrung, Diminution, Augmentation, Engführung) und ein mit alldem verbundener hoher artifizieller Anspruch. Insofern stellen sie eine wichtige Station auf dem Weg zur (Klavier-)F. als gleichsam Inbegriff des instrumentalen Kontrapunkts dar. Stücke dieser Art wurden u. a. von H. L. Hassler, Ch. Luython und J. Hassler vorgelegt, die als Organisten am Hof Maximilians II. und Rudolphs II. beschäftigt waren.
Die zentrale Erscheinung auf dem Gebiet der polyphon-imitierenden Claviermusik im süddeutsch-österreichischen Raum um die Mitte des 17. Jh.s ist J. J. Froberger, der spätestens seit 1637 bis 1658 als Organist am Wiener Hof wirkte. Sein zu einem großen Teil in drei den Kaisern Ferdinand III. und Leopold I. gewidmeten autographen Handschriften überliefertes Oeuvre enthält – in Anlehnung an seinen Lehrer Girolamo Frescobaldi – vier Typen imitierender Tastenmusik. Gemeinsam ist ihnen die Gliederung in mehrere der Bewegungsart nach verschiedene Abschnitte infolge rhythmisch-variativer Umformung des Themas (in der Literatur auch als „Variations-F.“ bezeichnet); Canzone und Capriccio sind durch kleinere Notenwerte und eine figurierte Thematik gekennzeichnet, Fantasia und Ricercar sind in einer langsameren Bewegung gehalten, weisen eine v. a. stufenweise, „vokale“ Melodieführung auf und erinnern insofern an den stile antico. Der (weit über den österreichischen Raum hinausreichenden, hier aber besonders starken) Vorbildwirkung Frobergers ist es zuzuschreiben, wenn das Ricercar von den am Kaiserhof tätigen Organisten bis in die 1. Hälfte des 18. Jh.s gepflegt wurde (während die Produktion von Ricercaren in den anderen europäischen Ländern in der 2. Hälfte des 17. Jh.s nach und nach zurückgeht). Mit dem stile antico-Anklang ist der Charakter einer „gelehrten“ bzw. repräsentativen Studienkomposition verbunden, damit geht wiederum die Neigung zur Zusammenstellung in Kunstbuch-artigen Zyklen einher (A. Poglietti 1676/77, Got. Muffat 1732). Diese lang währende Auseinandersetzung mit dem Ricercar, die auch mit einer anhaltenden Ausstrahlung der italienischen Claviermusik zu tun hat (so dienten etwa die Ricercare Frescobaldis, Giovanni Battista Fontanas und Luigi Battiferris als Studienmaterial im Schülerkreis von J. J. Fux) kann als Teilaspekt der spezifischen Wiener Tradition des „gelehrten“ Kontrapunkts betrachtet werden. Auch Canzone und Capriccio halten sich in Wiener Organistenkreisen relativ lange (J. C. Kerll, Poglietti, G. Reutter d. Ä., Got. Muffat), wobei eine Tendenz zu Virtuosität einerseits, zum Programm- oder Charakterstück bzw. zur Tonmalerei andererseits festzustellen ist. Dem Nachwirken Frobergers kann weiterhin zugeschrieben werden, dass in der Wiener Produktion der Terminus „F.“ kaum eine Rolle spielt, während er v. a. im mitteldeutschen Raum seit der Mitte des 17. Jh.s zunehmend die Bezeichnungen „Ricercar“ und „Canzone“ verdrängt. Hier geht die Entwicklung zudem in Richtung eines einheitlichen Bewegungsablaufs (im Unterschied zur „Variations-F.“), tonaler Beantwortung und einer harmonischen Gesamtdisposition mit ausgeprägten modulatorischen Verläufen. Der damit – v. a. von J. Pachelbel – erreichte Zustand stellt eine der entscheidenden Voraussetzungen für das Werk J. S. Bachs dar. Um eine Art Sondertradition handelt es sich bei den für die liturgische Alternatim-Praxis gedachten Magnificat- F.n bzw. fugierten Versetten für Orgel, zu der Kerll, Modulatio organica 1686, Got. Muffat, 72 Versetl 1726, und Pachelbel beitrugen.
Ein weites Feld bilden die sozusagen unselbständigen Ausprägungen der F., d. h. die Verwendung von F.n-Technik bzw. das Auftreten fugierter Teile im Rahmen div. Gattungen der Instrumental- und Vokalmusik. Von der fundamentalen Rolle abgesehen, die Durchimitation bzw. Fugierung in der dem stile antico verpflichteten Kirchenmusik hat, kristallisieren sich im 17. Jh. auch in der konzertierenden Messkomposition bestimmte Stellen des Ordinarium missae als bevorzugter Ort für den Einsatz von F.n heraus. Insbesondere die „Amen-F.“ am Schluss von Credo und Gloria, die etwa bei A. Bertalli bereits regelmäßig auftritt, ist fortan gleichsam ein Topos der Ordinariumsvertonung. Zahlreiche Anwendungsfälle fugierender Schreibweise finden sich in der Instrumentalmusik. Sie reichen von der Gigue (schon bei Froberger wie den französischen Clavicenisten; auf dem Gebiet der Ensemblesuite v. a. bei H. I. F. Biber) über den zweiten Teil der sog. französischen Ouverture Lullyscher Provenienz (Georg Muffat, Fux) bis zur Claviertoccata (bei Froberger in Form motivisch gebundener, imitierender Abschnitte, bei Georg Muffat, Apparatus musico-organisticus 1690, schließlich auch in Gestalt größer angelegter, verselbständigter F.n-Sätze). Dem allgemeinen, d. h. internationalen Entwicklungstrend der Gattung entspricht die Integration fugierter Teile in die Canzone bzw. Kirchensonate (in Österreich beginnend bei M. A. Ferro 1649, William Young 1653, J. H. Schmelzer 1659 und 1662, G. B. Viviani 1673). Ein Wiener Spezifikum ist hingegen die möglicherweise von Fux geschaffene, zur liturgischen Verwendung bestimmte, zweigliedrige Kirchensonate, die aus einem langsamen Einleitungs- und einem lebhaften F.n-Satz besteht und noch Anfang des 19. Jh.s (z. B. von J. G. Albrechtsberger) gepflegt wurde. Auffällig ist weiterhin die Häufigkeit, mit der fugierte Sätze – meist als Eröffnung – in Suitenwerken von Komponisten des Wiener Kaiserhofes aufscheinen. Beispiele finden sich in Triopartiten von Fux und in Claviersuiten von Poglietti, F. M. Techelmann, F. T. Richter (die den Tänzen eine Canzone, ein Ricercar oder ein Capriccio voranstellen) und Got. Muffat (Componimenti musicali, ca. 1736; hier geht einigen Tanzfolgen ein zweiteiliger Zyklus aus präludienartiger Einleitung und F. voraus).
Jedenfalls in wirkungsgeschichtlicher Perspektive sind in der 1. Hälfte des 18. Jh.s für die F. zwei Personen zentral: auf praktisch-kompositorischem Gebiet J. S. Bach und auf theoretisch-didaktischem J. J. Fux. In den Gradus ad parnassum 1725, einem der wirkmächtigsten Musiklehrbücher überhaupt, mündet die Darstellung der kontrapunktischen Gattungen in eine systematisch von der Zwei- zur Vierstimmigkeit fortschreitende Behandlung der F. Dabei werden – was in der F.n-Theorie bis dahin keineswegs selbstverständlich ist – auch Bemerkungen zum formalen Aufbau gemacht, insofern Fux eine (von der späteren F.n-Theorie häufig geforderte) Dreiteiligkeit andeutet. Die jüngere Forschung hat deutlich gemacht, wie sehr die Gradus der italienischen und deutschen Musiktheorie des 16. und 17. Jh.s verpflichtet sind. Zu den Fux vorangehenden theoretischen Bemühungen zählt auch ein Bertalli zugeschriebener Traktat Regulae compositionis, der als erster die Verwendung nur eines Themas und dessen Verarbeitung in mehreren, durch themenfreie Abschnitte klar voneinander abgesetzten „Durchführungen“ verlangen soll.
Auch nach Aufkommen des „neuen Stils“ seit den 1720er/30er Jahren kommt der F.n-Komposition nicht nur in der vokalen Kirchenmusik, sondern auch im Instrumentalschaffen Wiener Provenienz großes Gewicht zu. Dies wird häufig der Wirkung von Fux zugeschrieben, teilweise mit einer Vorliebe der Habsburg-Kaiser für Kontrapunkt bzw. F. in Zusammenhang gebracht, lässt sich aber auch als konsequente Fortsetzung spätbarocker Gattungen oder Gattungskomponenten beschreiben. Von G. J. Werner, F. Tuma, G. M. Monn und W. R. Birck wird die Tradition der zweisätzigen Kirchensonate mit F.n-Schluss weitergeführt (wobei der allgemeinen kompositionsgeschichtlichen Entwicklung entsprechend die Quartett- zunehmend die barocke Triobesetzung verdrängt); die Divertimenti, Partiten und „neutralen“ Sonaten derselben Meister sowie von G. Ch. Wagenseil und F. L. Gaßmann werden regelmäßig mit einem langsamen Einleitungssatz und einer anschließenden F. eröffnet, worin – in Wechselwirkung – die Formkonvention der sonata da chiesa, der Usus früherer Wiener Komponisten, Suiten mit F.n zu eröffnen, und teilweise der Aufbau der französischen Ouvertüre nachwirken. Auch bestimmte „Freiheiten“ wie die Bassbegleitung zum ersten Themeneinsatz, homophone Episoden oder das Fehlen kontrapunktischer Kunstmittel lassen sich auf den F.n-Satz der barocken Sonate zurückführen. Schließlich wird bei den Wiener Meistern der „Vorklassik“ die F.n-Technik gelegentlich auch schon für die Finali in Ensemblewerken einschließlich Sinfonien herangezogen. Weiterhin werden nicht zuletzt zu liturgischen Zwecken Präludien und F.n sowie Versetten für Orgel verfasst (J. E. Eberlin, Wagenseil, Albrechtsberger).
Die Wiener Kontrapunkt- bzw. F.n-Tradition, deren herausragender Vertreter um 1800 als Komponist wie als Lehrer und Theoretiker J. G. Albrechtsberger war (von ihm stammen die an Fux anknüpfende Gründliche Anweisung zur Composition 1790 und zahlreiche Quartett- und Clavier-F.n), ist als eine entscheidende Voraussetzung für die F.n-Komposition der Wiener Klassiker anzusehen. J. Haydn, der als junger Mann autodidaktisch die Gradus studiert hatte und eine freundschaftliche Beziehung zu Albrechtsberger unterhielt, gestaltet – bereits im Sinn einer Aufwertung des Schlusssatzes – die Finali einer Reihe von Kammer- und Orchesterwerken als F.n (Barytontrios Nr. 97, 101, 114, Streichquartette op. 20 Nr. 2, 5 und 6, op. 42, op. 50 Nr. 4, sowie Sinfonien Nr. 3, 40 und 70); traditionsgemäß haben F.n -Sätze zudem ihren Platz in Kirchenwerken, v. a. in groß dimensionierten wie der Missa cellensis (Cäcilienmesse) oder dem Stabat mater. Auch für den jungen W. A. Mozart war der Kontrapunkt fester Bestandteil des Erfahrungshorizonts, vermittelt durch die Salzburger Kirchenmusik, die Wiener vorklassische Produktion, weiterhin das Studium der Gradus, aber auch die Begegnung mit Giovanni Battista Martini. Dies manifestiert sich schon früh u. a. in fugierten Schlusssätzen von Ordinariumsteilen (Messen KV 66, 167) und von Quartetten (KV 168, 173). In den 1780er Jahren tritt die Beschäftigung mit Bach hinzu (die wie in der frühen Bach-Rezeption insgesamt fast ausschließlich eine Beschäftigung mit dem Clavier-F.n-Komponisten war) und bis zu einem gewissen Grad mit G. F. Händel (wobei Mozart neben den Clavier-F.n auch in Oratorien enthaltene Chor-F.n kennen gelernt hat). In der Folge entstehen Bearbeitungen von Stücken aus dem Wohltemperierten Clavier für Streichinstrumente (KV 405; die Authentizität von KV 404a ist nicht gesichert), eine Reihe von vielfach fragmentarischen F.nversuchen (KV 375d–h; 383 b,d; 385 m, k; 394; 399; 401; 402; 417c; ) und schließlich die so ausgereifte F. für zwei Klaviere KV 426 (die später der Wiener Kirchensonate entsprechend für Streichquartett bearbeitet und mit einem einleitenden Adagio versehen wurde; KV 546). Als Höhepunkt Mozartscher F.nkomposition gelten die (in mancher Hinsicht auf die Wiener vorklassische Tradition zurückverweisenden) Finali des Streichquartetts KV 387, der Streichquintette KV 593 und 614 sowie der Sinfonie KV 551, die Ouvertüre zu Die Zauberflöte und das Requiem KV 626.
Als Hauptergebnis von Haydns und Mozarts Auseinandersetzung mit Kontrapunkt bzw. F. wird gemeinhin hervorgehoben: die Polyphonisierung des Satzes im Wiener klassischen Stil, d. h. die Profilierung der Begleitstimmen (das sog. obligate Accompagnement) und die Beteiligung aller Stimmen an der Präsentation des thematischen Materials (die sog. „durchbrochene Arbeit“); in den gleichsam explizit fugierenden Sätzen in kompositionstechnischer Hinsicht die bruchlose Integration von F.n-Stil und Sonatenform, Periodik bzw. Kadenzmetrik, in ästhetischer die Verbindung von „Gelehrtem“ und „Galantem“ oder „Popularem“.
Bei L. v. Beethoven, der mit dem Wohltemperierten Clavier schon im Unterricht bei Christian Gottlob Neefe vertraut gemacht wurde, durch das Studium bei Haydn und Albrechtsberger die Fux-Tradition gleichsam aus erster Hand kennen lernte, selbst Kontrapunkt-Unterricht (u. a. anhand der Gradus) erteilte, (wie Mozart) ein versierter F.n-Improvisator war sowie die von Haydn und Mozart geleistete Synthetisierung von F. und klassischem Instrumentalsatz voraussetzen konnte, durchzieht die Befassung mit der F. das ganze Schaffen. Auf frühe, zu Studienzwecken entstandene F.n aus den 1790er Jahren folgt der häufige Einsatz von Fugati als Mittel des thematischen Prozesses in Durchführungen, aber auch anderen Sonatenformteilen (z. B. Streichquartette op. 59 Nr. 1 u. 3, Klaviersonaten op. 101, 111) oder im Finale der Klaviervariationen op. 35. Zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der F.n-Komposition kommt es nochmals im Spätwerk. Hier dient die F. dann v. a. als gewichtiger Abschluss von Instrumentalzyklen (Cellosonate op. 102 Nr. 2, Klaviersonaten op. 106, 110, Grande Fugue op. 133, ursprünglich das Finale des Streichquartetts op. 130), wobei Beethoven bei allem bewussten Rückgriff auf die Tradition zu höchst individuellen und bisherige Konzepte überschreitenden Lösungen gelangt.
Auch im Werk einiger Beethoven-Zeitgenossen kann die F., sei es als selbständiges Stück, sei es als Finalsatz insbesondere von Streichquartetten ihren Platz behaupten (Albrechtsberger, I. Pleyel, Johann Spech, F. Krommer u. a.). Hinzu kommen durch das Wohltemperierte Clavier angeregte F.n-Zyklen durch alle Tonarten (z. B. bei N. v. Krufft, A. Hüttenbrenner). Einen eigenwilligen, für die zeitgenössische Situation der F. gleichwohl symptomatischen Beitrag stellen die 1803 veröffentlichten 36 Klavier-F.n des Haydn- und Albrechtsberger-Schülers A. Reicha dar (der auch als Komponist von Quartett-F.n und als F.n-Theoretiker hervorgetreten ist). Es handelt sich um zum Kapriziösen tendierende Stücke, in denen konventionelle Elemente wie konsequente Polyphonie, Tonartenfestigkeit, fugengemäße Thematik zur Disposition gestellt werden, und zwar aus einem (auch in der Begleitschrift Über das neue F.n-System 1805 zum Ausdruck kommenden) Bewusstsein für die zunehmende Distanz des aktuellen Komponierens zum überkommenen Begriff von F.
Für die Zeit seit dem frühen 19. Jh. lassen sich einige Grundlinien ausmachen:
(1) Die Kanonisierung des Œuvres Bachs bzw. dessen Erhebung in den Rang des Klassikers der F. hat zur Folge, dass diese weitgehend mit dem bei Bach vorzufindenden Typus identifiziert wird. Damit steht der bestimmende Einfluss in Zusammenhang, den die am Bachschen Werk orientierte Abhandlung von der F. von Friedrich Wilhelm Marpurg 1753/54 auf die Theorie des 19. Jh.s ausgeübt hat. Marpurgs Schrift wurde u. a. noch 1843 von S. Sechter neu herausgegeben (wobei der von Sechter verfasste Anhang im Kontext einer seit etwa 1800 laufenden Diskussion über den Begriff „F.“ steht, die durch die neuartigen, von einer strengen „Bach-F.“ abweichenden Kompositionen der Wiener Klassik ausgelöst wurde). Daneben wirkt aber im österreichischen Raum Fuxens Traktat weiter – z. B. kommen noch Fr. Schubert, A. Bruckner, J. Brahms mit ihm indirekt oder direkt in Berührung.
(2) Die Beherrschung des Kontrapunkts im Allgemeinen, der F. im Besonderen zählt zu den grundlegenden Fertigkeiten, über die man als Komponist zu verfügen hat. Ihre Verankerung im Unterricht führt zum Typus der „Schul-F.“ (der in Frankreich geradezu akademisch institutionalisiert wird). Darauf, dass die F.n-Komposition nun auch zu einer schematisierten, als Routine betreibbaren Technik zu Übungszwecken geworden ist, weist die Anekdote hin, wonach Sechter täglich eine F. verfasst haben soll. Konsequenterweise ruft die F. nun eine Assoziation mit Lehre, Lehrhaftem etc. hervor, was sowohl eine abschätzige Bewertung im Sinne von schulmeisterlich, pedantisch o. ä. als auch die Vorstellung besonderer Artifizialität, Meisterschaft, Gelehrtheit einschließen kann und entsprechende Verwendungen in Oper oder Programmmusik erlaubt (vgl. das Fugato im Abschnitt Von der Wissenschaft in R. Strauss’ Also sprach Zarathustra).
(3) In der kompositorischen Praxis kann sich die F. als selbständiges Stück – sieht man von der F.n-Komposition zu Studienzwecken ab – im mittlerweile freilich peripheren Bereich der (maßgeblich auf das Vorbild des Bachschen Werks bezogenen) Orgelmusik halten (neben diversen „Kleinmeistern“ z. B. bei Brahms). Weiterhin bleibt sie fixes Requisit der vokalen Kirchenmusik und des Oratoriums, wo sie sich zur Schlussgestaltung oder zur Vertonung gewichtiger Textabschnitte anbietet (z. B. Brahms, Deutsches Requiem, Schluss von Nr. 2, 3 und 6; sofern das Werk einen liturgischen Text verarbeitet, auch G. Mahlers 8. Sinfonie, Ende des ersten Teils).
Von den bedeutenderen in Österreich wirkenden Komponisten war es in erster Linie J. Brahms, in dessen Schaffen – vor dem Hintergrund einer intensiven Auseinandersetzung mit älterer Musik – die F. noch einen gewissen Stellenwert besitzt. Unter den mit Opuszahl versehenen Werken befindet sich jedoch nur eine F., und zwar am Schluss der Händel-Variationen op. 35; hinzu kommt allerdings die vergleichsweise relativ häufige Verwendung von Fugati in der Kammermusik (z. B. Klavierquintett op. 34, Sextett op. 36, Cellosonate op. 38). Auch von Bruckner, einem versierten Kontrapunktisten und F.n-Improvisator, liegen lediglich zwei eigenständige F.n-Kompositionen vor (innerhalb seines dem Bereich der „Nebenwerke“ zugezählten Orgelœuvres), von den Hauptwerken weist v. a. die 5. Symphonie im Finale ausgedehnte fugierende Arbeit auf.
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jh.s ist ein neu erwachendes Interesse an der Polyphonie und damit auch an der F. festzustellen. Es resultiert teils aus der Bewegung des Neoklassizismus bzw. Neobarock, teils hat es mit einem durch die Aufgabe der überkommenen harmonischen Tonalität hervorgerufenen Bedarf nach Ordnungsprinzipien bzw. mit einer verstärkt linearen Satzvorstellung zu tun. Wenngleich damit kontrapunktische Verfahrensweisen – auch im Gattungsbereich der Kammer- und Orchestermusik – erneut Aktualität gewinnen, gehen durch Atonalität (und erst recht Athematik) tragende Prinzipien der F.n-Komposition im traditionellen Sinn verloren. Es ist bezeichnend, dass trotz der grundlegenden Bedeutung polyphonen Denkens in der Zweiten Wiener Schule die noch am ehesten einer F. entsprechende Konstruktionen bei A. Schönberg in programmmusikalischem (Prelude to a Genesis Suite op. 44) und in einem besonders traditionsbesetzten Zusammenhang (am Ende des tonalen Orgelstücks Variations on a Recitative op. 40) auftreten. (Schönbergs Bemerkung, wonach es sich bei Nr. 18 Der Mondfleck aus Pierrot lunaire op. 21 um „eine F. [nur] zwischen Piccolo und Klarinette“ handle, zeigt bereits an, dass bei dem Satz als Ganzem von einer F. nicht die Rede sein kann.) Zu den historischen Formmodellen, die A. Berg den einzelnen Szenen seiner Oper Wozzeck zugrunde gelegt hat, zählt auch eine „F.“ (2. Akt, 2. Szene), hinter der sich ein dicht gearbeiteter Satz verbirgt, in dem nacheinander drei den Protagonisten zugeordnete Themen eingeführt und anschließend miteinander kombiniert werden.
Vermehrt begegnen F.n im 20. Jh. in der Orgelmusik, bezeichnenderweise v. a. bei Komponisten, die der Tonalität verpflichtet bleiben wie F. Schmidt oder durch ein besonderes Traditionsbewusstsein und eine wesentlich kontrapunktische Satzvorstellung geprägt sind wie J. N. David (der auch auf das Ricercar zurückgreift und mit Zwölf Orgel-F.n durch alle Tonarten op. 66 zu dem im 20. Jh. erneut gepflegten Genre des systematisch geordneten F.n-Zyklus beiträgt).
Literatur
MGG 3 (1995); NGroveD 7 (2001); M. Beiche in HmT 1991; A. Ghislanzoni, Storia della fuga 1952; H. Federhofer in Mf 11 (1958); K. Trapp, Die F. in der deutschen Romantik von Schubert bis Reger, Diss. Frankfurt a. M. 1958; R. Stephan in Max Planck-Institut für Geschichte (Hg.), [Fs.] H. Heimpel 1971; J. Müller-Blattau, Geschichte der F. 31963; A. Mann, The Study of Fugue 21965; W. Kirkendale, F. und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der Klassik 1966; I. Horsley, Fugue 1966; W. Apel, Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, 1967; A. Mann in J. J. Fux, Gradus ad parnassum (GA 7/1) 1967; F. W. Riedel in W. Salmen (Hg.), Die süddeutsch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jh. 1980; P. Wollny in MozartJb 1 (1991); A. Edler, Hb. der musikalischen Gattungen 7/1, 1997; P. Walker, Theories of Fugue from the Age of Josquin to the Age of Bach 2000.
MGG 3 (1995); NGroveD 7 (2001); M. Beiche in HmT 1991; A. Ghislanzoni, Storia della fuga 1952; H. Federhofer in Mf 11 (1958); K. Trapp, Die F. in der deutschen Romantik von Schubert bis Reger, Diss. Frankfurt a. M. 1958; R. Stephan in Max Planck-Institut für Geschichte (Hg.), [Fs.] H. Heimpel 1971; J. Müller-Blattau, Geschichte der F. 31963; A. Mann, The Study of Fugue 21965; W. Kirkendale, F. und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der Klassik 1966; I. Horsley, Fugue 1966; W. Apel, Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, 1967; A. Mann in J. J. Fux, Gradus ad parnassum (GA 7/1) 1967; F. W. Riedel in W. Salmen (Hg.), Die süddeutsch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jh. 1980; P. Wollny in MozartJb 1 (1991); A. Edler, Hb. der musikalischen Gattungen 7/1, 1997; P. Walker, Theories of Fugue from the Age of Josquin to the Age of Bach 2000.
Autor*innen
Markus Grassl
Letzte inhaltliche Änderung
18.2.2002
Empfohlene Zitierweise
Markus Grassl,
Art. „Fuge‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
18.2.2002, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001ce50
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.