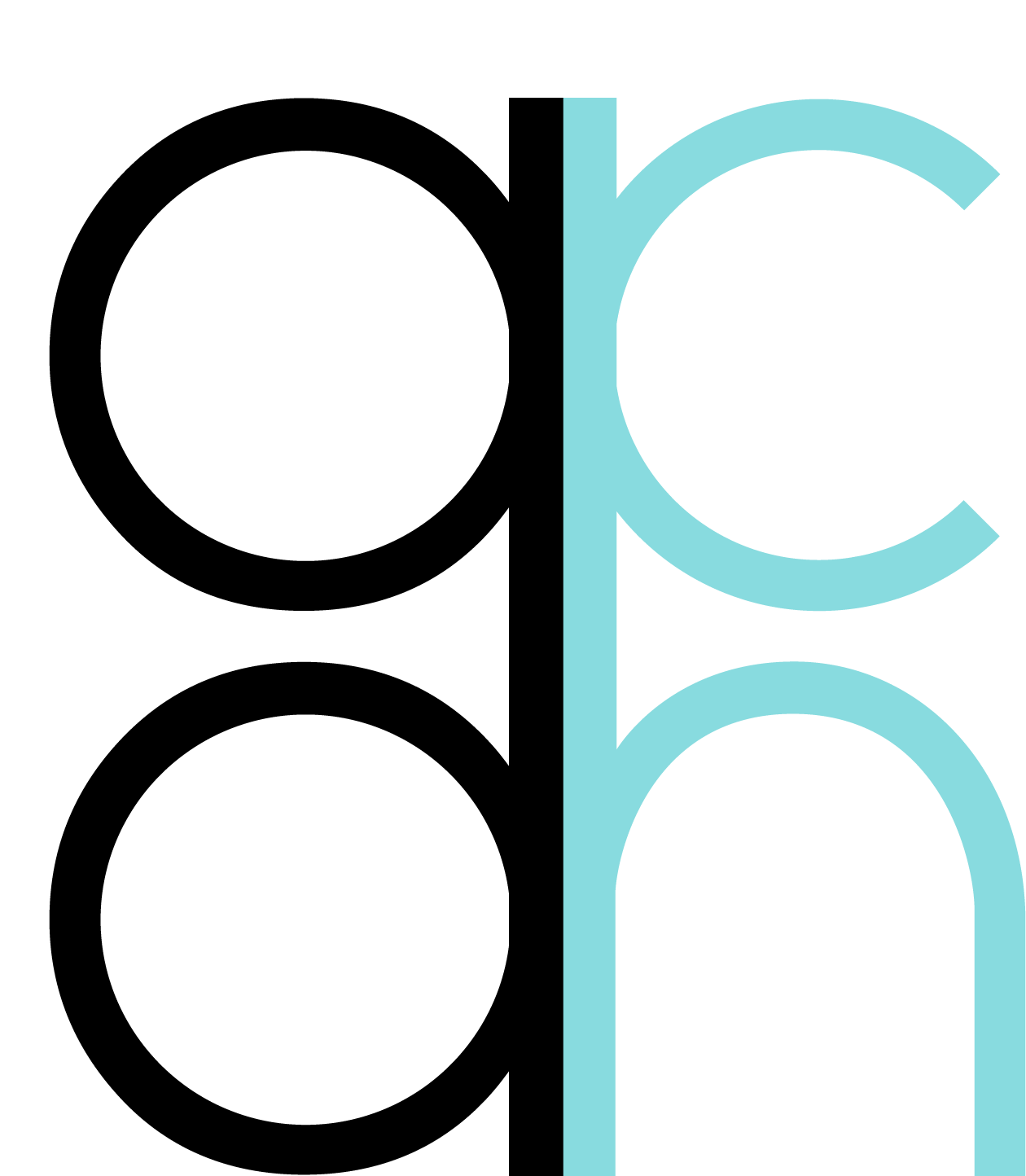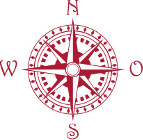Instrumentalmusik
Musik, die ausschließlich oder zumindest primär für Instrumente gedacht ist. Im modernen Verständnis einer von der Vokalmusik durch eigene Gattungen sowie in Faktur, Form, Stil usw. geschiedenen und, jedenfalls im Bereich der Kunstmusik, schriftlich konzipierten und überlieferten Musik, ist sie eine relativ späte Erscheinung. Sie liegt als Ergebnis eines im Spätmittelalter einsetzenden Prozesses erst Ende des 16. Jh.s voll ausgebildet vor. Für das Mittelalter und die beginnende Neuzeit hingegen ist von einem Zustand auszugehen, in dem das Musizieren auf Instrumenten einerseits schriftlose Praxis war (wobei ein vielfach abgestuftes Spektrum von freier über gebundene Improvisation bis hin zur Aufführung oral tradierter, aber mehr oder weniger festgelegter Stücke vorstellbar ist), andererseits zu einem erheblichen Teil in der Wiedergabe von original vokaler bzw. textgebundener Musik bestand. Es fehlt eine hinreichend breite Quellenbasis, um das „rein“ instrumentale Musizieren des Mittelalters rekonstruieren zu können; unsere Kenntnis von der Beschaffenheit der Instrumente, der Technik und den Fähigkeiten der Spieler und Sänger ist so beschränkt, dass nur sehr bedingt eine instrumentale, weil z. B. „unsangliche“ Idiomatik identifiziert werden kann; nicht restlos erhellt ist, ob und in welcher Hinsicht der Text für die Konzeption von Vokalmusik eine konstitutive Rolle spielte, usw. Festzuhalten bleibt, dass jedenfalls bis zum 16. Jh. ein grundsätzlich anders geartetes Verhältnis zwischen Vokal- und Instrumentalmusik nicht ausgeschlossen werden kann und es daher die v. a. in älterer Literatur häufige Rückprojektion von Vorstellungen zu vermeiden gilt, die an der neueren Vokal- und Instrumentalmusik ausgebildet wurden.Die ikonographischen und literarischen Belege für das Spiel auf Instrumenten sind im Mittelalter insgesamt so zahlreich, dass häufig von einer Verbreitung bzw. Präsenz quer durch die sozialen Schichten, in vielen Lebenszusammenhängen, bei einer Vielzahl von Anlässen, ja von „Allgegenwart“ die Rede ist. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass Instrumentalklang in bestimmten Situationen offenbar als unerlässlich galt, in zeremonialem Kontext sogar eine konstitutive Funktion besitzen konnte. Neben Hinweisen in den Quellen sprechen schon Plausibilitätsargumente für eine Bandbreite, die von „vormusikalischer“ Lärmerzeugung z. B. zu Signalzwecken bis zu kunstvolleren, elaborierten Darbietungen reicht. Der Versuch, ein genaueres Bild zu gewinnen, stößt freilich sehr schnell auf Probleme der Quelleninterpretation. Die Terminologie gerade der Musikinstrumente ist unscharf oder mehrdeutig; es ist damit zu rechnen, dass Abbildungen und literarische Beschreibungen oft symbolisch gemeint oder an Topoi gebunden sind; die Perspektive der mittelalterlichen Autoren ist weithin von „Ideologien“ oder Wertvorstellungen geprägt. Das gilt für die einem Ideal ritterlicher Lebensführung verpflichtete höfische Dichtung genauso wie für die Musiklehre bzw. die vom Klerus getragene Literatur, die das instrumentale Musizieren dem Bereich des usus zuordnet, also aus dem Kreis der theoriefähigen artes ausschließt und dagegen vielfach religiöse Bedenken hegt.
Immerhin lassen sich aufgrund der Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte selbst für die Zeit vor dem 14. Jh., in dem sich die Quellenlage zu verbessern beginnt, gewisse Grundlinien ausmachen. Das betrifft in erster Linie Funktion, soziale Zuordnung und Bewertung einzelner Instrumente. So ist seit fränkischer Zeit ein besonderes Prestige bestimmter Saiteninstrumente deutlich, zunächst der Lyra, seit dem 10. Jh. auch der Harfe, vom 11. Jh. bis ca. 1400 v. a. der Fiedel. In der höfischen Kultur des Hochmittelalters zählt das Spiel insbesondere der Harfe (neben dem Gesang) zu den einem Adeligen wohl anstehenden Betätigungen. Zugleich gilt das Spiel von Blasinstrumenten als eines Ritters unwürdig. Der höhere Rang des Musizierens auf Saiteninstrumenten, den das Mittelalter (und später die Renaissance) zumindest teilweise aus der im antiken Mythos wie Musikschrifttum bezeugten Überlegenheit der Leier gegenüber dem Aulos ableitete, stellt fortan eine Konstante in den auf I. bezogenen Werthaltungen dar, die – nimmt man den herausragenden Status klassisch-romantischer Streicherkammermusik hinzu – bis in die jüngste Zeit beobachtbar ist.
Relativ gut erschlossen ist die Geschichte der Trompete. Einiges spricht dafür, dass sie auch im lateinischen Westen seit römischer Zeit kontinuierlich in Verwendung stand, wenngleich zunächst in rein militärischer (während als das „laute“ Instrument für repräsentative, kultische und rituelle Aufgaben sowie für nicht-militärische Signalzwecke im Frühmittelalter die Glocke diente). Seit der 2. Hälfte des 12. Jh.s wuchs der Trompete, zunächst in den oberitalienischen, sehr bald in den Städten nördlich der Alpen und schließlich an den Fürstenhöfen eine neue Funktion und Bedeutung zu: sie wurde zur Insignie politischer Macht und rechtlicher Gewalt sowie zum Mittel der Herrschaftsrepräsentation. Dementsprechend stellte sie von nun an ein unerlässliches Requisit dar bei Verkündung bedeutsamer Rechtsakte, Zusammentreten von offiziellen Versammlungen, öffentlichen Auftritten oder Umzügen von Amtsträgern und Fürsten usw. Gleichzeitig mit diesem Funktionswandel wurde im Westen (wahrscheinlich nach byzantinischem oder arabischem Vorbild) die Bildung von reinen oder mit Holzblas- und/oder Schlaginstrumenten gemischten Trompetenensembles üblich. Zudem hat man im 13. Jh. (z. B. Ulrich v. Liechtenstein) erstmals Nachweise für die später gerade an den Habsburger-Höfen offenbar beliebte Kombination von Flöten und Trommel.
Hält man die vorhandenen Informationen zusammen, so zeichnen sich spätestens im 12./13. Jh. zwei getrennte Funktionsbereiche ab, die auch durch ein je eigenes Klangideal bzw. ästhetisches Wertkriterium voneinander abgehoben waren: einerseits eine Sphäre öffentlich-repräsentativen Musizierens mit Blasinstrumenten, dessen besondere Qualität in der Lautstärke („schal“, „strepitus“ u. ä.) als Ausdruck von Macht und Autorität lag; andererseits eine Sphäre des intimeren und künstlerisch verfeinerten Spiels auf Saiteninstrumenten, als dessen Merkmal die Sanftheit („sueze“, „dulcedo“) galt und dem die Vorstellung elitärer Distinktion im Kontext der höfisch-ritterlichen Kultur anhaftete.
Die seit Ende des 13./Anfang des 14. Jh.s auch im österreichischen Raum reicher fließenden Quellen lassen zunächst eine Differenzierung bzw. Spezialisierung der professionellen Instrumentalisten erkennen. Die Sesshaftwerdung von Spielleuten in den Städten, die sich in teilweise ausgedehntem Grundbesitz und im Zusammenschluss zu zunftartigen Berufsgenossenschaften (wie der Wiener Nikolai- Bruderschaft Ende des 13. Jh.s, Bruderschaft) niederschlug, und bald darauf die Anstellung solcher Musiker durch die Kommunen führte zur Ausbildung des Berufsstands der Stadtpfeifer/Türmer (Thurner). In der 2. Hälfte des 14. Jh.s unterhielten bereits zahlreiche Städte des Reichs Bläserensembles, deren große Bedeutung für die städtische Musikkultur durch die jüngere Forschung eindrücklich dokumentiert wurde.
Das Spätmittelalter ist die Zeit, in der die Orgel in Europa auf breiter Front in den Kirchenraum einrückte. Auch in Österreich setzen, von frühen Belegen für Salzburg im 13. Jh. abgesehen, im 14. Jh. mit ständig wachsender Häufigkeit die Nachrichten über Orgelbauten, selbst in kleineren Kirchen, ein. Parallel dazu beginnt die Überlieferung von Organistennamen und kam offenbar die Ausdifferenzierung des Organistenstandes in Gang (an den Habsburger-Höfen werden seit Mitte des 15. Jh.s Organisten namentlich erwähnt; allerdings scheint es zu dieser Zeit noch üblich gewesen zu sein, dass Orgelspieler sich zugleich auch als Spieler von Saiteninstrumenten betätigt haben). Die große Zahl von Hinweisen auf Orgeln und Organisten im österreichischen Raum lässt auf eine reich entfaltete Tradition schließen, die als die Voraussetzung für die Kunst eines P. Hofhaimer anzusehen ist. Im Kontext des spätmittelalterlichen Entwicklungsschubs auf clavieristischem Gebiet ist weiterhin die Figur des Wiener Gelehrten H. Poll zumindest bemerkenswert. Ihm ist wenn nicht die „Erfindung“, so doch eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des damals neuen Cembalos zuzuschreiben.
Entgegen der älteren Vorstellung vom „gotischen Spaltklang“ und „mittelalterlichen Zufallsorchester“ war die instrumentale Ensemblebildung, die sich seit dem 14. Jh. einigermaßen deutlich nachzeichnen lässt, von Beginn an durch eine Vorliebe für klangliche Homogenität und eine Tendenz zur Standardisierung gekennzeichnet. Die Ensemblezusammenstellung wurde jedenfalls z. T. durch die im 14. Jh. erstmals explizit belegte, aber schon im Hochmittelalter angelegte Klassifikation zwischen hauts und bas instruments reguliert (die reale Bedeutung dieser Trennung von „lauten“ und „leisen“ Instrumenten wird freilich in der Forschung bis zu einem gewissen Grad verschieden eingeschätzt). Seit Beginn des Jh.s begegnen diverse, zwei oder drei Instrumente umfassende Mischungen aus Schalmei, Sackpfeife (Dudelsack), Trompete, woraus sich gegen 1400 als Standardkombination die in der Folge weit verbreitete dreiköpfige sog. Bläser-Alta (Blasorchester) aus Schalmei, Pommer und (Zug)trompete herausbildete. Gegen Ende des Jh.s häufen sich daneben erstmals die Nachrichten von Ensembles aus Saiteninstrumenten, in erster Linie Duos verschiedener Zusammensetzung.
Im 13. und 14. Jh. trugen mehrere Faktoren zu günstigeren Bedingungen für die Aufzeichnung von I. bei. Es etablierten sich weltliche Schichten als Träger artifizieller bzw. schriftlich festgehaltener Musik; nicht zuletzt das Milieu rund um die neu entstehenden Universitäten brachte den Typus eines urbanen, weltläufigeren Kleriker-Intellektuellen hervor; die Aristoteles-Rezeption förderte gerade in Kreisen dieses gebildeten Klerus eine Aufgeschlossenheit gegenüber außerliturgischer Musik (der Pariser Magister Johannes de Grocheio beschreibt um 1300 in seiner musiktheoretischen Schrift erstmals die musikalische Szene seiner Zeit in größerer Breite und kommt dabei auch auf I. zu sprechen); mit der Orgel bzw. dem liturgischen Orgelspiel fasst eine instrumentale Praxis im klerikalen, d. h. traditionell literaten und mit musikalischer Schrift vertrauten Milieu Fuß.
Sieht man von den textlosen Stücken in den Motettenhandschriften Bamberg/D und Montpellier/F ab, deren instrumentale Bestimmung zweifelhaft ist, so umfasst der bis ca. 1400 überlieferte Bestand an I. zum einen 30 zumeist einstimmige Stücke, die in Modal- oder Mensuralnotation (Notation) als Anhang oder Einschübe mit ansonsten textiertem Repertoire eingetragen wurden. Zu einem großen Teil handelt es sich um (ausdrücklich so benannte) Estampien (die entgegen älterer Ansicht heute überwiegend nicht mehr als Tanzmusik angesehen werden) und Tänze. Auffällig ist die geographische Streuung (England, Frankreich, Italien, Böhmen). Die Handschrift Prag XVII F 9 (Ende 14. Jh.) enthält zwei einstimmige, von einem Teil der Forschung als Tanzmusik eingeschätzte Melodien, deren eine (so wie einige der italienischen Stücke) mit einem Namen überschrieben ist (Czaldy Waldy) und damit ein frühes Zeugnis für die bis ins 17. Jh. weithin geübte Praxis darstellt, Instrumentalsätzen einen individualisierenden oder charakterisierenden Titel zu geben. Diese frühen Aufzeichnungen werfen zahlreiche Fragen auf, die ihr Verhältnis zu der dahinterstehenden schriftlosen Praxis betreffen: inwiefern sind sie dafür repräsentativ, handelt es sich um besonders gelungene und daher aufzeichnungswürdige oder „Durchschnitts“-Realisationen? Liegen Ergebnisse gebundener Improvisation (etwa nach dem Modell Gerüstmelodie plus Auszierung aus dem Stegreif), Improvisationsvorlagen oder fertige Stücke vor? Für welches Instrument sind sie gedacht, treten bei der Ausführung der einstimmigen Melodien wie immer geartete Begleitstimmen hinzu? Teils wird in der musikwissenschaftlichen Literatur die „ornamentale“, kleingliedrige und sequenzierende Melodik mancher dieser Stücke als Spur eines spezifischen Instrumentalstils herausgestellt, teils die Nähe zur vokalen Musik akzentuiert. Immerhin ist auffällig, dass bei großer Vielfalt im Detail allen Sätzen die formale Anlage, nämlich die Reihung von Doppelversikeln, gemeinsam ist, eine Gestaltungsweise, die auch Johannes de Grocheio in seinen Bemerkungen zur I. andeutet.
Eine zweite Gruppe bilden die Quellen von Musik für Tasteninstrumente, der Robertsbridge-Codex (England, 1. Hälfte 14. Jh.) und der umfangreiche, knapp 50 Stücke umfassende Codex Faenza (Italien, Anfang des 15. Jh.s). Sie enthalten ein breites Spektrum an instrumentalen Musizierformen: Einrichtungen bzw. Intavolierungen (Tabulatur) von Vokalwerken, Sätze über einen langmensurierten Tenor-c.f., sei es eine Tanz- oder eine liturgische Melodie, und selbständige instrumentale Stücke (Estampien). Der zweistimmige, nur stellenweise durch isolierte dreitönige Klänge verstärkte Satz besteht aus einer langsameren Stimme für die linke Hand (die im Fall drei- oder mehrstimmiger Vokalvorlagen durch Zusammenziehung des originalen Tenors und Contratenors gewonnen wird) und einer bewegten (im Fall der Intavolierungen die originale Oberstimme auszierenden) Linie für die rechte Hand.
Dank neuerer Forschungen verfügen wir über ein recht plastische Bild von der reichen, in Städten und an Höfen ganz Europas gepflegten I.-Kultur des 15. Jh.s. Auffällig sind die Parallelen zur Vokalpolyphonie der franko-flämischen Ära. So kommt es auch in der I. zu einer Intensivierung des überregionalen bzw. internationalen Austauschs, was eine in den Grundzügen europaweit recht einheitliche Entwicklung zur Folge hat (die viele Länder umspannende Mobilität der Instrumentalisten und die entsprechende Verbreitung ihres Repertoires lässt sich teilweise bis in Einzelheiten hinein dokumentieren). Der österreichische Raum ist nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage, d. h. seiner Brückenfunktion hin zu Italien, eng in dieses Beziehungsnetz eingebunden. Ähnlich den Sänger-Komponisten aus dem franko-flämischen nehmen die Instrumentalisten aus dem deutschen Sprachraum eine europäische Vorrangsstellung ein. Zumal an den italienischen Höfen der 2. Jh.hälfte sind (insbesondere die namhaften) Spieler zu einem erheblichen Teil deutscher Herkunft.
Dass im 15. Jh. erstmals der Typus des international renommierten und ausstrahlenden Instrumentalvirtuosen auftritt (erinnert sei an P. Hofhaimer, N. Krombsdorfer oder die zeitweise ebenfalls an österreichischen Höfen tätigen Angehörigen der Familie Schubinger), ist nur eine Facette eines umfassenden Prozesses der sozialen wie ästhetischen Aufwertung der I. So hält die Integration und der Aufstieg der städtischen Musiker unvermindert an, wird das instrumentale Musizieren um seiner selbst willen zum beliebten Zeitvertreib adeliger, aber auch patrizischer Amateure (Maximilians I. Lautenspiel ist hier symptomatisch), verstärkt sich die Tendenz zur Festanstellung von Instrumentalisten in Städten und an den Höfen, beginnt sich besonders mit dem Trompeterkorps eine Instrumentalistengruppe neben der Kantorei als organisatorische Einheit der Hofmusik herauszukristallisieren usw. Den entscheidenden Faktor in künstlerischer Hinsicht stellt freilich die schrittweise Annäherung der instrumentalen Praxis an die Standards der artifiziellen vokalen Mehrstimmigkeit dar, was schließlich zur Entstehung komponierter instrumentaler res facta führt.
In der Ensemblebildung wurden die früheren Ansätze weitergeführt. Die v. a. bei öffentlich-repräsentativen Anlässen und zum Tanz aufspielende, von zahlreichen Städten und Höfen in Burgund, Italien und dem Reich unterhaltene Bläser-Alta, zu deren Aufgaben einer Reihe von Zeugnissen zufolge auch die Wiedergabe mehrstimmiger Vokalkompositionen zählte, vergrößerte sich den Wandlungen des Vokalsatzes entsprechend in der 2. Hälfte des Jh.s auf vier und mehr Spieler und dehnte durch Aufnahme der Posaune ihren Ambitus nach der Tiefe aus. Neben der Alta dominierte unter den hauts instruments das Trompetenensemble, das von anfänglich zwei bis drei Spielern im Laufe des Jh.s sukzessive auf bis zu zwölf anwächst und um die Kesselpauke (Pauke) erweitert wurde (frühe Belege z. B. am Hof Friedrichs III.). Die Verbindung von Trompeten und Pauke war fortan die musikalische Insignie fürstlicher Macht schlechthin. V. a. an den Höfen und nur beschränkt in den Städten trat als drittes Standardensemble das Duo aus leisen Instrumenten hinzu (besonders Laute und Harfe, Laute und ein Streichinstrument und seit etwa 1450 v. a. zwei Lauten). Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist der gegen 1500 vollzogene Übergang von der Verwendung eines Plektrons zum Spiel mit den Fingerkuppen, womit auch dem solistischen Lautenspiel polyphones Repertoire zugänglich wurde.
Die durch Schrift- und Bildquellen reich bezeugte Tanzmusik des 15. Jh.s war nach wie vor schriftlose Praxis. Erhalten sind einige Aufzeichnungen von einstimmigen, in Breven gleichmäßig mensurierten Basse danse-Melodien, wobei die früheste und umfangreichste Quelle die für Margarete v. Österreich zusammengestellte Hs. Brüssel B-Br 9085 (Ende 15. Jh.) ist. Nach überwiegender Meinung der Forschung dienten solche Basse danse-Tonfolgen als Tenorfundamente, über die insbesondere die Alta oder ein leises Duo bewegte Außenstimmen bzw. bewegte Oberstimmen extemporieren konnten. Es versteht sich, dass derartige Improvisationen eine gewisse Versiertheit im mehrstimmigen Satz bzw. Kontrapunkt vorausgesetzt haben. Für das spätere 15. Jh. existieren Hinweise darauf, dass Alta-Spieler Zusatzstimmen schriftlich entworfen haben. Das Repertoire der Instrumentalensembles bestand offenbar zu einem erheblichen Teil aus mehrstimmigen Vokalkompositionen (zu den zentralen Zeugnissen zählt die sog. Casanatense-Handschrift von ca. 1480, eine eigens für die Alta des ferraresischen Hofs angelegte Sammlung von franko-flämischen Chansons) Auch dies trug naturgemäß zur Vertrautheit mit komplexer Mehrstimmigkeit bei und bedeutet weiterhin, dass im Laufe des 15. Jh.s zunehmend mit einer Beherrschung der musikalischen Notation bei Instrumentalisten zu rechnen ist.
Der wachsenden Bedeutung der Orgel entspricht die steigende Tendenz der Aufzeichnung von Tastenmusik im 15. Jh. Wie schon der Robertsbridge-Codex und der Codex Faenza stammen die wohl in erster Linie Studien- und Übungszwecken dienenden Quellen bezeichnenderweise aus dem klösterlichen Bereich, die Überlieferung ist jetzt aber auf den deutschen Sprachraum konzentriert. Neben der großen Sammlung des sog. Buxheimer Orgelbuchs (Bayern oder alemannischer Raum, um 1460/70) mit mehr als 250 Stücken hat sich eine ganze Reihe von kleineren Sammlungen, Einzelstücken oder Fragmenten erhalten. Darunter befinden sich eine zweistimmige Kyrie-Bearbeitung in einer Hs. aus der Abtei Mondsee (A-Wn 3617, frühes 15. Jh.) und mehrere Intavolierungen von Vokalwerken, u. a. von Guillaume Dufay, in einer möglicherweise im Wiener Dorotheer-Kloster angelegten Hs. (A-Wn 5094, ca. 1450).
Die Repertoiretypen (Übertragung von Vokalkompositionen, c. f.-Bearbeitungen, selbständige Stücke, insbesondere sog. „Präambula“) und die Satzanlage mit bewegter Ober- und langsamer Tiefstimme entsprechen zunächst im Wesentlichen dem aus den älteren Quellen Bekannten. Allerdings wird immer häufiger der Satz auf drei oder sogar mehr Stimmen erweitert, infolgedessen die vollständige Wiedergabe vokalpolyphoner Vorlagen ermöglicht, fallweise bei der Ornamentierung der Oberstimme Zurückhaltung geübt und auf diese Weise ein bewegungsmäßig ausgeglichener Satz erreicht sowie mitunter der c. f. abwechslungsreicher behandelt (z. B. umspielt oder auf mehrere Stimmen aufgeteilt). Auch die tasteninstrumentale Praxis bewegt sich also auf die zeitgenössische Vokalpolyphonie zu. Zugleich stellen die frühen Aufzeichnungen von Tastenmusik in mehrfacher Hinsicht einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der I. dar: Nicht nur wird instrumentales Musizieren überhaupt erstmals in größerem Ausmaß verschriftlicht. Mit den in einigen Hss. des 15. Jh.s enthaltenen Fundamenta, systematisch aufgebauten Sammlungen von Beispielen, die zum Erlernen und Üben der Improvisation über einen c. f., die zeigen, wie zu gegebenen Tenor-Intervallschritten Oberstimmenfigurationen gespielt werden können, wird eine genuin instrumentale Produktionsweise rationalisiert und auf den Boden von Schrift gezogen. Anders als Spieler von Melodieinstrumenten bzw. Ensembles, die mehrstimmige Musik wie Sänger aus Stimm- oder Chorbüchern vortragen konnten, bedurften Instrumentalsolisten dafür einer eigenen Aufzeichnungsweise. Mit den Tabulaturen und Klavierpartituren des 14. und 15. Jh.s liegt erstmals eine spezifisch instrumentale Notation vor
Einen prominenten Fall der Wechselbeziehung zwischen instrumentaler Praxis und vokaler schriftlicher Mehrstimmigkeit stellen weiterhin die sog. „Trompetenstücke“ dar, textgebundene Kompositionen, in denen eine Stimme im Idiom von Trompeteninstrumenten gehalten ist (z. B. Dufays Gloria ad modum tubae, Jean Cousins Missa tubae, im Trienter Codex 90, aber auch Dy trumpet in der Mondsee-Wiener Liederhandschrift). Ganz unabhängig davon, ob diese Stimmen von einer Trompete oder – wie heute vielfach angenommen – vokal realisiert wurden, dringt hier instrumentale Idiomatik in den Bereich der komponierten Kunstmusik ein.
In der 2. Hälfte des 15. Jh.s überliefern Handschriften mit mensuraler Mehrstimmigkeit in großer Zahl untextierte, teilweise mit Namen oder abstrakten Bezeichnungen (wie „Carmen“) versehene Sätze. Die ältere Forschung hat dazu geneigt, darin undifferenziert „I.“ zu sehen. Nach und nach wurden viele dieser Stücke aber als (bloß ohne Text notierte) originale Vokalkompositionen identifiziert; auch konnte gezeigt werden, dass die Textlosigkeit der Niederschrift eines Vokalwerks nicht unbedingt eine ausschließlich instrumentale Wiedergabe bedeuten muss (sondern es konnte nachträglich Text unterlegt, der Satz auf Solmisationssilben gesungen oder sonst vokalisiert werden). Ebenso wenig bieten bestimmte stilistische Merkmale wie rasche Skalenbewegungen, prägnante motivische Wendungen („Spielfiguren“), Sequenzbildungen oder Ostinati die von der Musikwissenschaft aufgrund einer unhistorischen Dichotomisierung von Instrumental- vs. Vokalstil lange als Indizien für Instrumentales gewertet wurden, ein sicheres Kriterium für das Vorliegen genuiner I., weil derartige Formulierungen häufig auch in Vokalwerken der Zeit begegnen. Es bedarf der Bündelung von kontextuellen, kodikologischen, philologischen und aus der musikalischen Faktur gewonnenen Argumenten im Einzelfall. Dabei wird aber deutlich, dass einige dieser Kompositionen tatsächlich unabhängig von einem sprachlichen Text konzipiert worden sein dürften, wie u. a. La morra von H. Isaac, La Martinella und zwei als Fuga bezeichnete Stücke von J. Martini. Auch bei diesen Stücken dürfte neben der instrumentalen eine gesungene Darbietung in Frage gekommen sein. Weiterhin sind sie stilistisch noch stark an der franko-flämischen Chanson und Motette orientiert. Insofern sie aber in einer Zeit, in der die Vokalkomposition sich an den formalen und expressiven Eigenschaften des vertonten Texts auszurichten beginnt, textunabhängige musikalische Erfindungen darstellen, bedeuten sie einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung hin zu selbständiger komponierter I. In dieser Hinsicht ist umso bemerkenswerter, dass in einigen dieser Stücke ansatzweise versucht wird, dem Werkganzen mit rein musikalischen Mitteln, z. B. durch motivische Bezüge, Kohärenz zu verleihen.
Entgegen der älteren Anschauung, wonach der Typus dieser sog. Instrumentalfantasie in Italien aufgekommen wäre, deutet die geographische und chronologische Schichtung der Überlieferung auf eine Entstehung nördlich der Alpen mit anschließender Verbreitung nach Italien hin. Die Annahme, dass dabei der österreichische Raum involviert war, liegt auch deshalb nahe, weil einige Stücke des einschlägigen Repertoires in den Trienter Codices und im Codex des N. Leopold enthalten sind und von Komponisten stammen, die wie Isaac oder Martini Beziehungen zu Habsburger-Höfen unterhielten.
Mehrere eng miteinander verschränkte Tendenzen führten während des 16. Jh.s zur Verschriftlichung von I. in einem bis dahin unbekannten Ausmaß: Instrumentales Musizieren erlangte an den Höfen ganz Europas und in den stadtbürgerlichen Kulturen insbesondere Italiens und des deutschen Sprachraums immer größere Bedeutung, v. a. dank des Aufschwungs, den das Instrumentalspiel von Amateuren aus dem Kreis des Adels und des gebildeten und besitzenden Bürgertums nahm. Dies weckte einen rapide wachsenden Bedarf nach schriftlich fixiertem Repertoire, der durch den um 1500 entwickelten Notendruck (den wesentlichen Auslöser der „Quellenexplosion“ des 16. Jh.s) befriedigt werden konnte, und löste gleichsam die Erfindung neuer musikalischer Textsorten aus: der Instrumentalschule und des instrumentalen Lehr- bzw. Übungsstücks. Dass die I. nun theoriefähig wurde, äußerte sich weiterhin in der nach und nach einsetzenden Erörterung durch die allgemeine Musiktheorie.
Das Mode-, Haus- und Laieninstrument des 16. Jh.s war die Laute. Neben dem traditionellen Vorrang der Saiteninstrumente und praktischen Gründen (wie der leichten Transportierbarkeit) war dafür ihre universelle Verwendbarkeit (seit ihrer Entwicklung zum Akkordinstrument) ausschlaggebend. Insofern auf der Laute nicht zuletzt der Liebhaber sich potentiell jede Musik zugänglich machen konnte, ähnelte ihre Rolle der des Klaviers seit dem 19. Jh. Im deutschsprachigen Raum überwiegt bei den I.-Drucken bis weit in die 2. Jh.hälfte hinein die Lautenmusik (mit deutlicher Verspätung tritt die offenbar zunächst weiterhin primär von Professionellen gepflegte Tastenmusik hinzu), das Repertoire setzt sich fast ausschließlich aus Tänzen und intavolierten Vokalwerken zusammen. Die Veröffentlichungen des in Wien tätigen H. Judenkünig von 1515/19 und 1523, zwei Lehrbücher zum Selbststudium, aber auch die frühe, im Wiener Studentenmilieu beheimatete, handschriftliche Sammlung des Jak. Thurner von ca. 1522/24 zeigen, dass der österreichische Raum von Beginn an am „Siegeszug“ der Laute Anteil hatte.
Ganz generell nahm die Bedeutung der Instrumente in der Musizierpraxis zu. Zu den markantesten aufführungspraktischen Tendenzen des 16. Jh.s zählt, dass immer häufiger Instrumentalisten und Sänger bei der Wiedergabe von Vokalmusik zusammenwirkten, sei es, dass die Instrumente colla parte mitspielten, sei es, dass sie einzelne Vokalstimmen ersetzten. Die „klassische“ zum Vokalchor, zumal bei liturgischer Mehrstimmigkeit, hinzutretende Instrumentalistengruppe war das aus der Alta hervorgegangene Zinken-Posaunen-Ensemble (den frühesten Beleg für die Verbindung von Kantorei mit Zinken und Posaunen stellt eine Abbildung im Triumphzug Maximilians I. dar). Nicht minder bedeutsam, weil eine der historischen Voraussetzungen des Generalbasses ist die im Laufe des Jh.s immer gängiger werdende Integration von colla parte begleitenden Tasteninstrumenten in vokale und/oder instrumentale Ensembles. Auch erweiterte sich das Instrumentarium, zum einen durch das Aufkommen neuer Typen (wie der Viola da gamba seit Ende des 15. Jh.s und der Violine, die seit dem frühen 16. Jh. belegt ist), zum anderen durch die am Ideal des homogenen Vokalsatzes orientierte und schon zu Beginn des Jh.s weitgehend abgeschlossene Ausbildung der sog. Instrumentenfamilien. Musizieren auf Instrumenten spielte offenbar eine wichtige Rolle bei der sich im 16. Jh. vollends ausdifferenzierende „Kammermusik“, einem zwar noch nicht fest über bestimmte Gattungen, aber schon funktional und ästhetisch (durch Merkmale wie Intimität, dezente Klanggebung, solistische Besetzung, höhere technische Ansprüche) abgegrenzten Musizierbereich, für den das reine Viola da gamba-Ensemble als besonders angemessen galt. Nachrichten von speziell „in der Kammer“ eingesetzten Instrumentalisten sind gerade an den österreichischen Höfen zahlreich.
All diesen Entwicklungen entspricht eine an den Höfen auch der Habsburger deutliche Vermehrung der Instrumentalisten. Ihre steigende Bedeutung manifestiert sich auf institutioneller Ebene, wenn Hofmusikordnungen nun erstmals ausführlich die Aufgaben von Instrumentalisten regeln (z. B. die Innsbrucker Instruction und Ordnung auf die Capeln und Instrumentisten von 1565). Schließlich spricht für die Aufwertung der I. bzw. die Verschränkung der Sphäre vokaler Mehrstimmigkeit mit der instrumentalen Praxis, wenn Instrumentalisten mit Leitungsfunktionen in Hofkapellen (Hofmusikkapelle) betraut werden (wie der Posaunist St. Mahu unter Ferdinand I. oder der Organist A. Padovano in Graz) oder Kapellmitglieder mit textungebundenen bzw. instrumentalen Kompositionen hervortreten (wie der Hofkaplan M. Flecha d. J. mit seiner Maximilian II. gewidmeten Harmonia à 5).
Als Folge der breit einsetzenden Verschriftlichung ist erstmals aus dem 16. Jh. in größerem Umfang Tanzmusik erhalten, im deutschen Sprachraum v. a. in Lauten- und Orgeltabulaturen. Zu den vergleichsweise selteneren Quellen mit Ensembletänzen zählt eine vermutlich vom Hof Maximilians I. stammende Handschrift (D-As 142a, Anfang 16. Jh.). Auch die umfangreichste Tanzmusikquelle des 16. Jh.s, die Sammlung der Brüder Hess (Breslau 1555), bei der es sich zugleich um den ersten deutschen Druck von instrumentaler Ensemblemusik handelt, steht insofern in Beziehung zu den Habsburgern, als die beiden Bände Erzhzg. Ferdinand II. und Kaiser Maximilian II. gewidmet sind. Nach wie vor bezogen die Instrumentalisten ihr Repertoire zu einem erheblichen Teil aus der zeitgenössischen Vokalmusik, wie nicht zuletzt die lange Reihe von Intabulierungen für Laute oder Tasteninstrument und die von Ensembles verwendeten Mensuralhandschriften mit textlos notierten Vokalwerken zeigen (besonders bemerkenswert ist eine Ende des 16. Jh.s höchstwahrscheinlich für den Grazer Hof angelegte Handschrift, D-Rp A.R. 755–777, mit Stücken v. a. von O. di Lasso und Alessandro Striggio, die detaillierte Angaben zur Besetzung mit einem Ensemble aus Zinken, Pommern und Posaunen enthält). Ferner darf die imponierende Zunahme der schriftlichen Überlieferung nicht darüber hinwegtäuschen, dass instrumentales Musizieren immer noch zu einem erheblichen Teil schriftlos vor sich ging. Entscheidend ist aber, dass sich im 16. Jh. ein Komponieren ausbildete, das von der Vokalmusik unabhängig war, d. h. den Möglichkeiten und Problemen der Textlosigkeit durch eine spezifische Gestaltungsweise Rechnung trug, eine instrumentale Idiomatik und schließlich eigene Gattungen ausprägte. Diese sog. Emanzipation der I. (oder eigentlich: Entstehung der I. im uns geläufigen Sinn) erfolgte – idealtypisch gefasst – auf zwei Wegen.
Erstens wurden schriftlose instrumentale (und vielfach sozusagen von vornherein instrumentalidiomatische) Spielpraktiken verschriftlicht, fixiert, dabei verfeinert und angereichert, d. h. artifizialisiert. Dieser Prozess lässt sich in mehreren Bereichen in jeweils verschiedener Ausprägung verfolgen. Die bei der Wiedergabe von Vokalwerken (ursprünglich aus dem Stegreif) angebrachten Verzierungen wurden in den Intavolierungen in hohem Maße schriftlich festgehalten; zwar bestehen diese sog. Diminutionen zu einem großen Teil aus stereotypen Formeln, mit denen die Vorlagen schematisch überzogen, häufig geradezu überwuchert wurden; in einzelnen Fällen, etwa bei V. Greff gen. Bakfark, zeigen sie aber Ansätze zur Individualisierung, motivischen Differenzierung oder unterstreichen (bzw. überspielen) die formale Gliederung der Vorlage. Nachdem die usuelle und ursprünglich musikalisch wohl eher schlichte Musik der Trompeterkorps durch die Technik des sog. Clarinblasens eine gewisse Komplexität erreicht hatte, wurde diese improvisatorische Bläserpraxis in Traktaten beschrieben (erstmals durch Cesare Bendinello, einen Hoftrompeter Maximilians II.) und sogar in Kompositionen aufgegriffen (wie den Intradae A. Orologios 1597, die das trompetentypische Idiom mit Elementen des motettisch-imitativen Satzes verbinden). In den (für die Orgel bestimmten) Bearbeitungen liturgischer Melodien erweiterten sich (beginnend bei A. Schlick und in der Hofhaimer-Schule) nochmals die Möglichkeiten der c. f.-Behandlung, griff die Imitationstechnik Platz, zugleich wurden aber in den ornamentalen Figurationen und in einem freistimmigen oder zwischen Akkordik und Polyphonie changierenden Satz die speziellen Möglichkeiten des Tasteninstruments ausgenützt. Am deutlichsten zu beobachten ist die Entwicklung von einer Stegreifpraxis hin zu einer eigenständigen Gattung instrumentalen Komponierens beim Genre des freien Präludierens. Anfänglich wurden in den Tabulaturen kurze, geradezu lapidare Gebilde noch ganz improvisatorischen Charakters niedergeschrieben, deren Faktur sich mit den Grundelementen des Spiels auf Laute oder Tasteninstrument, Klang bzw. Griff und rasche lineare Bewegung bzw. Lauf, begnügten. Nach und nach drangen Elemente der artifiziellen Mehrstimmigkeit wie insbesondere die Imitation ein, wurde der Satz polyphonisiert, das den Diminutionen ähnelnde Figurenwerk abwechslungsreicher, bis zu Ende des Jh.s recht ausgedehnte, nun relativ einheitlich als „Toccata“ bezeichnete und auch in eigenen Sammlungen veröffentlichte virtuose Vortragsstücke vorlagen.
Der zweite Weg instrumentaler Gattungsbildung hatte seinen Ausgangspunkt in dem an Modellen der Vokalmusik angelehnten, aber textungebundenen Komponieren. An die Tradition der „Instrumentalfantasie“ des 15. Jh.s schlossen fugierte Formen wie die Fantasia oder das (imitierende) Ricercar an, die mit der stufenweisen, quasi-vokalen Melodieführung und der abschnittsweisen Durchimitation von Motiven zunächst der Motette ähnelten und häufig noch ausdrücklich „zum Singen oder Spielen“ bestimmt waren. Das Problem der Herstellung von Zusammenhang unter der Bedingung von Textlosigkeit wurde bald durch eine Reduktion der Imitationsvorwürfe, mitunter bis hin zur Monothematik gelöst; teilweise wurde durch Beschleunigung gegen Schluss ein Steigerungseffekt erzielt, gleichzeitig kamen immer mehr sog. kontrapunktische Kunstmittel wie Augmentation, Diminution oder Umkehrung ins Spiel, nahm die satztechnische Komplexität und der äußere Umfang zu, sodass schließlich eine anspruchsvolle Gattung des gelehrten, spezifisch instrumentalen Kontrapunkts entstanden war. Grundlage der Canzone war die französische Chanson des frühen 16. Jh.s. Die Entwicklung führte (in fließenden Übergängen) von der Intavolierung und Wiedergabe durch Instrumentalensembles über die paraphrasierende bzw. parodierende Neukomposition im Ausgang von originalen Vokalchansons zu neu erfundenen, stilistisch und formal aber noch an der vokalen Vorläufergattung orientierten Instrumentalstücken. Gegen Ende des Jh.s löste sich die Canzone freilich von ihrem vokalen Ursprung: Der Aufbau aus stark kontrastierenden Formabschnitten, eine kleingliedrige, prägnante Motivik und eine auf Klangfolgen beruhende Zusammenhangsbildung verliehen ihr eine ganz eigentümliche Gestalt.
Die beschriebenen Entwicklungen vollzogen sich zwar nicht ausschließlich, aber doch schwergewichtig in Italien. Von den italienischen Zentren kam Venedig eine herausragende Bedeutung zu, wo Komponisten wie Adrian Willaert, J. Buus, A. und G. Gabrieli und C. Merulo Entscheidendes für die Genese der Instrumentalgattungen Ricercar, Canzone und Toccata leisteten. Nachdem sich insbesondere die Höfe in Innsbruck und Graz, gerade auf dem Gebiet der I. aber auch der Wiener Kaiserhof seit etwa der Mitte des Jh.s italienischem Einfluss gegenüber geöffnet und italienische oder in Italien ausgebildete Instrumentalisten und Instrumentalkomponisten (J. Buus, A. Padovano, G. Dusinello, A. Orologio, H. L. und J. Hassler, Ch. Luython u. a.) beschäftigt hatten, fand der österreichische Raum direkten Anschluss an die aktuellsten Tendenzen auf dem Gebiet der I.
Eine wichtige (wenngleich nicht immer angemessen hervorgehobene) Facette der Geschichte der I. im 16. Jh. ist ihr Konnex mit der allgemeinen Kompositionsgeschichte. In mehrfacher Hinsicht hatte die I. Anteil an den Entwicklungen, die zur „neuen“ Musik um 1600 geführt haben (Monodie): Das Nach- oder Mitspielen von Vokalpolyphonie auf Laute oder Tasteninstrument leistete einen wesentlichen Beitrag zur Ausbildung des Generalbasses und der damit verbundenen vertikalen bzw. akkordischen Satzauffassung; die Bassbezogenheit des Satzdenkens wurde durch das Improvisieren über die sog. Tanzbässe (wie Follia, Ciacona, Ruggiero usw.) gefördert (die nicht zufällig dann in der komponierten Musik des 17. Jh.s eine bedeutende Rolle spielen); der die Gb.-gestützte Monodie vorbereitende Außenstimmensatz war in einer Reihe von instrumentalen Genres ansatzweise bis deutlich ausgeprägt; die (Verschriftlichung der) Diminution bereitete den Boden für den virtuosen solistischen bzw. konzertierenden Stil des Barock auf; und ganz generell ist zu bedenken, dass die Musik des Generalbasszeitalters, d. h. Musik mit einem obligaten instrumentalen Anteil, auch in vokalen Gattungen, ohne den Vorgang der Emanzipation der I. nicht denkbar gewesen wäre.
Anfang des 17. Jh.s war ein neuer Zustand im Verhältnis von Vokal- und Instrumentalmusik erreicht: Die „neue“, ganz der Text- bzw. Affektdarstellung verpflichtete monodische Vokalmusik lässt eine (sinnvolle bzw. adäquate) Wiedergabe nur auf Instrumenten nicht mehr zu (dem entspricht, dass die Intavolierungspraxis ihr Ende fand); umgekehrt hatten sich Gattungen wie das Ricercar und die Fantasia, die anfänglich zum Spielen und Singen gedacht waren, um 1600 zu rein instrumentalen entwickelt. Auf diese prinzipielle Scheidung des instrumentalen vom vokalen Bereich folgte ein im 17. und 18. Jh. permanent fortschreitender Prozess der Idiomatisierung bzw. internen Differenzierung der I. So trennte sich zunächst die (zunehmend auf den Generalbass gestützte) Ensemble- von der Solomusik. Ende des 16. Jh.s waren Ricercare, Fantasien und Canzonen mitunter noch zwischen Ensemble und Tasteninstrument austauschbar, seit Anfang des 17. Jh.s bildeten sie einerseits spezifisch tasteninstrumentale Gattungen, die schließlich zur Klavierfuge führten, andererseits zweigte sich als eigener Typus die vielstimmige, teilweise mehrchörige, oder geringstimmige Ensemble-Canzone ab, die eine wesentliche Vorstufe der (Kirchen-)Sonate darstellte. Seit der Generation Girolamo Frescobaldis erhielt das Figurenwerk des stylus phantasticus ein zunehmend tastenspezifisches Gepräge (während die Diminutionsfloskeln des 16. Jh.s im vokalen und instrumentalen Bereich einander vielfach noch glichen) und begann sich in Frankreich eine eigene lautenistische Satzweise herauszukristallisieren. Der Idiomatisierungsprozess verlief je nach Gattung und Region durchaus verschieden. Während in Italien und im italienischen Einflussbereich Orgel- und Cembalomusik bis ca. 1700 nicht prinzipiell stilistisch, sondern allenfalls funktional voneinander geschieden waren, kam es in Frankreich nach der Mitte des Jh.s. zu einer Trennung sowohl der Satztechnik bzw. Textur, der Klangvorstellung als auch den Gattungen nach. Insoweit der cembalistische style brisé bei J. J. Froberger und seinen Nachfolgern in der Suitenkomposition aufgegriffen wurde, wirkte sich dies auch auf die (ansonsten italienisch geprägte) österreichische Produktion aus. Waren in der (monodischen) Ensemblemusik die Solostimmen zunächst noch weitgehend variabel besetzbar und insbesondere die anfangs des 17. Jh.s bevorzugten Soloinstrumente Violine und Zink vielfach gegeneinander austauschbar, etablierte sich gegen Mitte des Jh.s in Italien die Violine als das dominierende solistische Melodieinstrument (anders als in Frankreich, wo sie bis um 1700 ihren Status als „niedriges“ Instrument zur Tanzbegleitung behielt). Gerade in Österreich entstand in der 2. Hälfte des 17. Jh.s eine äußerst virtuose und durch Mittel wie Skordatur oder Vielgriffigkeit idiomatische Soloviolin-Literatur (J. H. Schmelzer und H. I. F. Biber).
Tragende Bedeutung gewann in der I. des 17. Jh.s die aus dem (usuellen) Gebrauchstanz sich im Wege von Stilisierung und Artifizialisierung herauslösende komponierte Tanzmusik. Die zyklusartige Zusammenstellung von Tanzsätzen führte zur Ausbildung neuer Gattungen wie der Suite oder der Kammersonate. Bemerkenswert, wenngleich nach wie vor nicht restlos geklärt ist das gehäufte Auftreten der (früher für eine österreichische Erfindung gehaltenen) sog. Variationssuite bei in Ober- und Niederösterreich tätigen Musikern zu Beginn des Jh.s (J. Thesselius, P. Peuerl, I. Posch). Entscheidenden Anteil an der Genese der Claviersuite und der Standardisierung ihrer Satzfolge hatte Froberger. Der Usus, in der höfischen Kammer sowohl Tanzmusikformen als auch „abstrakte“ Stücke aus der Tradition der Canzone bzw. Kirchensonate zur Aufführung zu bringen, manifestierte sich in gemischten Publikationen (zu den frühesten zählt G. B. Buonamente 1626) und in der zyklischen Kombination von Satztypen aus beiden Bereichen (Schmelzer 1664, Biber 1681, Georg Muffat 1682/1701, J. J. Fux 1701), eine Praxis, als deren Fortsetzung die Verbindung von „neutralen“ und Menuett-Sätzen im Divertimento des 18. Jh.s betrachtet werden kann.
Im österreichischen Raum blieb während der 1. Hälfte des 17. Jh.s der italienische, zumal venezianische Einfluss auf dem Gebiet der Ensemblemusik bestimmend. In der gedruckten Produktion dominiert die mehrchörige bzw. vielstimmigen Kanzone und Sonate (F. Stivori 1630, G. Valentini 1614, G. Priuli 1618 und 1619), dabei ist eine gewisse Vorliebe für vielfältige Besetzungen und Instrumentenkombinationen erkennbar. In zweiter Linie treten Solo- bzw. geringstimmige Sonaten (G. A. Pandolfi Mealli, Buonamente) hinzu. In der Claviermusik wurde durch Froberger der Anschluss einerseits an das Schaffen Frescobaldis, andererseits an die französische Tradition hergestellt. Die österreichische I. der 2. Hälfte des 17. und des frühen 18. Jh.s weist einige Besonderheiten auf: Die vielstimmige Kanzone bzw. Sonate, der in Italien zunehmend vom Triotypus der Rang abgelaufen wurde, konnte sich bis in die 1670/80er Jahre halten, v. a. in Form stark besetzter Sonaten mit Blasinstrumenten (Trompeten, Zinken, Posaunen), denen als sog. Sonate solenni auch ein ganz bestimmter liturgischer Status zugeordnet wurde. Dass Sonaten des da chiesa-Typs auch in der Kammer Verwendung finden konnten, wurde von österreichischen Komponisten gelegentlich im Titel ihrer Sammlungen wie z. B. Sonatae tam aris quam aulis servientes (Biber 1676) explizit zum Ausdruck gebracht (weiters Schmelzer 1659 und 1662, Biber 1681). Anfangs des 18. Jh.s trat im weiterhin reichen Kirchensonatenschaffen (Fux, A. Caldara, Got. Muffat) schließlich die Triobesetzung (Kirchentrio) in den Vordergrund. Zudem wurde nun einerseits aus dem italienischen Concerto bzw. der Opern-Sinfonia die Dreisätzigkeit (schnell-langsam-schnell) übernommen, andererseits die für den österreichischen Raum spezifische zweisätzige Form (langsam-schnell) ausgebildet. Für die österreichische Claviermusik nach 1650 ist die häufige Verbindung von Suite und Variation charakteristisch (W. Ebner, Froberger, A. Poglietti), v. a. aber die lang andauernde Nachwirkung Frobergers. Die von ihm geprägten Typen der sog. Variationsfuge wurden wie auch die Suite bis gegen die Mitte des 18. Jh.s gepflegt (Got. Muffat).
Die Jahrzehnte um 1700 stehen in weiten Teilen Europas im Zeichen der immensen Ausstrahlung der von Jean-Baptiste Lully repräsentierten französischen Tradition und des modellhaften Œuvres von Arcangelo Corelli. Damit verbunden war eine Normierung von Satztypen, Besetzungsarten und Formen (Triosonate, Concerto grosso [Konzert], französische Ouvertüre bzw. Ouvertüren-Suite), was sich unmittelbar nach der Jh.wende in der „Definition“ der Solokonzertform (durch das ebenfalls international rezipierte Œuvre A. Vivaldis) und der Standardisierung der dreisätzigen Opern-Sinfonia fortsetzte. Georg Muffat, der 1682 die ersten gedrucken Concerti grossi überhaupt vorlegte und dessen Vorworte in seinen Veröffentlichungen von Ouvertüren-Suiten 1695/98 die zentrale Quelle für die Aufführungspraxis des französischen Stils sind, zählt zu den frühesten und bedeutendsten Vertretern der Corelli- und Lully-Nachfolge im deutschsprachigen Raum und damit zugleich des Konzepts eines „vermischten Stils“ (woran auch Fux 1701 anschloss).
Im musikästhetischen Diskurs blieb bis weit in das 18. Jh. hinein die Vokalmusik das verbindliche Modell. I. galt wegen ihrer Textlosigkeit als „defizienter Modus“ von Musik (C. Dahlhaus), ihr ästhetischer Wert wurde an sprachanalogen Eigenschaften bzw. dem Vermögen, Vokalspezifisches nachzubilden, festgemacht (vgl. die schon im 16. Jh. auftretende Vorstellung, vornehmste Aufgabe der Instrumente wäre die Nachahmung der menschlichen Stimme, oder die Projektion rhetorischer Formmodelle auf Instrumentalwerke oder das Konzept einer „Klangrede“, d. h. einer zur Darstellung konkreten Sinns und v. a. zum Affektausdruck befähigten I.). In der kompositorischen Produktion schlug sich die Übertragung der Affekten- bzw. Nachahmungsästhetik in instrumentalen Lamenti bzw. Tombeaus und programmatischen bzw. Charakterstücken nieder (in Österreich etwa bei Froberger und seinen Nachfolgern, Biber, Schmelzer, Muffat). Auch stilistisch, satztechnisch, form- und gattungsgeschichtlich blieb die Vokalmusik eine wichtige Basis der I. So wurden z. B. Elemente des affekt-geprägten Vokalstils (wie Chromatik, Rezitativik, dynamische und rhythmische Flexibilität des Vortrags) übernommen, stellte die vokale Monodie eine der Grundlagen für den Satztypus der Solo- und Triosonate dar, war die Anlage der da capo-Arie eines der Modelle der Ritornellkonzertform und das Einleitungsstück der italienischen Oper Ausgangspunkt für die Entwicklung der Sinfonie usw. Entscheidend und neu war aber, dass seit Anfang des 17. Jh.s umgekehrt „Instrumentales“ massiv in den vokalen Bereich eindrang (offenkundigste Beispiele sind die aus der improvisierten Tanzmusik stammenden Ostinato-Formen, die Instrumentaleinlagen bzw. Ritornelle in Vokalstücken und natürlich der Generalbass) und sich so eine intensive Wechselwirkung zwischen instrumentaler und vokaler Musik einstellte. Dies bedeutete zugleich, dass die entscheidenden kompositionsgeschichtlichen Entwicklungen und Neuerungen während des 17. und der 1. Hälfte des 18. Jh.s sich gleichermaßen in beiden Sparten vollzogen bzw. ihre wesentlichen Voraussetzungen (auch) auf instrumentalem Gebiet, und hier ganz besonders in der Tanzmusik hatten. Zu erinnern ist nur an so grundlegende Elemente der „barocken“ Musiksprache wie die (im instrumentalen Figurenwerk der Zeit um 1600 vorbereitete) sog. Korrespondenzmelodik oder die (erstmals in Canzone und Ostinato-Formen zu Tage tretende) auf Kontrast und Wiederholung beruhende Formbildung, weiterhin die gegen 1700 (in Sonate, Concerto, Sinfonia, Suite) endgültig erreichte Etablierung zyklischer Formen aus mehreren motivisch-rhythmisch integrierten bzw. in einer Bewegungsart gehaltenen Einzelsätzen, die zugleich – auf Grundlage der sich herauskristallisierenden harmonischen Tonalität – übergreifend harmonisch disponiert sind; die Tanzmusik leistete einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung des modernen Takts und die Tastenmusik zur Entwicklung temperierter Stimmungen und des (die Transponierbarkeit der Skalen voraussetzenden) Dur-Moll-Systems; Symptom der wachsenden Bedeutung der I. für das musikalische Denken ist schließlich, dass die Generalbasslehre gegen 1700 über eine bloße aufführungstechnische Handleitung hinaus zu einem Fundament der allgemeinen Satz- und Kompositionslehre geworden war (im österreichischen Raum ist dieser Zustand spätestens bei J. B. Samber 1704/07/10 erreicht).
Die bei weitem noch nicht vollständig aufgearbeitete österreichische I. zwischen 1740 und 1780 bietet ein höchst komplexes Bild. Man hat es mit einer gewaltigen Produktion zu tun, innerhalb derer sich eine vielschichtige, keineswegs immer lineare Entwicklung vollzog und an der zahlreiche Komponisten beteiligt waren (neben J. Haydn und W. A. Mozart v. a. F. I. A. Tuma, I. Holzbauer, G. Ch. Wagenseil, M. G. Monn, L. Mozart, J. Starzer, F. Aspelmayr, F. L. Gaßmann, Leop. Hofmann, F. X. Dusek, C. d’Ordonez, J. G. Albrechtsberger, M. Haydn, J. Myslivecek, L. A. Kozeluch, J. B. Vanhal, C. Ditters v. Dittersdorf, W. Pichl, I. Pleyel).Wien, das damals zu einer der großen europäischen Metropolen gerade auf dem Gebiet der I. neben Paris, London und Mannheim aufstieg, nahm wohl die führende Stellung ein, doch trugen viele kleinere Zentren – Klöster, Bischofsresidenzen, Adelssitze in der „Provinz“ usw. – nicht unerheblich zu einer reichen Pflege von I. bei. Dass sich dafür eine Fülle von Gelegenheiten und Anlässen bot, hatte seinen Grund nicht zuletzt in der Überschichtung von traditionellen Funktionsbereichen wie der fürstlichen, Repräsentationszwecken dienenden Kammer und der Kirche (aus der aufwendigere I. erst infolge der josephinischen Reformen endgültig zu weichen hatte) einerseits und von neuen Organisationsformen wie dem aufkommenden privaten oder (halb)öffentlichen Konzert (bürgerliche Musikkultur) andererseits.
Der ab etwa 1730 „neue“ aus Italien importierte Stil, der zumal in Österreich das spätbarocke Idiom nicht sofort verdrängte, sondern sich damit auf differenzierte Weise überlagerte, war wohl ursprünglich in der (komischen) Oper aufgetreten; seiner geschlossenen, „galanten“ Melodiebildung eignet etwas Liedhaftes (das Lied verkörperte für die zeitgenössische Ästhetik des Natürlichen das Eigentliche der Musik); der periodische Aufbau aus wiederholten oder gereihten Gliedern in gerader Taktzahl ist jedoch gleichermaßen auf die I., insbesondere den Tanz, zurückzuführen; ebenso hat die weiträumigere harmonische Disposition (und damit verbunden die Verlangsamung des harmonischen Rhythmus sowie die Lösung vom Generalbassdenken) auf der Basis der voll entwickelten harmonischen Tonalität instrumentale Grundlagen; zur Kadenzmetrik bzw. zum Akzentstufentakt schließlich wäre ohne einen wesentlich durch den Tanz geprägten musikalischen Erfahrungshorizont nicht vorzudringen gewesen.
Die Forschung stimmt mittlerweile (2002) darin überein, dass die formgeschichtliche Entwicklung des 18. Jh.s nicht quasi-teleologisch auf das Ziel der einen (im 19. Jh. aus dem Werk L. v. Beethovens als Lehrmodell abstrahierten) Sonatenhauptsatzform hin zu rekonstruieren ist. Vielmehr wird die Pluralität der formalen Gestaltungen im Bereich des „Sonatensatzes“ bzw. die Vielschichtigkeit des formhistorischen Prozesses betont. Gleichwohl lässt sich festhalten, dass die kompositorische Problemstellung zentral um die Frage kreiste, mit rein musikalischen Mitteln zu einem weit ausgespannten, „logisch“ strukturierten Verlauf zu gelangen (was schließlich zur Voraussetzung für die Vorstellung einer gleichsam sich selbst genügenden, „absoluten“ Musik wurde).
Wesentlicher Träger dieser Prozesse war die Sinfonie (Symphonie), die sich gegen die Mitte des Jh.s von ihrer Funktion als Opernvorspiel emanzipierte und deren Gestaltungsprinzipien in der Folge auf andere Gattungen einzuwirken begannen. Als ein Ausgangspunkt der Entwicklung in Österreich (wo die italienische Musik nach wie vor fest verankert war) können die Opernsinfonien der Generation von N. Porpora und L. Vinci gelten. Allerdings sind noch nicht alle Aspekte der Frühgeschichte der Sinfonie in den österreichischen Ländern erhellt (das gilt etwa für die Rolle der „einheimischen“, schon bei Fux und Caldara auftretenden Sonate a quattro oder für den Einfluss der von G. B. Sammartini im damals habsburgischen Mailand geschaffenen Konzertsinfonie). Feststeht, dass das italienische Modell sehr bald lokalspezifisch aus- und umgestaltet wurde, insbesondere durch die relativ häufige Einbindung eines Menuetts (hier stand wohl das Divertimento bzw. die länger zurückreichende Vorliebe für die Verbindung von neutralen und Tanzsätzen im Hintergrund), die fallweise Neigung zu einem „gearbeiteten“ Charakter bzw. den Rekurs auf Gestaltungsmittel des strengen Stils. Insgesamt ergibt die österreichische Sinfonieproduktion der Vorklassik ein uneinheitliches, buntes Bild (Haydns und Mozarts frühe Sinfonien sind hier durchaus symptomatisch): Die Stücke differieren der äußeren Dimension, der kompositorischen Ambition und den Tonfällen nach, es begegnen verschiedene zyklische Anordnungen und Satzformen, das Spektrum der Texturmodelle reicht vom Kontrapunkt über den Triosatz bis zu diversen Arten des homophonen oder konzertanten Satzes. Zwar ist ab ca. 1760 eine Tendenz von der anfänglich dominierenden a quattro-Besetzung hin zu einer größeren Besetzung unter Beteiligung von (obligaten) Bläsern erkennbar, womit sich die Trennung von Kammer- und Orchestermusik anbahnt; allerdings ist auch in dieser Phase nicht immer eine eindeutige Entscheidung zwischen solistischer und chorischer Besetzung möglich.
Nicht minder „unübersichtlich“ ist die Situation im Bereich des Divertimento. Dabei handelt es sich um die zwischen ca. 1750/80 im österreichischen und süddeutschen Raum häufigste Bezeichnung für zumeist solistisch besetzte Stücke, die oft (keineswegs aber immer) neutrale Sätze und Menuette mischen. Darüber hinaus lassen sich nur sehr bedingt allgemeingültige Aussagen treffen. Der Terminus „Divertimento“ wurde herangezogen für Werke mit ganz unterschiedlicher Satzfolge und Besetzung (Soloinstrument, Klavier mit begleitenden Melodieinstrumenten, reine Streicher- oder Bläser- bis hin zu vielstimmigen gemischten Besetzungen). Allenfalls kam es partiell, bei einzelnen Komponisten, in einer bestimmten Phase oder lokal, zu einer etwas fixeren Korrelation von Terminus, Besetzung und/oder Form und damit zu Ansätzen von Gattungsbildung (bekanntestes Beispiel ist die auch von Haydn bevorzugte fünfsätzige, zwei Menuette umfassende Form bei vier oder mehr Stimmen). Kompliziert erscheint die Lage ferner durch den Gebrauch zahlreicher weiterer Werkbenennungen, die vielfach mit „Divertimento“ austauschbar waren. Auch hier lässt sich bestenfalls die Neigung zu etwas festeren, aber nie ganz trennscharfen Zuordnungen ausmachen. Z. B. tendierten „Cassatio“, „Serenade“ und „Notturno“ dazu, eher leichtere, mehr als vierstimmige Stücke für Streicher und/oder Bläser zu sein, während „Sonate“, „Trio“, bis ca. 1750 noch „Partita“ und erst ab den 1770er Jahren „Quartett“ sich in erster Linie auf ernstere Kompositionen mit bis zu vier Stimmen v. a. für Streicher bezog. Insgesamt dominierten in der Ensemblemusik die Instrumente der Violinfamilie (eine österreichische Besonderheit ist die relativ ausgedehnte Literatur für Baryton). Hatte bis ca. 1750 die aus der barocken Triosonate stammende Besetzung mit zwei lagengleichen Melodieinstrumenten und Bass quantitativ überwogen, war spätestens um 1760 die Streichquartett-Besetzung in den Vordergrund getreten. Eine Wiener Spezialität stellen die in der Tradition der Kirchensonate wurzelnden und bis um 1800 gepflegten Streicherensemblestücke zu drei und mehr Stimmen dar, die einen oder mehrere fugierte Sätze enthalten. Sie gelten – wie die Elemente des strengen Stils in der Sinfonie – als Ausdruck eines anhaltenden Interesses am gelehrten Kontrapunkt. Dieser oft erwähnte, für die Wiener Musikkultur der 18. Jh.s typische „konservative“ Grundzug zählt freilich zugleich zu den Voraussetzungen für den (auf der potentiellen Gleichberechtigung der Stimmen beruhenden) Tonsatz der Wiener Klassik.
Um 1750 setzt in den habsburgischen Ländern weiterhin die Überlieferung von Solokonzerten ein (die Bedeutung Vivaldis für die Frühgeschichte der Gattung in Österreich ist noch ungeklärt). Dass neben den allgemein üblichen Soloinstrumenten (darunter v. a. dem Klavier) gelegentlich auch ungewöhnliches, aus der Volksmusik stammendes Instrumentarium eingesetzt wurde (z. B. Maultrommel, Mandora), gilt als besonders deutliches Anzeichen einer relativ engen Beziehung zwischen Kunst- und Volksmusik, die sich auch im Tonfall insbesondere von Divertimento- oder Sinfonie-Menuetten und in selbständigen Tanzkompositionen (Deutscher, Kontertanz) manifestierte.
Gegen Ende des 18. Jh.s kam der Prozess einer Stabilisierung und Fixierung von Formen, Besetzungen, Stilmitteln, Terminologie und ästhetischem Anspruch, d. h. der Gattungskonsolidierung zum Abschluss. Dies war, wenn nicht ausschließlich, so doch ganz entscheidend die Leistung Haydns und des mit ihm in den 1780er Jahren intensiv interagierenden Mozart, woran Beethoven – auf weitere Expansion in allen Dimensionen, Ausdrucksintensivierung und Individualisierung zielend – anschloss.
Orchester- und Kammermusik blieben in der sog. Wiener Klassik einerseits durch eine Reihe von nun nachhaltig etablierten Prinzipien oder Eigenschaften verbunden: die motivisch-thematische Arbeit, die neuerliche Polyphonisierung des Stimmverbands in der sog. durchbrochenen Arbeit und dem „obligaten Accompagnement“, die Kadenzmetrik und den Akzentstufentakt sowie den Zyklus aus (vom Solokonzert abgesehen) vier Sätzen mit einer stärker fixierten Formanlage und einer je eigenen Charakteristik bzw. Funktion für das zyklische Ganze, wobei meistens an dritter Stelle ein Menuett oder Scherzo steht und ein gewichtigeres Finale abschließt (das vollends bei Beethoven zum Höhe- oder Zielpunkt des daraufhin ausgerichteten Gesamtverlaufs ausgebaut wurde). Andererseits trennten sich beide Bereiche durch den Gegensatz von solistischer und chorischer bzw. voller orchestraler Besetzung und ein spezielles kompositorisches Profil, das in einem Fall zu äußerster Verfeinerung und Subtilität, im anderen zu Monumentalität und Erhabenheit tendierte. Auf dieser Grundlage wurden die beiden um 1800 an die Spitze der instrumentalen Gattungshierarchie vorgerückten Genres, Streichquartett und Symphonie, sehr bald mit einer emphatischen ästhetischen Bedeutung aufgeladen, nämlich das Streichquartett als „reinstes“ Muster des kunstvollen mehrstimmigen Tonsatzes, metaphorisch als geistreiches Gespräch, die Symphonie als ein an die Öffentlichkeit, wenn nicht Menschheit adressiertes Ideen-Kunstwerk aufgefasst.
Die klare Abgrenzung der Kammermusik ging mit einer internen Abgrenzung und hierarchischen Abstufung ihrer Gattungen einher: An der Spitze steht die Streicherkammermusik, innerhalb dieser nimmt das Streichquartett den höchsten Rang ein, gefolgt vom Trio und dem (bezeichnenderweise besetzungsmäßig in den Mittelstimmen instabilen) Quintett. Einen zweiten Bereich bildet die Klavierkammermusik, dabei dominieren auch quantitativ Klaviertrio und die Sonate für ein Melodieinstrument und Klavier (die erst bei Mozart die Spuren der begleiteten Klaviermusik abzustreifen begannen), während die Bläserkammermusik tendenziell an Bedeutung verlor. Die chronologische Schichtung von Beethovens Kammermusikschaffen spiegelt diesen Prozess einer hierarchischen Binnenstrukturierung in auffälliger Weise wieder: Bis in die ersten Wiener Jahre bediente er sich ganz verschiedener Besetzungen mit reicher Bläserbeteiligung, nach 1800 entstanden nur mehr Cello- und Violinsonaten, Klaviertrios und Streichquartette, das Spätwerk konzentrierte sich ganz auf das Streichquartett. Weiterhin etablierte sich die Sonate als die zentrale Gattung der solistischen Klaviermusik. Diese erlangte endgültig durch Beethovens Sonaten-, aber auch Variationen-Schaffen kompositorisch wie ästhetisch einen mit Symphonik und Kammermusik vergleichbar hohen Rang.
Wien war im späten 18. Jh. aus einer Reihe von Gründen zum europaweit führenden Zentrum auf dem Gebiet der anspruchsvollen I. geworden (nicht zuletzt weil z. B. Paris in Folge der Revolution zunächst einmal „ausfiel“ und in Italien die institutionellen Grundlagen für eine reichere I.-Pflege fehlten; Musikland Österreich) Parallel zur umfangreichen und innovativen kompositorischen Produktion kam nun auch ein Musikverlagswesen in Gang und erlebte der Instrumentenbau, insbesondere der technisch weiter entwickelte Klavierbau, einen nachhaltigen Aufschwung. Mit den internationalen Erfolgen Haydns seit ca. 1780 setzte die im 19. Jh. in einer geradezu kultischen Verehrung Beethovens gipfelnde, buchstäblich weltweite Rezeption der I. der – vom deutschsprachigen Musikschrifttum im 19. Jh. als historiographische und ästhetische Kategorie konstruierten – „Wiener Klassik“ ein.
Haydns Bedauern darüber, „daß jetzt so viele Tonsetzer komponieren, die nie singen gelernt hatten“ oder H. Ch. Kochs Insistieren, dass die Tonkunst „eigentlich nur in Verbindung mit der Dichtkunst [...]ihren eigentlichen Endzweck erreichen“ würde, weshalb das Überwiegen reiner I. zu beklagen sei (Versuch, 1782), reflektieren zwar noch ein Nachwirken des Primats der Vokalmusik, zeigen indirekt aber zugleich, wie sehr das Instrumentale die Grundlage des Denkens in und über Musik geworden war. Dies ist ganz generell an der fundamentalen Rolle zu sehen, die Generalbass und Harmonielehre sowie (allein schon deshalb) die Beherrschung eines Tasteninstruments in der Musiklehre und der musikalischen Basisunterweisung seit Beginn des Jh.s spielten, im speziellen z. B. daran, dass Instrumentalschulen seit der Jh.mitte in einem über das jeweilige Instrument hinaus reichenden Ausgriff auf Fragen der allgemeinen Stil-, Vortrags- und Musiklehre abzielen konnten (L. Mozart, Johann Joachim Quantz, C. Ph. E. Bach). Wenn sich sodann gegen Ende des 18. Jh.s mit der Formenlehre ein neuer musiktheoretischer Themenbereich etablierte, der im 19. Jh. (im Ausgang v. a. von Beethovens Werk) in das Zentrum der Kompositionslehre rückte, so entsprang dies dem Bedürfnis, Klarheit über den musikalisch eigengesetzlichen (also nicht von einem Text gesteuerten) Aufbau der hoch entwickelten „klassischen“ I. zu schaffen. Um 1800 wurde schließlich insbesondere anhand der Symphonik der Wiener Klassik von der deutschen Frühromantik (Wilhelm Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, E. T. A. Hoffmann) die Vorstellung ausgebildet, die „reine“ I. würde wie keine andere Kunst in transzendente Sphären hinüberragen („eine Ahnung des Unendlichen“ vermitteln, „das ferne Geisterreich“ aufschließen etc.), und damit die I. – erstmals in ihrer Geschichte – zum musikästhetischen Paradigma, ja zum Paradigma von Kunst überhaupt erhoben.
Die „Idee der absoluten Musik“ trug (zusammen mit den tiefgreifenden sozialen und institutionellen Umschichtungen durch die Verbürgerlichung der Gesellschaft und des Musiklebens) zu jener Differenzierung des Musikbegriffs bei, die zu den entscheidenden und bis heute wirksamen musikhistorischen „Leistungen“ des 19. Jh.s zu rechnen ist: Die Kunstmusik, der nunmehr aufgrund ihrer „Geistfähigkeit“ der herausragende Platz angewiesen wurde und als deren Inbegriff die mit metaphysischer Würde ausgestattete I. galt, begann sich von den vielfältigen Formen der Trivial- oder Unterhaltungsmusik, der (nach und nach schriftlich dokumentierten) Volks-, der Militär- und Salonmusik abzukoppeln. Es kam zur Ausdifferenzierung je eigener Konzerttypen bzw. Aufführungsbereiche, zur Spezialisierung der Komponisten auf eine bestimmte Art von Musik, zu je eigenen Bedingungen der Produktion und Distribution, die auf dem Gebiet der Unterhaltungsmusik zur Kommerzialisierung (Musikkonsum) oder Industrialisierung (Musikindustrie) tendierten (prominentestes Beispiel in Österreich ist wohl das Unternehmen der Familie Strauß). Wohl bestand zwischen „hoher“ und „niederer“ Kunst eine komplexe und differenzierter Betrachtung bedürftige Wechselbeziehung, wurde also z. B. der Wiener Walzer bei J. Strauß Sohn verfeinert und zum Konzertstück stilisiert, schöpften die Militärmusikkapellen ihr Repertoire zum Teil aus der „ernsten“ Musik, integrierte umgekehrt G. Mahler das „triviale“ Vokabular bzw. Idiom in seine symphonische Redeweise usw. Insgesamt drifteten jedoch die Sphären ästhetisch und mit der fortschreitenden Materialentwicklung innerhalb der Kunstmusik auch musiksprachlich immer weiter auseinander.
Die Auflösung musikalischer Universalität (welche die Musik der Wiener Klassik aufgrund ihrer Verbindung von „gelehrt“ und „popular“ und ihrer Beeinflussung durch Traditionen verschiedener Länder noch repräsentiert hatte) war im 19. Jh. weiters die Folge von Nationalisierung bzw. nationaler Identitätsbildung. Einige Beispiele für die konstitutive Rolle der I. in diesem Prozess lassen sich beibringen: Die deutsch-österreichische Musiktradition des 18. und 19. Jh.s erschien wesentlich als eine Tradition der I. Der weltweite Erfolg von J. Strauß leitete die klischeehafte Identifizierung Wienerischer oder österreichischer Musik mit dem Walzer ein. Die sog. Nationalschulen in jenen europäischen Ländern, die im Unterschied zu Italien und Frankreich keine lange zurückreichende, als selbständig geltende Kunstmusiktradition besaßen, orientierten sich paradoxerweise an der deutsch-österreichischen Musik und griffen (neben der Oper) die „neudeutsche“ Gattung der Symphonischen Dichtung auf, die sich für die Behandlung passender Sujets anbot (in Böhmen F. Smetana, Z. Fibich, A. Dvořák; in Ungarn M. Mosonyi [M. Brand], der sein Vorhaben der Begründung einer ungarischen Nationalmusik zunächst in Charakterstücken für Klavier zu realisieren suchte).
Die seit den 1860er Jahren bestimmende musikästhetische Auseinandersetzung im deutschen Sprachraum, jene zwischen Form- und Inhaltsästhetik (absoluter und Programmmusik resp. der Parteienstreit zwischen „Klassizisten“ [Klassizismus] und „Neudeutschen“) kreiste im Kern um die Frage, worin „das Geistige in der Musik“ bestünde, setzte also die anhand der I. vollzogene Aufwertung der Musik zur „geistfähigen“ Tonkunst voraus und bezog sich auf der Ebene der Gattungen („reine“ Symphonie und Kammermusik vs. symphonische Dichtung und Musikdrama, das Rich. Wagner als dialektische Aufhebung u. a. der Beethovenschen Symphonik verstanden wissen wollte) wesentlich auf I.
Weiterhin bildeten sich an der I., und zwar wiederum in erster Linie an jener der Wiener Klassik und dabei vorrangig den Symphonien, Quartetten und Klaviersonaten Beethovens, so zentrale musikästhetischen Kategorien wie Originalität und Werk (im emphatischen Sinn) aus. Der Werkbegriff wiederum stellte die Voraussetzung für zwei weitere bestimmende historische Tendenzen im 19. Jh. dar: zum einen das ebenfalls zunächst in der I. beobachtbare Auseinandertreten von Komposition und Interpretation (während die Oper noch länger den Charakter von Produktion beibehielt), was ebenfalls mit einer „Aufspaltung“ des Metiers einherging, d. h. den nicht oder kaum mehr komponierenden (Instrumental-)Virtuosen und bald auch Dirigenten und den am Instrument nicht (sonderlich) versierten Komponisten möglich machte; zum anderen die Konstituierung eines Kanons der österreichisch-deutschen Kunstmusik (der sich von Haydns Oratorien abgesehen v. a. um die I. der Wiener Klassik herum herauszukristallisieren begann, und in den z. B. auch J. S. Bach zunächst als Komponist von – in absolute Musik umgedeuteter – I. eingerückt wurde).
Bis in die 1. Hälfte des 20. Jh.s hinein behielt das Gattungssystem der Wiener Klassik jedenfalls den Grundzügen nach seine Verbindlichkeit. Als höchste und repräsentativste Gattung der autonomen instrumentalen Tonkunst wurde die Symphonie angesehen, was eine Übertragung von symphonischem Anspruch oder symphonischen Dimensionen auf andere, auch vokale Gattungen wie insbesondere das Oratorium, die Messe und spätestens seit Wagner die Oper mit sich brachte. Der sozusagen unvermeidbare Bezugspunkt, sei es als Ansporn oder als Hemmnis, als Modell, an das direkt anzuknüpfen wäre, oder als übermächtiges Erbe, das durch Orientierung an alternativen, z. B. älteren Konzeptionen von Haydn oder Mozart zu umgehen wäre, blieb das Werk Beethovens. Zum einen verlief die Geschichte der Symphonik im 19. Jh. infolgedessen „zirkumpolar“ (C. Dahlhaus), prägte also keinen linearen Entwicklungszug aus, in dem jede Stufe auf den integrierten Lösungen und Erfahrungen der vorangehenden beruhte, sondern brachte Werke hervor, die sämtlich auf das eine Zentrum, hingegen nicht notwendigerweise und nicht gleichmäßig aufeinander bezogen waren. Zum anderen lassen sich alle Typen und Derivate der Symphonie des 19. Jh.s auf Ansätze oder Vorbilder im Beethovenschen Œuvre zurückführen; die Programm- und die Chorsymphonie ebenso wie die Symphonische Dichtung, der die Überzeugung Wagners und F. Liszts zugrunde lag, in der Neunten Symphonie Beethovens wäre die Gattung zu einem mit absolut-instrumentalen Mitteln nicht überbietbaren Abschluss gekommen. Beethovens symphonische Konzeption wirkte während des 19. Jh.s ferner im „Willen zur großen Form“, in der Ausrichtung des zyklischen Ganzen auf eine Final-Apotheose bzw. der weitergehenden Verschränkung der Sätze, der Tendenz zur motivischen Vereinheitlichung usw. fort.
Kein Werk der österreichischen Symphonieproduktion zwischen Beethoven und Fr. Schubert auf der einen, J. Brahms und A. Bruckner auf der anderen Seite hat sich als fester Bestandteil des Repertoires etablieren können. Darauf, dass sich schon den Zeitgenossen nach 1827 der Eindruck einer Lücke aufdrängte, deutet der Wiener Symphonie-Wettbewerb von 1835 hin. Wie auch immer das Schaffen von F. Lachner, J. W. Kalliwoda, C. Czerny, K. Goldmark, R. Fuchs, L. Zellner oder J. Herbeck zu beurteilen sein mag, es kann von einer durchgängigen Symphonie-Tradition in der Habsburger-Monarchie gesprochen werden (was die in der jüngeren Forschung rege diskutierte These von einer angeblichen Krise der Symphonie zwischen ca. 1850 und 1870 zumindest relativiert). Den Höhe- und Endpunkt der Symphonik des 19. Jh.s stellt das Schaffen Bruckners und Mahlers dar. Die Symphonie, die im Zentrum des Lebenswerks beider Meister stand, erfuhr eine nochmalige Expansion und Monumentalisierung. Der äußeren Vergrößerung von Umfang und Besetzung (bei Mahler auch unter Heranziehung von Singstimmen) entspricht ein gesteigerter inhaltlicher Anspruch im Sinne eines bedeutungsgeladenen „Ideenkunstwerks“, der bei Mahler im Verständnis der Gattung als gleichsam musikalischer Welt-Erzählung oder -Deutung gipfelt. Bruckners und Mahlers Symphonien sind symptomatisch für einen – zumindest indirekt auch auf Wagner zu beziehenden – neuerlichen Einfluss des Vokalen auf die I. (vgl. die Verwendung von Charakteren oder Elementen wie Choral, Hymnus und Lied), der bei Mahler bis zur Überlagerung der Symphonie mit vokalen Gattungen (Orchesterlied und -kantate) führte.
Die symphonische Dichtung wird – von Goldmarks Ländlicher Hochzeit 1876 abgesehen – von den österreichischen Komponisten erst in der Generation H. Wolfs und Mahlers aufgegriffen und dann von A. Schönberg, S. v. Hausegger, E. N. v. Reznicek und A. v. Zemlinsky fortgeführt. Als eine klassizistische, teils historisierende Nebenströmung der Orchestermusik kann die in den 1860er Jahren einsetzende, relativ verbreitete Komposition von Serenaden oder Suiten betrachtet werden (Brahms, Lachner, R. Fuchs, Dvořák).
Die Gattung des Instrumentalkonzerts, zu der auf österreichischem Boden neben bzw. nach Beethoven am erfolgreichsten J. N. Hummel, I. Moscheles und Brahms beigetragen haben, bewegte sich im 19. Jh. im Spannungsfeld zwischen symphonischem Anspruch und der Absicht, die virtuose Entfaltung des solistischen Parts zu ermöglichen. Die Annäherung an den symphonischen Bereich erfolgt einerseits auf großformaler Ebene (durch den Übergang zur Viersätzigkeit, ansatzweise etwa schon bei Moscheles und schließlich bei Brahms, oder durch zyklische Integration bzw. Übernahme der „Mehrsätzigkeit in der Einsätzigkeit“ nach dem Modell der symphonischen Dichtung bei Liszt); andererseits wurde die Integration und Verwebung bzw. die gleichgewichtige Teilhabe von Solisten und Orchester an der formalen Entwicklung und dem thematischen Prozess angestrebt. Gegenüber der Vielfalt des 18. Jh.s dominierten als Soloinstrumente im 19. Jh. Klavier und Violine. Als Reflex auch der bau- und spieltechnischen Weiterentwicklung der Holzblasinstrumente kam es anfangs des Jh.s zu einer etwas reicheren Produktion von Konzerten insbesondere für Klarinette (z. B. F. Krommer).
Die Diversifizierungsprozesse erfassten im „Klavier spielenden“ 19. Jh. in besonderem Maße auch die Klaviermusik. Die zu Originalität und Individualisierung zwingende Vorbildwirkung Beethovens auch in diesem Gattungsbereich zog bei vielen Komponisten nach Schubert die Komposition von jeweils nur wenigen „großen“ Sonaten nach sich. Parallel dazu verlagerte sich das Interesse, beginnend bei W. J. Tomaschek, J. H. Vorisek und v. a. Schubert, auf Kleinformen, den stilisierten Tanzsatz (Deutscher, Walzer, Mazurka usw.) und das sog. lyrische Klavierstück (Ecloge, Impromptu, Nocturne, Moment musical usw.; dessen weitergehende Poetisierung bzw. Literarisierung in der Generation von R. Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy und Liszt war freilich ein spezifischer Ausfluss der deutschen Romantik). Das aufblühende Virtuosentum und die tragende Rolle des Klaviers für die Musikpflege im privaten Haus und im Salon verursachten ein umfangreiches Corpus an brillanter Klavierliteratur, eine geradezu unüberschaubare Menge an technisch mehr oder weniger schwierigen sentimentalen Klavierpiècen, an Arrangements, Bearbeitungen und Klavierauszügen von Werken aus allen Gattungsbereichen und eine reiche didaktische bzw. Etüdenliteratur (all dies vielfach in fließenden Übergängen zueinander und hin zum lyrischen Klavierstück).
Nicht minder wurde die Kammermusik vom sozialen und institutionellen Wandel des Musiklebens erfasst. Zwar konnte sich das anspruchsvolle „ernste“ Repertoire das ganze Jh. über in der privaten bzw. häuslichen Praxis der zunehmend bürgerlichen Amateure halten. Zugleich differenzierte sich aber ein professionelles Kammermusikwesen mit eigenen öffentlichen Konzertformen und spezialisierten Ensembles aus, allen voran Streichquartettformationen (in Österreich nach I. Schuppanzigh beginnend mit J. Hellmesberger). Komplementär dazu wurde der Bedarf an ästhetisch wie spieltechnisch einfacherer Hausmusik durch Originalkompositionen für kleinere Besetzungen (Duos, Trios, oft mit Klavier) unter Einschluss populärer Instrumente (wie der Flöte oder der Gitarre im Wien des Vormärz [Biedermeier]) und Arrangements von z. B. beliebten Opernnummern befriedigt.
Das von der Wiener Klassik geschaffene Gattungsgefüge blieb dem Prinzip nach während des 19. Jh.s aufrecht, insbesondere behauptete das Streichquartett seinen herausragenden Status. Dass die Produktion von Streichquartetten nach Schubert quantitativ zurückging (dafür Streichquintett und -sextett z. B. bei Brahms an Bedeutung gewannen), hatte einmal mehr mit dem durch Beethoven gesteigerten Gattungsanspruch zu tun. In der 1. Jh.hälfte entstand zwar noch ein relativ umfangreiches Korpus an Kammermusik mit Bläsern, auch in größerer Besetzung (Septette bis Nonette, z. B. bei Schubert); weiterhin wurde v. a. von A. Reicha der Versuch unternommen, das Bläserquintett an das artifizielle Niveau des Streichquartetts anzunähern. Insgesamt bildete die Bläserkammermusik jedoch ein heterogenes Feld ohne eigene ausgeprägte Gattungsstränge. In der Sonate für Klavier und Melodieinstrumente wurde deutlich die Violine bevorzugt, die viel selteneren Sonaten für Blasinstrumente entstanden zumeist mit Blick auf einen bestimmten Virtuosen (wie z. B. die Klarinettensonaten von Brahms). Innere wie äußere Gründe, ein auf mehr Volumen zielendes Klangideal, die akustischen Bedingungen der großen Konzertsäle und die tragende Funktion des Klaviers für das private Musizieren ließen im Laufe des 19. Jh.s die Klavierkammermusik immer stärker hervortreten.
In der Zeit um 1900 tendierten die Gattungsgrenzen zu einer gewissen Aufweichung. Parallel dazu wurde bei Komponisten wie Schönberg und Zemlinsky, die gleichermaßen an Brahms und an die Linie Wagner-Bruckner-Mahler anschlossen, der Parteiengegensatz zwischen Neudeutschen und Klassizisten aufgehoben. Es entstanden programmatische oder nach dem Vorbild der symphonischen Dichtung einsätzige Kammermusikwerke, umgekehrt wurden (im Anschluss an Mahler) kammermusikalische Instrumentations- und Kompositionsweisen auf die große Orchestermusik übertragen und im Typus der Kammersinfonie beide Bereiche synthetisiert; in der Kammermusik mit Singstimmen und im symphonischen Orchesterlied bzw. der Liedsymphonie begannen sich (ebenfalls nach dem Vorbild Mahlers) zudem vokale und instrumentale Gattungstraditionen zu überschneiden.
Für das 20. Jh. lassen sich einige allgemeine Grundlinien festhalten: So fand ein Prozess der permanenten Ausweitung des Instrumentariums und der instrumentalen Klangerzeugungsweisen (Klang) statt. Schon in den ersten Jahrzehnten wurden Instrumente auf der Basis elektrischer Klanggenerierung (Instrumente, elektroakustische) entwickelt, „emanzipierte“ sich das Schlagzeug, drangen Instrumente aus dem Bereich der Unterhaltungsmusik in die Kunstmusik ein (z. B. das Saxophon), kamen vor dem Hintergrund der Alte Musik-Bewegung historische Instrumente neu oder wieder verstärkt ins Spiel (wie Blockflöte, Cembalo oder auch die Orgel, die dann in der 2. Jh.hälfte z. B. bei G. Ligeti ür avancierte Konzeptionen herangezogen wurden). Auf traditionellen Instrumenten wurden neue klangliche und spieltechnische Möglichkeiten erkundet (beginnend mit der „Entdeckung“ des Klaviers als Schlaginstrument in der Zwischenkriegszeit; nach dem Zweiten Weltkrieg z. B. durch die sog. Präparierung). Ein Teilaspekt ist dabei das Interesse am Geräusch, das sich nach dem Vorgang Mahlers ansatzweise schon in der Wiener Schule zeigte (eine konzeptionell fundierte Geräusch- oder Maschinenmusik, wie sie die historischen Avantgarde-Bewegungen in Italien oder Russland hervorgebracht haben, gab es in Österreich jedoch nicht; Futurismus). Seit den 1950er Jahren werden mit dem Übergang zur elektronischen, elektroakustischen und schließlich Computermusik Instrumentalklänge technisch überformt oder verfremdet, können nicht-musikalische Klangquellen einbezogen und lässt sich Musik überhaupt nur mehr synthetisch herstellen, wodurch der traditionelle Begriff von I. eine extreme Weitung bzw. in letzter Konsequenz seine Auflösung erfährt. Indem sozusagen von der anderen Seite her Sprache oder Vokalklänge als entsemantisiertes Material verwendet, die überkommene gesangliche Stimmgebung aufgegeben oder vokale Äußerungen elektronisch bzw. technisch zugerichtet werden, verfließen zugleich die Grenzen zwischen I. und Vokalmusik schon auf der Materialebene. Zur „Entgrenzung“ von I. im herkömmlichen Sinn tragen ferner die Verbindung von Instrumentalspiel mit theatralischer oder szenischer Aktion, der Einsatz von Instrumenten im Performance-Bereich u. ä. bei.
Auch im Binnenbereich der I. kam es bereits in den 1920er Jahren zu einem massiven Umbruch, der das aus dem 18. und 19. Jh. stammende System übergreifender Stilbereiche (Kammer-, Orchester-, Konzertmusik) und das Gattungsgefüge weitgehend außer Kraft setzte. Die bewusst gesuchte Überwindung „romantischer“ Ästhetik und Klanglichkeit bedingte fürs erste die Abkehr vom opulenten, die Farben verschmelzenden Riesenorchester, von der Gattung der Monumentalsymphonie und von der Idee einer „Weltanschauungsmusik“. Neue Sachlichkeit und Neoklassizismus bevorzugten kleinere Apparate bzw. Gruppierungen von kontrastreichen, vom Ideal des Spaltklangs getragenen Kombinationen (wodurch u. a. kleine solistische Bläserbesetzungen erneut an Aktualität gewannen). Das Verschwimmen der Grenze zwischen Kammermusik und Nicht-Kammermusik manifestierte sich u. a. im neuen Typus der Kammersinfonie und griff dann auch auf das Konzert über (z. B. bei Alban Berg 1925 und A. Webern 1931/34). In der Neuen Musik nach 1945 wurde schließlich die Besetzung wie der Umgang mit dem Instrument in Abhängigkeit von der jeweiligen kompositorischen Idee vollends zur Disposition gestellt.
Die Geschichte der I. im 20. Jh. ließe sich weiterhin unter dem Aspekt der konkreten Interdependenz von kompositorischem Konzept oder Kompositionstechnik und instrumentalem Medium betrachten. So wurde etwa von Schönberg die neu entwickelte Dodekaphonie [Zwölftontechniken] , die das Problem lösen sollte, wie unter der Bedingung von Atonalität mit rein musikalischen Mitteln ein „logisch“ zusammenhängender und zugleich ausgedehnter musikalischer Verlauf zu gewinnen wäre, konsequenterweise zunächst in einer Reihe von Werken der absoluten I. (ab op. 23). erprobt. Das Programm einer radikalen Reinigung der Musik von allen Resten der Tradition im Serialismus (Serielle Musik) der 1950er Jahre dürfte (neben kompositions- und aufführungspraktischen Gründen) ein Faktor für die auffällige Bevorzugung des am ehesten noch als „neutral“ geltenden Klaviers gewesen sein. Diese Programmatik, die extrem verkomplizierten Verhältnisse bzw. Abstufungen von Tondauern und Dynamik, sowie die Aussicht, auch die Klangfarbe einer rationaler Reihendisposition unterziehen zu können, legten dann den Schritt des Serialismus hin zur elektronischen Musik nahe. Weiterhin regten z. B. Mikrotonalität bzw. Ekmelik den Bau spezieller Instrumente an oder favorisierten aus leicht einzusehendem Grund Streicherbesetzungen oder war die Klangflächenkomposition bzw. „Mikropolyphonie“ an einen entsprechend reichen Orchesterapparat gebunden (Ligeti, F. Cerha).
Es gehört zur viel beschworenen „Pluralität“ der Musik im 20. Jh., dass neben und in den dezidiert neuen oder avancierten Ansätzen die Tradition auf je individuelle Weise weiterwirkte bzw. als Anknüpfungspunkt zur Verfügung stand. Auffällig ist zum einen das Ausmaß, mit dem auch in Österreich bis in die Gegenwart auf das Streichquartett – freilich unter höchst differenzierten Voraussetzungen und in ganz verschiedenen Zugängen – zurückgegriffen wird (Beispiele sind neben vielen anderen Cerha, I. Eröd, G. F. Haas, R. Haubenstock-Ramati, G. Kahowez, P. Kont, G. Kühr, Ligeti, Ch. Ofenbauer, E. Urbanner). Zum anderen ist bis nach dem Zweiten Weltkrieg eine kontinuierliche und ausgedehnte Symphonie-Produktion österreichischer Komponisten festzustellen, wenn auch in diversen Spielarten, stilistischen Ausprägungen, mit Unterschieden je nach Generationszugehörigkeit oder biographischen Bedingungen (F. Schmidt, H. Gál, E. Wellesz, K. Weigl, E. Toch, E. Krenek, J. N. David, M. Rubin, K. Schiske).
Literatur
MGG 4 (1996) [Instrumentalmusik, Kammermusik], 9 (1998) [Symphonie]; MGÖ 1–3 (1995). – Bis 1700: S. Zak, Musik als „Ehr und Zier“ im mittelalterlichen Reich 1979; W. Salmen, Der Spielmann im Mittelalter 1983; Ch. Page in R. Crocker/D. Hiley (Hg.), The Early Middle Ages to 1300, 1990; K. Polk, German Instrumental Music of the Late Middle Ages 1992; W. Salmen (Hg.), Musik und Tanz zur Zeit Kaiser Maximilians I. 1992; A. Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 1 (1997); A. Brinzing, Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16. Jh.s, 2 Bde. 1998; L. L. Perkins, Music in the Age of the Renaissance 1999; Th. Antonicek et al. (Hg.), Die Wiener Hofmusikkapelle 1 (1999); H. Mayer Brown/K. Polk in R. Strohm/B. J. Blackburn (Hg.), Music as Concept and Practice in the Late Middle Ages 2001. – Ab 1700: W. Kirkendale, Fuge und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der Klassik 1966; L. Finscher, Die Entstehung des klassischen Streichquartetts von den Vorformen zur Grundlegung durch Joseph Haydn 1974; J. Webster in JAMS 27 (1974); C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik 1978; H. Danuser, Die Musik des 20. Jh.s 1984; R. Stephan in C. Dahlhaus (Hg.), Die Musik der fünfziger Jahre 1985; St. Kunze, Die Sinfonie im 18. Jahrhundert 1993; R. L. Marshall (Hg.), Eighteenth-Century Keyboard Music 1994; D. Heartz, Haydn, Mozart and the Viennese School. 1740–1780, 1995; C. Ottner (Hg.), [Kgr.-Ber.] Kammermusik zwischen den Weltkriegen Wien 1994, 1995; M. E. Bonds in JAMS 50 (1997); F. Krummacher, Das Streichquartett. Teil 1: Von Haydn bis Schubert 2001; W. Steinbeck/Ch. v. Blumröder, Die Symphonie im 19. und 20. Jh. Teil 2: Stationen der Symphonik seit 1900, 2002.
MGG 4 (1996) [Instrumentalmusik, Kammermusik], 9 (1998) [Symphonie]; MGÖ 1–3 (1995). – Bis 1700: S. Zak, Musik als „Ehr und Zier“ im mittelalterlichen Reich 1979; W. Salmen, Der Spielmann im Mittelalter 1983; Ch. Page in R. Crocker/D. Hiley (Hg.), The Early Middle Ages to 1300, 1990; K. Polk, German Instrumental Music of the Late Middle Ages 1992; W. Salmen (Hg.), Musik und Tanz zur Zeit Kaiser Maximilians I. 1992; A. Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 1 (1997); A. Brinzing, Studien zur instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16. Jh.s, 2 Bde. 1998; L. L. Perkins, Music in the Age of the Renaissance 1999; Th. Antonicek et al. (Hg.), Die Wiener Hofmusikkapelle 1 (1999); H. Mayer Brown/K. Polk in R. Strohm/B. J. Blackburn (Hg.), Music as Concept and Practice in the Late Middle Ages 2001. – Ab 1700: W. Kirkendale, Fuge und Fugato in der Kammermusik des Rokoko und der Klassik 1966; L. Finscher, Die Entstehung des klassischen Streichquartetts von den Vorformen zur Grundlegung durch Joseph Haydn 1974; J. Webster in JAMS 27 (1974); C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik 1978; H. Danuser, Die Musik des 20. Jh.s 1984; R. Stephan in C. Dahlhaus (Hg.), Die Musik der fünfziger Jahre 1985; St. Kunze, Die Sinfonie im 18. Jahrhundert 1993; R. L. Marshall (Hg.), Eighteenth-Century Keyboard Music 1994; D. Heartz, Haydn, Mozart and the Viennese School. 1740–1780, 1995; C. Ottner (Hg.), [Kgr.-Ber.] Kammermusik zwischen den Weltkriegen Wien 1994, 1995; M. E. Bonds in JAMS 50 (1997); F. Krummacher, Das Streichquartett. Teil 1: Von Haydn bis Schubert 2001; W. Steinbeck/Ch. v. Blumröder, Die Symphonie im 19. und 20. Jh. Teil 2: Stationen der Symphonik seit 1900, 2002.
Autor*innen
Markus Grassl
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Markus Grassl,
Art. „Instrumentalmusik‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d299
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.