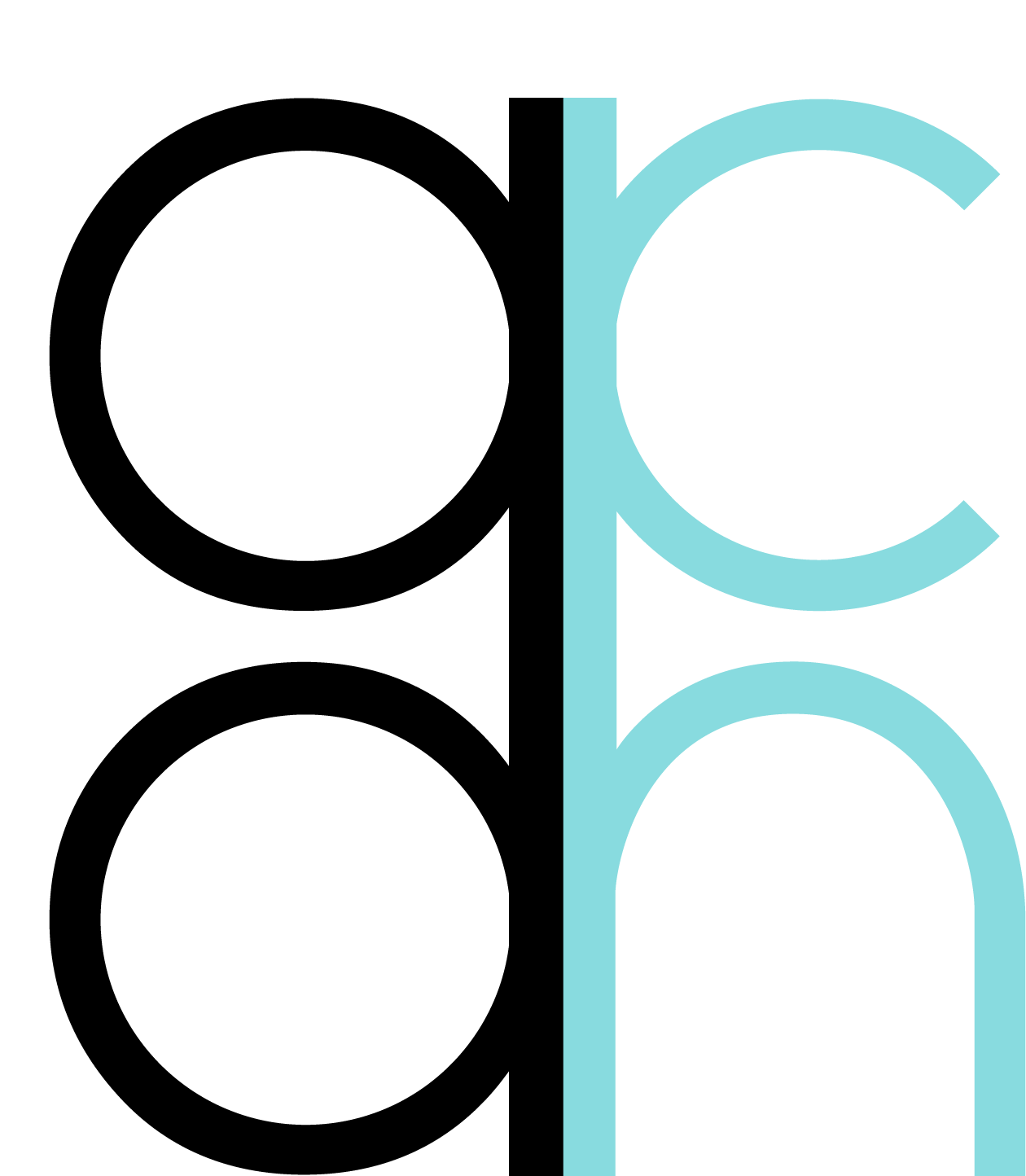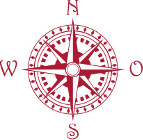Oboe
Konisch gebohrtes Doppelrohrblatt-Instrument in Diskantlage, im letzten Drittel des 17. Jh.s im Umkreis des französischen Hofes, vermutlich von den Musiker- und Instrumentenbauerfamilien Hotetterre und Philidor durch Umformung des späten Schalmeientyps entwickelt. Eine eindeutige Abgrenzung ist schwer möglich, weil sowohl Schalmeien als auch O.n nicht nur in französischen, sondern auch in deutschsprachigen Quellen weitgehend einheitlich als „hautbois“ bezeichnet werden. Wohl aus bohrungstechnischen Gründen und wegen der leichter zu handhabenden Stimmbarkeit wurden O.n nicht mehr wie ihre Vorgängerinstrumente aus einem Stück, sondern aus drei Teilen – Kopf- bzw. Oberstück, Mittelstück und Stürze bzw. Unterstück – gebaut. Ebenso wurde die Stimmtonhöhe und somit die Gesamtlänge des Instruments verändert. Sind Pommern, Schalmeien und Deutsche Schalmeien des 16. bis frühen 18. Jh.s im Chor- (bzw. Cornett-)Ton gestimmt, so stehen barocke O.n, von seltenen Ausnahmen abgesehen, im Kammerton (Stimmton).Der bislang früheste bekannte Beleg zur Verwendung der dreiteiligen barocken O. in Österreich stammt aus dem Stift Kremsmünster. Die frühesten Hinweise für den Einsatz der neuen „französischen“ Holzblasinstrumente am Wiener Hof stammen ebenfalls aus dem letzten Jahrzehnt des 17. Jh.s. Sind mit den beiden „Hautbois“ in der Partitur von H. I. F. Bibers Missa Salisburgensis von 1682 mit größter Wahrscheinlichkeit Deutsche Schalmeien gemeint, so scheint Biber in seinem späten Alleluia. Tres reges de Saba veniunt mit „Hobois“ bereits die neuen barocken O.n zu bezeichnen.
Ebenso im frühen 18. Jh. entstanden aus der infanteristischen Militärmusik, die neben den obligaten Pfeifen und Trommeln (Tambours) auch mit Schalmeien (ab ca. 1680 meist „Deutsche Schalmeien“; siehe erhaltene Instrumente im Oberösterreichischen Landesmuseum, Linz, und im Museum Carolino Augusteum, Salzburg) und Dulzianen besetzt sein konnte, die ersten „Hautboisten-Banden“ mit den aus der Kunstmusik entlehnten O.n und Fagotten, die bald durch zwei Hörner erweitert wurden. In Österreich waren diese „Banden“ im Unterschied zu den Truppen deutscher Fürsten noch nicht zwingend bei den Regimentern eingeplant, sondern Privatsache des jeweiligen Regimentsinhabers und unterlagen deshalb in Hinsicht der Besetzungsstärke und Beschäftigung seinem Ermessen.
In zahlreichen Werken von J. J. Fux und seiner Zeitgenossen wie A. Caldara, G. Bononcini, B. A. Aufschnaiter u. a. werden die fast immer paarweise eingesetzten O.n zusammen mit dem Fagott als Concertino-Gruppe mit kleinen solistischen Aufgaben betraut. Hauptaufgabe blieb aber bis etwa zur Jh.mitte, begünstigt durch die deutliche Grundtönigkeit der barocken Instrumente und der damit verbundenen hohen Verschmelzbarkeit, das Colla-parte-Spiel mit den Streichern. Erst die engere „klassische“ Mensur nach 1760/70 und der damit verbundene hellere Klang sowie die Erweiterung des Tonumfangs in der Höhe ließen die O. zur Zeit der Wiener Klassik zu einem beliebten Soloinstrument werden. Innerhalb der Orchesterliteratur spielen nun die paarweise besetzten O.n, die – mittlerweile vom Streichersatz emanzipiert – eigenständige Solopassagen sowie sehr oft auch lang auszuhaltende Akkordtöne zugeteilt bekommen, meist gemeinsam mit den ebenso doppelt besetzten Hörnern eine zentrale Rolle im Bläsersatz. Einen besonders hohen Stellenwert erlangten die O.n in der klassischen Harmoniemusik, wo sie z. T. allein, z. T. zusammen bzw. alternierend mit den Klarinetten die exponierten hohen Stimmen zu übernehmen haben. Bedeutende Harmoniemusik-Komponisten wie J. Wenth oder J. Triebensee waren selbst Oboisten, die ihr Instrument oft bis an die Grenzen des spieltechnisch Möglichen einsetzten.
Von den zahlreichen Werken für Solo-O. sind besonders zu nennen: W. A. Mozart, O.n-Konzert in C-Dur, KV 271k, Quartett für O. und Streicher, KV 370 (368b), Sinfonia concertante KV 297B (= Anh. 9); J. Haydn, Sinfonia concertante für V., Vc., O., Fg. und Orch. in B-Dur, Hob. I:105. Das unter Haydns Namen überlieferte O.n-Konzert in C-Dur, Hob. VIIg:C1 dürfte von I. Malzat stammen, von dem auch ein Doppelkonzert für O., Fg. und Orch. in C-Dur erhalten geblieben ist. L. v. Beethovens O.n-Konzert in F-Dur (vermutlich 1792 komponiert) ist leider verschollen. Weitere Solokonzerte stammen von den z. T. O. spielenden Komponisten J. A. A. Bachschmidt, C. Ditters v. Dittersdorf, G. Druschetzky, J. Fiala, F. Krommer, L. Kozeluch, J. B. Vanhal u. a. Im weiteren Verlauf des 19. Jh.s verlor die O. (nicht nur) in Österreich als Solo-Instrument an Bedeutung. Aus dem späteren 19. Jh. wäre als herausragendes Werk H. v. Herzogenbergs Trio für O., Hr. und Kl. in D-Dur, op. 61 (1889) zu nennen. Im 20. Jh. entstand eine Reihe von bedeutenden Kompositionen für O., z. B. von E. Wellesz (Suite, op. 76 für O. solo, 1956), E. Krenek (Sonatine für O. solo, 1956 und 4 Stücke für O. und Kl., 1966), J. Takács (Sonata missoulana für O. und Kl., 1958), G. Ligeti (Doppelkonzert für Fl. und O., 1972), A. Dobrowolski (Musik für O. und Orch., 1985) und G. v. Einem (Aspekte, Vier Porträts für O. solo, op. 102, 1993).
Spätestens ab der 2. Hälfte des 18. Jh.s entwickelte sich ein reger O.n-Werkstättenbetrieb v. a. in Wien (18. Jh.: Mathias Rockobaur [R. Baur], M. Lempp, F. Hammig; 19. Jh.: St. Koch, W. Küss, Martin Schemmel, J. T. und Jak. Uhlmann, J. Ziegler) und Graz (Heinrich Schweffer). Waren die Holzblasinstrumente des 18. und beginnenden 19. Jh.s aus verschiedenen Regionen noch weitgehend austauschbar, so bildeten sich in den bedeutendsten Zentren des Instrumentenbaus (z. B. Dresden/D, Paris, Wien) um und nach 1820 regelrechte Klanginseln heraus. Das Bestreben, den neuen Anforderungen v. a. in Bezug auf Lautstärke und klangliche Ausgewogenheit in allen Tonarten gerecht zu werden, führte europaweit zu einer großen Vielfalt an Neuerungen, aber auch Fehlentwicklungen im Instrumentenbau. In Wien gelang es, die Lautstärke der Holzblasinstrumente zu erhöhen, ohne den warmen Klang aufgeben zu müssen. Bewerkstelligt wurde dies zum einen durch spezielle Ausformungen der Schallstücke – so haben O.n der Wiener Instrumentenbauer fast immer eine ungewöhnliche Ausbeulung der Becher – und zum anderen durch eine besondere Klappenausstattung, welche eine Reihe von Alternativgriffen ermöglichte, die den Ton tragfähiger, obertonreicher und flexibler machten.
Die rasche Ausformung eines eigene Wege beschreitenden Wiener Blasinstrumentenbaus ließ auch bald den Ruf nach neueren und eigenständigen Lehrwerken an den Schulen der Musikvereine, die ab 1819 (Graz) bzw. 1821 (Wien) O.n-Klassen führten, laut werden. J. Sellner, der erste Lehrer für O. am Wiener Konservatorium, ließ bereits 1825 seine Theoretisch praktische O. Schule drucken (s. Abb., Detail der Grifftabelle).
Sellners O.n-Schule ist ganz auf die dreizehnklappige O. eingerichtet, die er selbst in der Zeit um 1820 bis 1825 in Zusammenarbeit mit St. Koch sen. entwickelt hat und die als Urbild der „deutschen O.“ des 19. Jh.s gelten kann. J. Fahrbach veröffentlichte seine Nuovissimo Metodo per O., op. 27 1843 in Mailand.
Die O. des Koch-Sellner-Typs hielt sich im Orchester der Hofoper und der Wiener Philharmoniker bis ins späte 19. Jh. Eine Wende zeichnete sich ab, als 1880 der Dresdner Oboist R. Baumgärtl nach überlegen gewonnenem Probespiel die Nachfolge des bekannten Musikers und Lehrers Carl Pöck im Hofopern-Orchester antrat. Im Vergleich mit den O.n seiner Orchesterkollegen war Baumgärtls Instrument zu hoch, ein Umstand, der durch die Beschlüsse der Internationalen Stimmton-Conferenz in Wien (1885), die eine Absenkung des Stimmtones um sechs Hertz forderten, noch verstärkt wurde. Um die Intonationsschwierigkeiten in den Griff zu bekommen, ohne sein vertrautes Instrumentenmodell aufgeben zu müssen, ließ Baumgärtl um 1890, basierend auf seiner O. des Dresdner Instrumentenbauers Carl Theodor Golde (1803–73), vom Holzblasinstrumentenbauer J. Hajek jenen O.n-Typ entwickeln, der später unter der Bezeichnung „Wiener O.“ bekannt wurde und noch heute in den großen Wiener Orchestern gespielt wird. Nach Hajeks Tod wurden Wiener O.n von Hermann Zuleger und Hubert Schück hergestellt. Heute liefern diese Instrumente die Firmen Yamaha (Japan), Christian Rauch (Innsbruck) und Guntram Wolf (Kronach/D). Bedeutende Musiker- und Lehrerpersönlichkeiten in der Nachfolge Baumgärtls, die oft durch ihre Zusammenarbeit mit Instrumentenbauern auch maßgeblichen Anteil an der Weiterentwicklung der Wiener O. haben, waren und sind A. Wunderer, Hans Kamesch, Hans Hadamovsky (O.n-Schule, Wien 1973), Jürg Schäftlein (1929–86), der als Mitglied von N. Harnoncourts 1953 gegründetem Concentus musicus zu den Pionieren der Barock-O.n-Renaissance des 20. Jh.s zählt, Manfred Kautzky, Gerhard Turetschek u. a.
Die Wiener O. wird heute (2004) nur in den großen Wiener Orchestern, wo sie ihres obertonreichen Klanges wegen der Holzbläsergruppe eine spezifische Farbe verleiht, gespielt und an der Universität für Musik und darstellende Kunst Kunst in Wien sowie an den Konservatorien der Stadt Wien (Musiklehranstalten Wien), in Wiener Neustadt und Eisenstadt gelehrt. Ansonsten wird in Österreich, wie auch weltweit, die französische O., das so genannte „Conservatoire“-Modell, welches in ihrer heutigen Form und Mechanik auf die Arbeit von Frédéric Triébert und Apollon-Marie-Rose Barret (Paris) in den 1860/70er Jahren zurückgeht, verwendet.
O.n im Chor- (bzw. Cornett-)Ton waren in der 1. Hälfte des 18. Jh.s in manchen österreichischen Klöstern, wo sie wohl mit den hoch gestimmten Orgeln gemeinsam in der Kirchenmusik verwendet wurden, gebräuchlich. Dies belegen u. a. mehrere Rechnungen aus den Jahren 1707–10 für O.n bzw. O.n-Rohre im Cornett-Ton aus Kremsmünster oder das aus dem aufgelassenen Stift Rottenmann stammende Notenmaterial eines Complementoriums von Josef August Pichler (ca. 1697–1762), welches einen Part für „Hautbois francese“ bzw. alternierend für „Hautbois Cornet“ enthält (Diözesanarchiv Graz, Bestand Bad Aussee, Ms 147).
Obwohl die Landesmuseen von Graz, Linz und Salzburg eine Reihe von frühen Tenor-O.n besitzen, ist deren musikalischer Einsatz vor 1750 in Österreich nur vereinzelt nachzuweisen. 1736 schreibt C. H. v. Biber für eine seiner Salzburger Kirchensonaten zwei „Obue bahse“ vor, die entweder im Kammerton gestimmte Alt-O.n in A oder im Chorton stehende Deutsche Schalmeien in G – drei derartige Instrumente aus dem beginnenden 18. Jh. verwahrt das Museum Carolino Augusteum in Salzburg – sein können. Als „Talijs“ (Taillen) bezeichnet begegnen uns F-O.n in der Arietta vernacula de B. M. V. „Ach wie schön seynd doch die Sterne“ von S. Höpflinger aus dem Stift Admont (Diözesanarchiv Graz, Ms 261). Das Englischhorn (Corno anglese, Cor anglais u. a.), eine F-O., die wie die deutsche O. da caccia zunächst in gebogener bzw. gewinkelter Form, aber mit einem „Liebesfuß“ ausgestattet, hergestellt wurde, ist seit der Wiener Aufführung von N. Jommellis Ezio 1749 in Österreich bekannt. Ch. W. Gluck setzte es erstmals in La danza (Wien, 1755) ein. Zu den bekanntesten Werken mit zwei Englischhörnern zählt J. Haydns Sinfonie Hob. I:22 („Der Philosoph“, 1764) und das Stabat mater Hob. XXbis (1767). In einigen Harmoniemusikwerken von C. Ditters v. Dittersdorf, G. Druschetzky, A. Salieri, G. Ch. Wagenseil, J. Wenth u. a., die für die in Wittingau (Třeboń/CZ) und Wien stationierte Schwarzenberg’sche Kapelle komponiert bzw. eingerichtet wurden, nehmen zwei Englischhörner die Rolle der sonst üblichen Klarinetten ein. Im letzten Jahrzehnt des 18. Jh.s fanden sich in Wien die O. spielenden Brüder J., F. und Ph. Teimer zu einem Trio in der Besetzung zwei O.n und Englischhorn zusammen. L. v. Beethoven (Trio in C, op. 87; Variationen über „Là ci darem la mano“ aus Mozarts Don Giovanni, WoO 28), F. Krommer, F. A. Poessinger, J. Triebensee, J. Wenth, A. Wranitzky u. a. schrieben Stücke für diese Besetzung. Einzeln besetzt begegnet uns das Englischhorn z. B. in Kammermusikwerken von M. Haydn (Quartett für Englischhorn, V., Vc. und Kb. in C-Dur MH 600) und W. A. Mozart (Adagio für Englischhorn und Streichtrio [?] KV 580a; Fragment) sowie als Soloinstrument in einem Konzert in Es-Dur von J. Fiala. Ein erstaunlich spätes Beispiel für die sonst in Österreich wenig verbreitete O. d’amore, eine Alt-O. in A mit „Liebesfuß“, ist C. Ditters v. Dittersdorfs Konzert in A-Dur (Lane 43ab). O.n in B, als „O. grande“ bezeichnet, wurden von den Wiener Oboisten und Komponisten J. Triebensee und J. Wenth in Bläserstücken verwendet.
Literatur
Kellner 1956; K. Birsak, Die Holzblasinstrumente im Salzburger Museum Carolino Augusteum 1973, 19–65; G. Joppig, O. & Fagott. Ihre Gesch., ihre Nebeninstrumente und ihre Musik 1981; M. Nagy in Das Orchester 34/2 (1986); G. Joppig in B. Habla (Hg.), [Kgr.-Ber.] Johann Joseph Fux und die barocke Bläsertradition. Graz 1985, 1987; M. Nagy in W. H. Sallagar/M. Nagy, [Fs.] K. Öhlberger 1992, 142; M. Nagy in O. Biba/W. Schuster (Hg.), [Kgr.-Ber.] Klang und Komponist. Ein Symposion der Wr. Philharmoniker. Wien 1990, 1992, 268; W. Waterhouse, The New Langwill Index 1993; Ph. T. Young, Die Holzblasinstrumente im Oberösterr. Landesmuseum 1994; M. Wolf in M. Nagy (Hg.), [Fs.] J. Mertin 1994; MGG 7 (1997); Hopfner 1999; B. Haynes, The eloquent O. A History of the Hautboy 1640–1760, 2001; K. Hubmann in B. Boisits/K. Hubmann (Hg.), [Kgr.-Ber.] Musizierpraxis im Biedermeier. Graz 2001, 2004.
Kellner 1956; K. Birsak, Die Holzblasinstrumente im Salzburger Museum Carolino Augusteum 1973, 19–65; G. Joppig, O. & Fagott. Ihre Gesch., ihre Nebeninstrumente und ihre Musik 1981; M. Nagy in Das Orchester 34/2 (1986); G. Joppig in B. Habla (Hg.), [Kgr.-Ber.] Johann Joseph Fux und die barocke Bläsertradition. Graz 1985, 1987; M. Nagy in W. H. Sallagar/M. Nagy, [Fs.] K. Öhlberger 1992, 142; M. Nagy in O. Biba/W. Schuster (Hg.), [Kgr.-Ber.] Klang und Komponist. Ein Symposion der Wr. Philharmoniker. Wien 1990, 1992, 268; W. Waterhouse, The New Langwill Index 1993; Ph. T. Young, Die Holzblasinstrumente im Oberösterr. Landesmuseum 1994; M. Wolf in M. Nagy (Hg.), [Fs.] J. Mertin 1994; MGG 7 (1997); Hopfner 1999; B. Haynes, The eloquent O. A History of the Hautboy 1640–1760, 2001; K. Hubmann in B. Boisits/K. Hubmann (Hg.), [Kgr.-Ber.] Musizierpraxis im Biedermeier. Graz 2001, 2004.
Autor*innen
Klaus Hubmann
Letzte inhaltliche Änderung
30.6.2004
Empfohlene Zitierweise
Klaus Hubmann,
Art. „Oboe‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
30.6.2004, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001db9d
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.