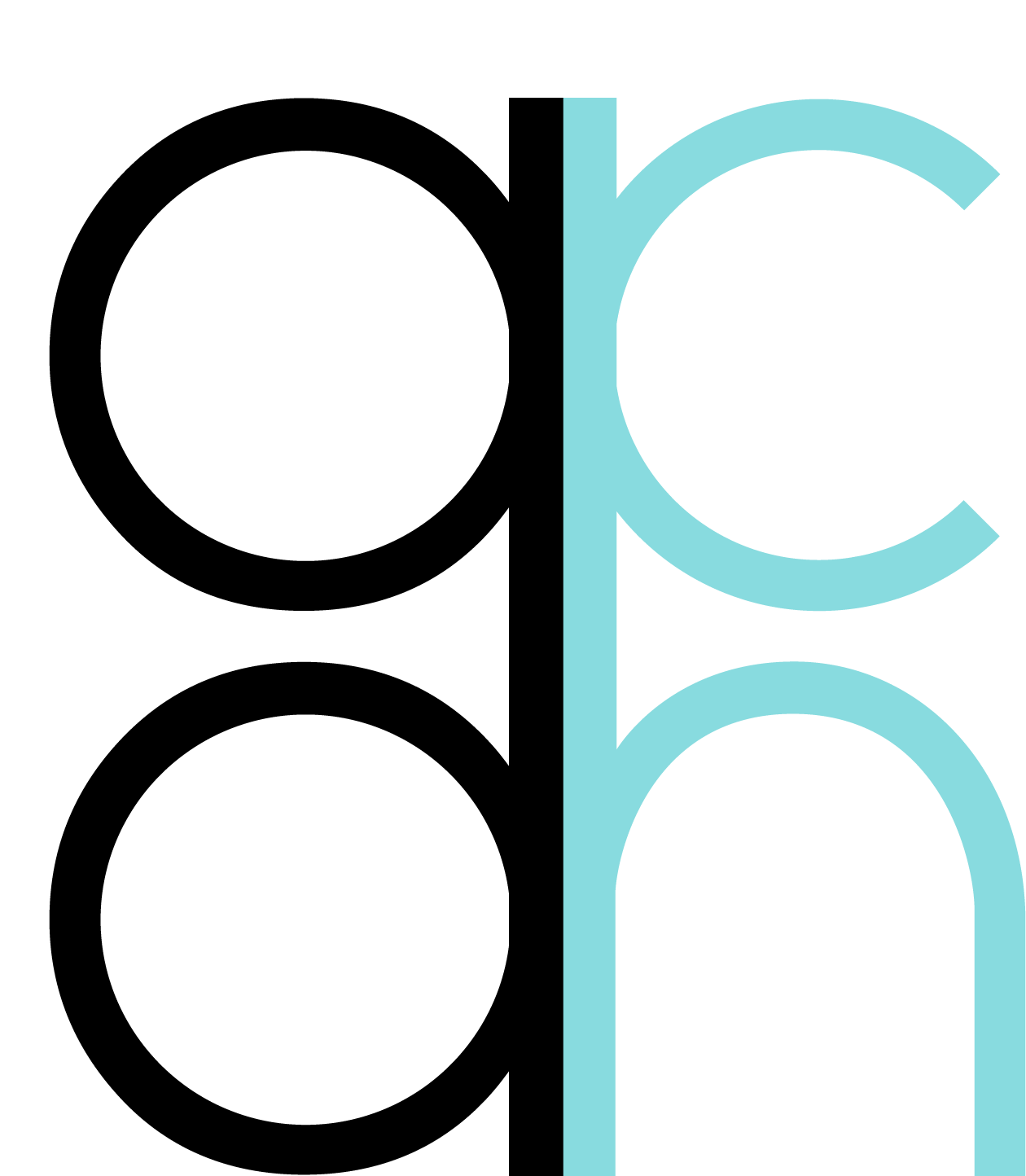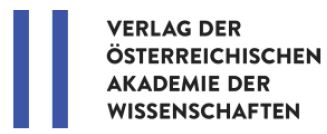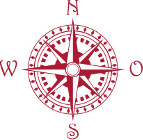Czerwenka
(Czervenka), Familie
Franz
(I):
* 14.10.1745 Benatek/Böhmen (Benátky nad Jizerou/CZ),
† 27.4.1801 Josefstadt (Wien VIII).
Fagottist.
Über seine frühen Jahre ist kaum etwas Gesichertes bekannt. Er könnte in Prag ausgebildet worden sein, im Frühjahr 1780 (Geburt eines Sohnes am 16.5.1780) ist er als „Musicus“ in Pressburg nachweisbar. Vom Frühjahr bis zum September 1781 gehörte er der Kapelle von Kraft Ernst Fürst Oettingen-Wallerstein bei Augsburg/D an. Von da ging er neuerlich nach Pressburg (Geburt einer Tochter am 8.7.1782) und wurde Mitglied der Hofkapelle von Joseph Fürst Batthyány; von dort trat er 1783 in die Dienste von N. Fürst Esterházy. Am fürstlichen Hof in Eisenstadt und Eszterháza spielte er auch Violine (wie schon zuvor in Pressburg). Beim Tod des Fürsten 1790 zunächst gekündigt, wurde F. C. noch im selben Jahr in der Harmoniemusik von A. Fürst Esterházy neu angestellt, der er bis 1793 angehörte. Ab 1791 spielte er in den Orchestern des Kärntnertor- bzw. Burgtheaters, 1793 wurde er als Nachfolger von Wenzel Kauzner, den er bereits seit 1792 vertreten hatte, Mitglied der Hofmusikkapelle und spielte in der Folge auch in der kaiserlichen Harmoniemusik. Ab 1797 war er Mitglied der Tonkünstler-Sozietät.
Sein Bruder
Joseph Johannes:* 6.9.1759 Benatek, † 23.6.1835 Josefstadt. Oboist. Schüler von Johann Stiasny d. Ä. in Prag; ab 1779 spielte er unter C. Ditters v. Dittersdorf in der Kapelle des Fürstbischofs von Breslau (Wrocław/PL), Philipp Gotthard Graf Schaffgotsch, in Schlesien. 1784–94 gehörte er wie sein Bruder F. C. der Kapelle der Fürsten Esterházy an. Ab 1791 war C. als Substitut für das Orchester des Kärntnertortheaters tätig, in das er 1794 als 2. Oboist aufgenommen wurde; weitere Ausbildung während dieser Zeit bei J. G. Triebensee. Gleichzeitig trat er in die Kapelle des Fürsten Schwarzenberg ein; bereits 1793 war er Mitglied der Tonkünstler-Sozietät geworden. 1796 folgte C. Joh. Teimer als 1. Oboist am Kärntnertortheater nach, 1801 J. N. Went als 2. Oboist am Burgtheater und in der Hofmusikkapelle; ab 1807 Mitglied der neu errichteten kaiserlichen Harmoniemusik. Vermutlich ab 1810 wieder am Kärntertortheater (nunmehr Hofoperntheater) tätig, wo er 1822 pensioniert wurde. Zuletzt spielte er nur mehr in der Hofmusikkapelle (Nachfolger: J. Sellner). 1813 wird er im Rahmen einer Konzertbesprechung als Klarinettist genannt.
Franz’ (I) Söhne
Wenzl (Wenzeslaus): * ca. 1777 (Ort?), † 1839 St. Petersburg/RUS. Oboist. Er war vermutlich ab 1791 Schüler von J. J. Beer, mit dem er über Riga nach St. Petersburg reiste. Beim Tod des Vaters 1801 und der Mutter 1812 wird er als Kammermusiker am Zarenhof in St. Petersburg bezeichnet. 1808 gehörte er dem Vorsteherkollegium der Philharmonischen Gesellschaft in St. Petersburg an. Von dort wechselte er 1813 in die königliche schwedische Hofkapelle, 1819 soll er nach St. Petersburg zurückgekehrt sein. Die Abgrenzung seiner Biographie zu seinem Bruder Franz (II) ist an manchen Stellen schwierig.
Franz: (II; Franciscus Josephus): * 7.8.1788 Schüttern (Süttör)/Ungarn (Fertöd/H), † nach 1824 [1827?] (Ort?) [St. Petersburg?]. Oboist. Taufkind seines Onkels J. C. Dürfte bereits 1803–06 in Pressburg gewesen sein und lebte um 1812 als Hofmusiker in Russland. 1812–17 hielt er sich, gemeinsam mit dem deutsch-russischen Komponisten Ludwig Maurer (1789–1878), im Gefolge eines russischen Adeligen namens Wsewoloschski am Rande Sibiriens auf, 1818 kehrte er über Moskau nach St. Petersburg zurück. Vor 1817 trat er in Kiew als Solooboist auf. 1819 konzertierte C. in Deutschland (Berlin, Frankfurt am Main, Königsberg [Kaliningrad/RUS]) und Amsterdam, 1820 in Paris und Wien, wo er jeweils mit Werken von Maurer erfolgreich war. Während dieser Zeit soll er weiterhin in Diensten des Fürsten Wsewoloschski in St. Petersburg gestanden sein, wird aber auch als Mitglied der kaiserlichen russischen Kapelle bezeichnet. 1819 empfahl ihn L. Spohr an N. Simrock in Bonn/D und bezeichnete ihn als einen „der vorzüglichsten jetzt lebenden Oboisten“.
In der älteren Literatur wird ein 1762 geborener Theodor C. als weiterer Bruder von Franz (I) C. angegeben, das Taufbuch der Pfarre Benatek verzeichnet jedoch keinen Th. C. Ein Th. C. war aber jedenfalls 1795–99 Mitglied der preußischen Hofmusikkapelle in Berlin. Bei der Angabe, dass er 1827 in St. Petersburg starb, könnte eine Verwechslung mit Franz C. (II) vorliegen.
Ein (weiterer?) Bruder von Franz (I) C. soll um 1803 in Brünn gelebt haben. Gesichert ist, dass ein Oboist namens C. Mitglied der dortigen, 1804 gegründeten Musikalischen Akademie (ab 1808: Philharmonische Gesellschaft) war.
Ein Josef C. war um 1820–44 Domorganist und 1820 auch provisorischer Domkapellmeister in Olmütz. Bereits ca. 1795 ist ein Johann C. als Domorganist zu Olmütz belegt.
Literatur
Th. Albrecht in Wr. Oboen-Journal 35 (Oktober 2007), 36 (Dezember 2007), 37 (März 2008) u. 38 (Juni 2008); K. Lamkin, Esterházy Musicians 1790 to 1809, 2007; U. Tank, Studien zur Esterházyschen Hofmusik von etwa 1620 bis 1790, 1981, 430f u. 434f; H. Ch. R. Landon, Haydn. Chronicle and Works 1 (1980), 2 (1978), 4 (1977), 5 (1977); A. Meier in HaydnJb 10 (1978); H. Strebel, Anton Stadler: Wirken u. Lebensumfeld des „Mozart-Klarinettisten“ 2016; Ch. Henzel, Die italienische Hofoper in Berlin um 1800, 1994, 272; R.-A. Mooser, Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII siècle 2 (1951), 367, 707 u. 734, 3 (1951), 761; Schilling 2 (1835); J. Schladebach (Hg.), Neues Universal-Lex. der Tonkunst 1 (1855); Wurzbach 24 (1872); Köchel 1869; Dlabacž 1815; GerberATL 1 (1790) u. NTL 1 (1812); Preßburger Ztg. 11.8.1795, 770; Vaterländische Bll. 2.8.1808, 210; Wr. allgemeine musikalische Ztg. 3.4.1813, 215; AmZ 15.12.1813, 821, 20.8.1817, 578, 24.1.1818, 29, 14.10.1818, 726, 14.4.1819, 250f, 19.5.1819, 342f, 21.7.1819, 488, 12.1.1820, 22, 26.1.1820, 61, 25.3.1820, 197, 12.4.1820, 248, 27.5.1820, 340, 31.5.1820, 381f, 12.7.1820, 471 u. 480, 20.8.1823, 552, 1.10.1823, 655, 27.5.1824, 350, 9.9.1835, 602; Allgemeine Wr. Musik-Ztg. 12.3.1844, 124; Taufbuch 1722–71 der Pfarre Benatek, fol. 280r, 402r (und Indexband); Taufbuch 1779–83 der Dompfarre Pressburg-St. Martin, pag. 111 und 396; Taufbuch 1738–1800 der Pfarre Süttör, pag. 219 u. 237; Sterbebuch 1800–06 der Pfarre Maria Treu (Wien VIII), fol. 55; Sterbebuch 1833–40 der Pfarre Maria Treu (Wien VIII), fol. 70; www.beethoven.de (1/2021); eigene Recherchen (www.familysearch.org [1/2021]); Mitt. Bernd Müller (1/2021).
Th. Albrecht in Wr. Oboen-Journal 35 (Oktober 2007), 36 (Dezember 2007), 37 (März 2008) u. 38 (Juni 2008); K. Lamkin, Esterházy Musicians 1790 to 1809, 2007; U. Tank, Studien zur Esterházyschen Hofmusik von etwa 1620 bis 1790, 1981, 430f u. 434f; H. Ch. R. Landon, Haydn. Chronicle and Works 1 (1980), 2 (1978), 4 (1977), 5 (1977); A. Meier in HaydnJb 10 (1978); H. Strebel, Anton Stadler: Wirken u. Lebensumfeld des „Mozart-Klarinettisten“ 2016; Ch. Henzel, Die italienische Hofoper in Berlin um 1800, 1994, 272; R.-A. Mooser, Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVIII siècle 2 (1951), 367, 707 u. 734, 3 (1951), 761; Schilling 2 (1835); J. Schladebach (Hg.), Neues Universal-Lex. der Tonkunst 1 (1855); Wurzbach 24 (1872); Köchel 1869; Dlabacž 1815; GerberATL 1 (1790) u. NTL 1 (1812); Preßburger Ztg. 11.8.1795, 770; Vaterländische Bll. 2.8.1808, 210; Wr. allgemeine musikalische Ztg. 3.4.1813, 215; AmZ 15.12.1813, 821, 20.8.1817, 578, 24.1.1818, 29, 14.10.1818, 726, 14.4.1819, 250f, 19.5.1819, 342f, 21.7.1819, 488, 12.1.1820, 22, 26.1.1820, 61, 25.3.1820, 197, 12.4.1820, 248, 27.5.1820, 340, 31.5.1820, 381f, 12.7.1820, 471 u. 480, 20.8.1823, 552, 1.10.1823, 655, 27.5.1824, 350, 9.9.1835, 602; Allgemeine Wr. Musik-Ztg. 12.3.1844, 124; Taufbuch 1722–71 der Pfarre Benatek, fol. 280r, 402r (und Indexband); Taufbuch 1779–83 der Dompfarre Pressburg-St. Martin, pag. 111 und 396; Taufbuch 1738–1800 der Pfarre Süttör, pag. 219 u. 237; Sterbebuch 1800–06 der Pfarre Maria Treu (Wien VIII), fol. 55; Sterbebuch 1833–40 der Pfarre Maria Treu (Wien VIII), fol. 70; www.beethoven.de (1/2021); eigene Recherchen (www.familysearch.org [1/2021]); Mitt. Bernd Müller (1/2021).
Autor*innen
Christian Fastl
Letzte inhaltliche Änderung
27.3.2024
Empfohlene Zitierweise
Christian Fastl,
Art. „Czerwenka (Czervenka), Familie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
27.3.2024, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001cb4a
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.