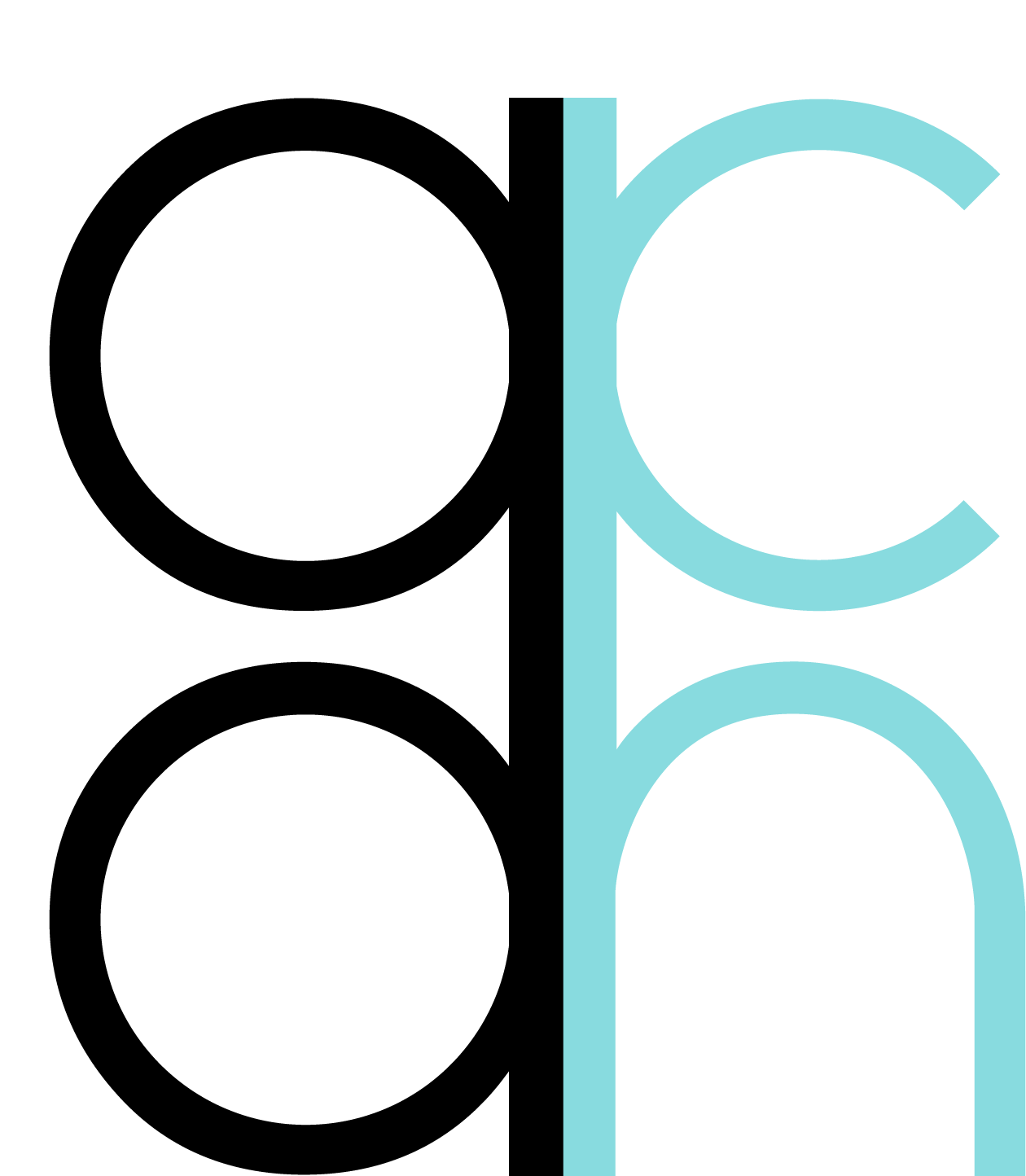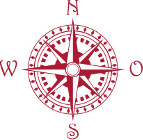Horn
Blasinstrumententyp mit stark konischer Röhre, anfangs von Trompeten nur schwer zu trennen. Erste Belege für die Existenz derartiger Instrumente finden sich in ikonographischen Darstellungen aus dem mittleren Osten im 2. Jahrtausend v. Chr. Als Ausgangsmaterial für den Instrumentenkörper diente jegliche Art von Tierhörnern, Muscheln usw., aber auch pflanzliches Material: Kürbisse, Äste oder Stämme von Bäumen und Schilfgräsern. Eine Vorform der heutigen H.instrumente stellen die in Nordeuropa in einer Art Wachsschmelzverfahren aus Bronze gegossenen Luren dar. Sie entstanden schon 1500 v. Chr., ihre Hochblüte erlebten sie in der späten Bronzezeit (ca. 1300–600 v. Chr., archäologische Funde). Diese bis zu 2 m langen, durchgehend konischen Instrumente wurden senkrecht gehalten und besaßen ein integriertes Mundstück, das entweder kesselförmig oder trichterförmig ausgebildet war und ein bequemes Spiel bis zum 13. und 14. Naturton erlaubte.
Die Tradition der Herstellung von langen, gebogenen H.instrumenten setzte sich bei den Kelten fort (Hallstatt-Kultur). Man findet die Karnyx und den keltischen Lituus. Beide Instrumententypen waren von der Ostküste Irlands bis hinab nach Südfrankreich weit verbreitet.
Zur Zeit der Hochblüte des römischen Reiches (Austria Romana) stand ein richtiger „Satz“ von Instrumenten zur Verfügung: Tuba, Cornu und Lituus, die im Wesentlichen von den Etruskern übernommen worden sind. Während der Lituus, der äußerlich einem Hirtenstab ähnlich sah, in erster Linie ein rituelles Instrument darstellte und keine Weiterentwicklung erfuhr, wurden die Tuba (aus ihr entstanden später die mittelalterlichen Instrumente Busine, Naturtrompete und Posaune) und das Cornu (= Horn!) vom Militär übernommen, adaptiert, verbessert und entwickelten sich bald als eigenständige Instrumente.
Das durchgehend konische, meist spiralförmig gewundene Instrument ist seit Mitte des 15. Jh.s nachgewiesen, wird von Sebastian Virdung als „jeger h.“, von Michael Praetorius als „Jäger Trommet“ und von Marin Mersenne als „cor à plusieurs tours“ bezeichnet. Sein Klang war relativ obertonarm und nur wenige der spielbaren Töne musikalisch brauchbar. Der andere, mehr zylindrische Typus wurde vornehmlich bei der Jagd eingesetzt. Der schmetternde Klangcharakter dieses Instrumentes ergab sich aus der engeren Mensur, dem großen zylindrischen Anteil am Rohrverlauf und dem weit ausladenden Schalltrichter. Damit konnten auch Partialtöne höherer Ordnung musikalisch richtig hervorgebracht werden.
Bis um 1700 wurden diese Instrumente meist mit dem französischen Terminus cor de chasse oder dem italienischen Gegenstück corno da caccia bezeichnet. Nach 1700 taucht in den deutschsprachigen Gebieten der Terminus Waldh. auf, in den Partituren wird allerdings bis in das 20. Jh. allgemein der Ausdruck cor, corno oder H. benutzt.
Erstmals wurden Hörner 1639 von F. Cavalli in seinem Werk Le nozze di Teti e di Peleo nachweislich im Opernorchester verwendet. Eine wichtige Rolle in der Verbreitung des H.s spielte unwidersprochen der böhmische Graf F. A. v. Sporck, der das Instrument auf seinen Reisen durch Frankreich (1680/81) kennen lernte und davon so begeistert war, dass er zwei seiner Jäger (Wenzel Sweda und Peter Rölling) nach Frankreich sandte, um das Spielen dieses Instrumentes zu erlernen.
In Wien wurden Hörner seit 1700 in Opernaufführungen von C. A. Badia und J. J. Fux verwendet, aber erst 1712 zwei Hornisten im Hofopernorchester fest angestellt.
Um 1700 vollzog sich in Wien durch die Brüder M. und J. Leichamschneider die Umwandlung des cor de chasse zum Orchester-H., wie wir es kennen, dem sog. Naturhorn: die Mensur wurde durchgehend erweitert, ebenso das Schallstück stärker konisch ausgeformt und die zweifache Windung durch eine vierfache ersetzt. Die Mensuränderungen verminderten den schmetternden Charakter und schufen einen weicheren, mehr abgedunkelten Klang, der die Eingliederung in ein Ensemble wesentlich förderte. Durch die vierfach gewundene Röhre wurde das Instrument kleiner und handlicher und führte zu der uns bekannten charakteristischen Spielhaltung. Darüber hinaus versahen sie ihre Hörner mit so genannten Krummbögen. Das waren ein- bis mehrfach gewundene Rohrstücke, die ersten Zentimeter zu Beginn leicht konisch, größtenteils jedoch zylindrisch, mit unterschiedlichem Krümmungsradius und unterschiedlichen Längen von 30 cm bis zu nahezu 2 m. Diese auswechselbaren Krummbögen befanden sich zwischen dem Mundstück und dem eigentlichen Korpus. Durch das Wechseln dieser Bögen wurde das H., auf dem durch seine gegebene Länge nur bestimmte Töne nutzbar waren (Naturtöne) nicht nur für eine Tonart, sondern für beliebig viele Tonarten verwendbar (s. Abb. 1).
Die Weiterentwicklung zum Inventions-H. erfuhr das Instrument um 1750 durch den Dresdner Instrumentenmacher Johann Werner, der die Anregung des Hornisten Joseph Hampel aufgriff, die auswechselbaren Bögen nicht zu Beginn des Instrumentes aufzustecken, sondern in der Mitte des zylindrischen Rohrteils einzufügen.
Wurden in Wien um 1700 die technischen Grundlagen gelegt, so entwickelten sich im Laufe des 18. Jh. in Dresden zwei Spieltechniken, die den Gebrauch des H.s in Zukunft revolutionieren sollten: einerseits die Vervollkommnung der Clarintechnik und auf der anderen Seite die dem Hornisten Hampel (fälschlicherweise 1737) zugeschriebene Erfindung der Stopftechnik.
Die Stopftechnik entwickelte sich kontinuierlich. Gemeinsam mit den Lippen und der in den Schalltrichter eingeführten Hand können Töne im tiefen Register bis zu einem Halbton und im mittleren Register weit über einen Viertelton vertieft werden. Versucht man mit der rechten Hand den Schalltrichter aber vollkommen zu verschließen (= Stopfen), so scheint die Grundstimmung des Instrumentes plötzlich exakt um einen Halbton nach oben zu kippen (gilt nur für das Es-H., E-H. und F.-H., nicht für höhere Stimmungen) und der Klang wirkt noch obertonärmer und leiser, allerdings wird er bei erhöhtem Blasdruck (= Energiezufuhr) sehr schnell scharf und etwas dünn. Durch das Stopfen ist es aber möglich, in der zweiten Oktave (c – c1) fast lückenlos diatonisch und im mittleren Register des Instrumentes (c1 bis c2 chromatisch zu spielen, allerdings mit einer signifikant unterschiedlichen Klangfarbe. Die Technik des Stopfens verbreitete sich Mitte des 18. Jh.s rasch über ganz Europa, verlief ein halbes Jh. lang parallel zur Clarintechnik und ersetzte diese schließlich.
Das Naturh. (englisch: handh.) war damit – was das Instrument selbst und seine Spieltechnik betraf – ausgereift und fand als einziger Vertreter der Blechblasinstrumente nicht nur als Soloinstrument und im Orchester, sondern auch in der Kammermusik Verwendung.
Um 1814 kamen Heinrich Stölzel und Friedrich Blühmel offenbar unabhängig voneinander auf die Idee, das Umstimmen des Instrumentes in eine andere Grundtonart durch die Verwendung eines Ventilmechanismus, der ein Rohrstück im zylindrischen Teil des Instrumentes hinzuschaltet, zu vereinfachen (Ventilhorn). Das erste Ventil vertieft das Instrument um einen Ganzton, das zweite Ventil um einen Halbton und das dritte Ventil um eineinhalb Töne. Damit war im gesamten Spielbereich (mit Ausnahme von C bis F in der untersten Oktave) jeder beliebige Ton ohne wesentlichen Klangunterschied spielbar. Als Grundstimmung für das Ventilinstrument wurde F mit einer Rohrlänge von ca. 3,7 m gewählt.
Die Verwendung der Ventilhörner veränderte nicht nur die Einsatzmöglichkeiten, sondern verlieh dem Gesamtorchesterklang eine völlig neue Dimension und Qualität. V. a. die Eroberung der Chromatik in der tiefen und tieferen Mittellage führte zu einer neuen „Kompaktheit“ des H.satzes.
1830 bekam der Wiener Instrumentenmacher L. Uhlmann ein k. u. k. Patent auf ein Wiener Schub- oder Stechbüchsenventil, das, später als Wiener Ventil bezeichnet, schon bald seinen Siegeszug durch ganz Europa antreten sollte und noch heute ein charakteristisches Merkmal des modernen Wiener H.s ist. Das heutige Wiener H. entspricht im Wesentlichen den Mitte des 19. Jh.s von L. Uhlmann gebauten Instrumenten.
1832 erhielt der ebenfalls in Wien ansässige J. Riedl ein k. u. k. Patent auf sein Drehventil. Dieser Ventiltyp war zwar anfangs weniger erfolgreich, löste aber ab 1900 Uhlmanns Wiener Ventil ab und ist das Ventil, welches heute weltweit bei Hörnern eingesetzt wird. Der Grund liegt vermutlich darin, dass der Rotor mehrstöckig ausgeführt sein kann und damit bei Doppel- und Tripelhörnern gleichzeitig mit einem Ventil mehrere Röhren hinzugeschaltet werden können.
Mit der Erfindung des Doppelh.s durch Eduard Kruspe in Erfurt (ca. 1899) wurde eine neue Ära für das H. eingeläutet. Die technische Entwicklung des H.s ist damit zu einem vorläufigen Endpunkt gelangt. Die Erfindung bestand darin, dass zwei Hörner mit unterschiedlicher Grundstimmung (F und B) und daher auch unterschiedlicher Rohrlänge (F = 3,7 m Gesamtlänge, B = 2,8 m Gesamtlänge), zu einem Instrument vereinigt wurden. Der Spieler kann mit Hilfe eines zusätzlichen Umschaltventils, das mit dem Daumen der linken Hand betätigt wird, zwischen den beiden Instrumenten umschalten. Mundstück, Mundrohr und der erste halbe Meter (differiert je nach Modell) sowie das Schallstück samt Schalltrichter werden von beiden Instrumenten gemeinsam genutzt. Mitte des 20. Jh.s wurde die Modellpalette durch das Tripelh. erweitert. Dieses Instrument vereinigt drei Instrumente in sich: H. in F, H. in B und H. in hoch F (s. Abb. 2).
Bemerkenswert ist der Umstand, dass Eduard Kruspes Neukonstruktion nicht aus klanglichen Gründen erfolgte, sondern eine Erleichterung der Spielbarkeit zum Ziel hatte. Klangliche Einbußen und eine teilweise problematische Intonation mussten dafür in Kauf genommen werden. Die Hornisten der Wiener Orchester koppelten sich bewusst von dieser Entwicklung ab, da sie nicht auf die doch sehr weitgehende Modulationsfähigkeit des Klanges beim F.H. und die von L. Uhlmann entwickelten Wiener Ventile verzichten wollten. Daran hat sich bis heute nichts geändert, obwohl in Einzelfällen – wie z. B. für die Interpretation von zeitgenössischer Musik oder bei extrem hohen und technisch anspruchsvollen Partien auch in Wien fallweise zum Doppelh. gegriffen wird.
Das Wiener H. (s. Abb. 3), das gemeinsam mit der Wiener Oboe und der Wiener Pauke zu den wichtigsten Repräsentanten des typischen Wiener Instrumentariums zählt, ist also ein ganz normales Waldh. in F, das trotz erheblicher technischer Verbesserungen, die v. a. 1980–2000 vorgenommen wurden, mit seinem F-Bogen und den Doppelschub-Ventilen äußerlich noch immer so aussieht wie die Instrumente, welche 1860–1900 gebaut wurden. Dieses Instrument wird ausschließlich von Wiener (und fallweise auch anderen österreichischen) Orchestern verwendet und wurde lange Zeit als „Exote“ angesehen. Mittlerweile findet man aber immer mehr Spitzenorchester, deren Hornisten Werke von A. Bruckner, J. Brahms, G. Mahler etc. zu besonderen Anlässen mit speziell dafür angeschafften Wiener Hörnern interpretieren (z. B. Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Concertgebouw Orchest, Edinburgh Philharmonic Orchestra).
Das Wiener H. unterscheidet sich vom weltweit gebräuchlichen Doppelh. im Klang, in der Ansprache und der Spieltechnik. Die Rohrlänge beeinflusst den Energiebedarf, die Treffsicherheit und den Klang. Sie beträgt beim Wiener H. vom Mundstück bis zum Schalltrichterende etwa 3,7 m, beim Doppelh. 2,8 m für den B-H.teil und etwa 1,8 m für den hoch F-H.teil des Tripelh.s. Der Musiker muss mit dem durch die Lippen fließenden Luftstrom [= Energie] die im Instrument sich befindende Luftsäule [= Masse] mit der gewünschten Frequenz zum Schwingen bringen. Es ist klar, dass die Luftsäule des „hohen f-H.s“ mit ihrer halben Länge im Vergleich zum Wiener H. nur eine etwa halb so große Masse besitzt. Daher ist zur Erzeugung einer gleich großen Schwingungsamplitude [= Lautstärke] auch nur halb soviel Energie notwendig. Kurz gesagt: der Musiker muss beim Wiener Modell zum Erreichen einer gleich starken stehenden Welle im Instrument mehr Energie aufwenden als beim Doppelh. Das gilt jedoch nur für den Tonbeginn (die ersten 15–60 Millisekunden), in der die Schwingung im Instrument aufgebaut wird. Ist der Ton einmal da, braucht nur mehr die Energiemenge ersetzt zu werden, die durch die Abstrahlung (das ist der Klang, den wir als Instrumentenklang wahrnehmen) und durch die innere Reibung verloren geht. In der Spielpraxis kommt dieser Effekt bei Werken zum Tragen, welche für Hörner viele Staccato-Noten oder kurze Notenwerte im hohen Register beinhalten (z. B.: Opern von G. Verdi). Diese Parts sind für Wiener Hornisten etwas anstrengender, da innerhalb kurzer Zeit sehr viele Einschwingvorgänge zu bewerkstelligen sind. Bei Werken mit vielen lang ausgehaltenen Tönen (z. B.: Rich. Wagner) hingegen, ist die geringere Abstrahlung aufgrund des engeren Schallstückes als energiesparender Vorteil anzusehen. In diesem Fall müssen die Doppelhornisten etwas mehr Energie aufwenden.
Die Treffsicherheit ist in hohem Maße von der Rohrlänge abhängig und ein Thema, das Musiker und Publikum gleichermaßen interessiert, steht sie doch in der Öffentlichkeit stellvertretend für das allseits bekannte „Kicksen“ („Gicksen“). Der Frequenzabstand der einzelnen Töne beträgt beim hohen f-H. 88 Hz, beim B-H. 58 Hz und beim F-H. nur mehr 44 Hz. Dazu kommt, dass der Hertz-Abstand der einzelnen Töne über den gesamten Spielbereich zwar gleich ist, für unser Ohr aber der Abstand zwischen dem ersten und zweiten Naturton musikalisch das Intervall einer Oktave darstellt, der gleiche Abstand zwischen dem zweiten und dritten Naturton nur mehr eine Quinte, usw. Den Abstand zwischen dem zwölften und dreizehnten Naturton nehmen wir nur mehr als einen Halbton wahr.
Wenn man die Situation um das g2 betrachtet, so zeigt sich, dass beim Wiener F-H. die benachbarten Töne nur einen Halbton entfernt liegen, während beim B-H. diese einen Ganzton und beim f-H.teil eines Doppelh.s schon eine Terz vom Zielton entfernt sind. Das bedeutet, dass der Wiener Musiker seine Lippenspannung wesentlich exakter als der Doppelhornist abstimmen muss, um nicht irrtümlich auf einem benachbarten Ton zu landen. Das Spiel in der hohen Lage erfordert also am Wiener H. etwas mehr Konzentration und ein besseres Funktionieren der Feinmotorik.
Obwohl in der Funktion (also im Zuschalten von Rohrlängen) zwischen Pumpen- und Drehventilen kein Unterschied besteht – beide bewirken dasselbe –, zeigt die Hörerfahrung, dass die Mehrzahl der am Wiener Instrument gespielten Bindungen eher weich klingen, wobei die Töne glissando-artig ineinander fließen. Klanguntersuchungen zeigen bei Bindungen am Doppelh. hingegen oft ein kurzzeitig auftretendes Geräuschband mit einer Dauer von ca. 10–30 Millisekunden zwischen den beiden Tönen, das zwar nur unbewusst, aber doch wahrgenommen wird (s. Abb. 4). Untersuchungen zeigen, dass nicht die Art des Ventiles, sondern die Position, an der der Ventilstock sitzt, dafür verantwortlich ist. Befindet sich das Ventil für einen gespielten Ton gerade an einem Druckknoten, so klingt die Bindung weich; befindet es sich an einem Druckbauch, so tritt ein Geräuschband auf.
Das Wiener H. begünstigt konstruktionsbedingt Bindungen, in denen die Töne ineinander zu fließen scheinen. Schnelle Passagen klingen (obwohl perfekt gespielt) etwas weniger brillant und zum Teil verschwommen. Mit dem Drehventil des Doppelh.s sind weiche Bindungen (z. B. in einem Adagio) schwerer durchführbar. Das eher abrupte Wechseln von einer zur anderen Frequenz bringt allerdings Vorteile bei schnellen Passagen, die durch die klare Tontrennung nicht nur leichter ausführbar sind, sondern auch virtuoser erscheinen.
Die Mensur beeinflusst die Intonation und die Klangfarbe. Generell gibt es keinen Klangunterschied bei piano- und pianissimo-Tönen, der Unterschied zeigt sich erst ab dem forte: hier ist das Wiener Instrument bei gleichem abgegebenen Schallpegel wesentlich teiltonreicher, produziert also einen helleren, strahlenderen, bis zur Schärfe neigenden Klang.
Da der Eindruck der Lautstärke bei Blasinstrumenten nicht so sehr von dem tatsächlich abgegebenen, messbaren Schallpegel, sondern vielmehr von der spektralen Zusammensetzung des Klanges abhängt, ruft der Wiener Instrumententyp schon bei wesentlich niedrigeren Schallpegeln den subjektiven Eindruck des „fortissimo“ hervor. Dies hat Auswirkungen auf die Erkennbarkeit des Instrumentes innerhalb des Orchesterklanges (je teiltonreicher, desto leichter heraushörbar) und auf Verdeckungseffekte. Bei Bruckner-Symphonien kann man z. B. oft feststellen, dass bei fortissimo-Akkorden der Blechbläser die Streicherfiguren völlig untergehen. Diese Gefahr ist bei Wiener Orchestern nicht gegeben, da trotz fortissimo-Eindruckes die Wiener Blechbläser einen objektiv um Vieles geringeren Schallpegel abgeben.
Ursache für die starke Klangfarbenänderung in Abhängigkeit von der Dynamik ist die Mensur im Zusammenwirken mit der Rohrlänge. Während Doppelhörner im zylindrischen Teil je nach Typ einen Innendurchmesser von 11,5 bis 13 mm aufweisen, liegt dieser bei Wiener Hörnern zwischen 10,8 bis 11 mm. Das engere Rohr verursacht einen höheren Reibungsverlust, der durch die längere Luftsäule noch verstärkt wird. Soll die gleiche Lautstärke abgegeben werden, muss der Wiener Musiker etwas mehr Energie zuführen. Die Folge ist, dass bei einem Crescendo bis zum Fortissimo die hohen Teiltöne im Klang der Wiener Hörner stärker ansteigen als bei Doppelhörnern (Details auf https://www.mdw.ac.at/iwk/wiener-horn/).
Literatur
A. Baines, Brass Instruments 1980; NGroveDMI 2 (1984); H. Heyde in B. Habla (Hg.), Alta Musica 9 (1987); H. Heyde, Das Ventilblasinstrument. Seine Entwicklung im dt. Raum von den Anfängen bis zur Gegenwart 1987; H. Heyde, [Kat.] Musikinstrumenten-Museum der Karl-Marx-Univ., Leipzig. Katalog: Hörner und Zinken 1982; H. Heyde in Brass Bulletin 24–27 (1994–97); H. Heyde in Studien zur Aufführungspraxis 4 (1983); H. Fitzpatrick, The H. and H.-Playing and the Austro-Bohemian tradition from 1680 to 1830, 1970; K. Janetzky in R. Dünnwald (Hg.), Das Orchester 2 (1997); K. Janetzky/B. Brüchle, Das H. 1984; MGG 4 (1996); R. Morley-Pegge in Instruments of the Orchestra 2 (1973); G. Widholm in Proceedings of the Institute of Acoustics 19 (1997); G. Widholm in A. Melka (Hg.), [Kgr.-Ber.] Speech – Music – Hearing, Prag 1995, 1995; G. Widholm in Zur Situation der Musiker in Österreich 1994; G. Widholm in O. Biba/W. Schuster (Hg.), [Kgr.-Ber.] Klang und Komponist Wien 1990, 1992; G. Widholm (Hg.), [Kgr.-Ber.] Das Instrumentalspiel Wien 1988, 1989.
A. Baines, Brass Instruments 1980; NGroveDMI 2 (1984); H. Heyde in B. Habla (Hg.), Alta Musica 9 (1987); H. Heyde, Das Ventilblasinstrument. Seine Entwicklung im dt. Raum von den Anfängen bis zur Gegenwart 1987; H. Heyde, [Kat.] Musikinstrumenten-Museum der Karl-Marx-Univ., Leipzig. Katalog: Hörner und Zinken 1982; H. Heyde in Brass Bulletin 24–27 (1994–97); H. Heyde in Studien zur Aufführungspraxis 4 (1983); H. Fitzpatrick, The H. and H.-Playing and the Austro-Bohemian tradition from 1680 to 1830, 1970; K. Janetzky in R. Dünnwald (Hg.), Das Orchester 2 (1997); K. Janetzky/B. Brüchle, Das H. 1984; MGG 4 (1996); R. Morley-Pegge in Instruments of the Orchestra 2 (1973); G. Widholm in Proceedings of the Institute of Acoustics 19 (1997); G. Widholm in A. Melka (Hg.), [Kgr.-Ber.] Speech – Music – Hearing, Prag 1995, 1995; G. Widholm in Zur Situation der Musiker in Österreich 1994; G. Widholm in O. Biba/W. Schuster (Hg.), [Kgr.-Ber.] Klang und Komponist Wien 1990, 1992; G. Widholm (Hg.), [Kgr.-Ber.] Das Instrumentalspiel Wien 1988, 1989.
Autor*innen
Gregor Widholm
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Gregor Widholm,
Art. „Horn‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0002770b
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.