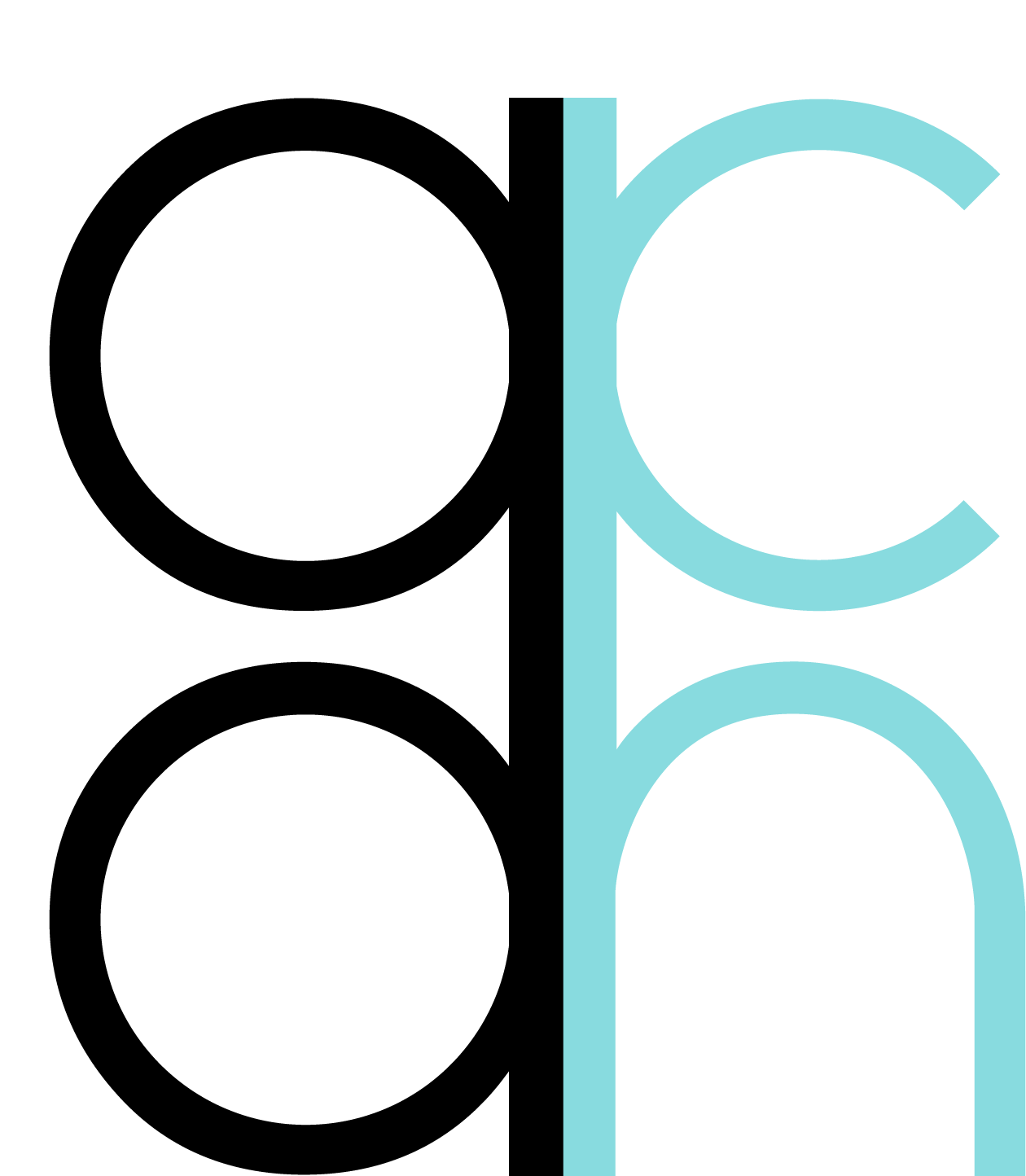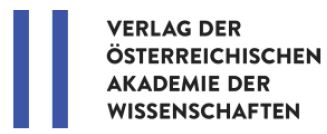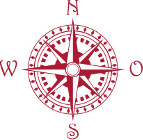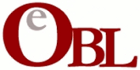Kiendl,
Familie
Streich- und Zupfinstrumentenmacher in Wien und Niederösterreich
Anton: * 3.6.1816 Mittenwald/D, † 13.1.1871 Wien. Es ist nicht bekannt, bei wem er gelernt hat. Er soll zunächst bei Andreas Engleder (* ca. 1810, † nach 1860) in München als Gehilfe gearbeitet haben und ist ab 1843 in Wien nachweisbar. Hier machte er sich als Hersteller von Zithern einen Namen, lt. Lütgendorff soll er auch „Virtuose“ auf diesem Instrument gewesen sein. Bis zu seinem Lebensende wurden in seiner Werkstätte über 15.000 Zithern gebaut. Medaillen und Auszeichnungen anlässlich mehrerer Welt- und Industrieausstellungen belegen die Qualität von K.s Instrumenten. Ab 1866 wurde das Geschäft von Dr. Matthäus Much unter K.s Namen geführt.
K. verbesserte in Zusammenarbeit mit Nikolaus Weigel (1811–78) die Zither und trug so zur Entwicklung der sog. Normalzither mit 4 Griffsaiten und 2 Freisaiten-Oktaven bei. Ab 1858 fertigte K. auch die sog. Elegiezither, ein Instrument in Alt-Lage, das erstmals 1851 von Georg Tiefenbrunner (1812–80) in München gebaut wurde. Auch die Streichzither erfuhr durch K. Verbesserungen. Obwohl sich Lütgendorff lobend über K.s Geigen äußerte, ist es fraglich, ob er jemals reguläre Streichinstrumente hergestellt hat. Sein Neffe
Karl I: * 1850 Graseck/D, † 1915 Wien. Als Zithernbauer war er Schüler seines Onkels A. K. Weiters lernte er bei Johann Baptist Reiter (1834–99) in Mittenwald Geigenbau und bei Tiefenbrunner in München Gitarrenbau. 1872 eröffnete er in Mödling/NÖ eine Werkstätte, ab 1880 ist er in Wien nachweisbar. Er bekleidete in seiner Berufsgenossenschaft unterschiedliche Positionen, ab 1901 war er deren Vorsteher. Seine Witwe führte zunächst die Werkstätte in der Webgasse (Wien VI) weiter, bevor diese vom Sohn übernommen wurde.
Auch K. K.s Qualitäten lagen im Zitherbau. Seine Streichinstrumente werden als nur durchschnittlich beschrieben. Wenig Erfolg war seinem „Cellino“ beschieden, einem Streichinstrument mit eigenwillig geformtem Korpus. Weitere Verbreitung erfuhr die 1892 bei der Internationalen Ausstellung für Musik und Theaterwesen präsentierte Eureka-Eutoniazither. Es handelt sich dabei um eine Vorform der Perfektazither, bei der zusätzliche Freisaiten, die die dritte Oktave abdecken, kreuzsaitig angebracht sind. Dessen Sohn
Karl II: * 21.11.1879 Mödling, † 1952 Wien. Er war Schüler seines Vaters und legte 1900 die Gesellenprüfung ab. Er übernahm das väterliche Geschäft und erhielt 1921 einen Gewerbeschein ausgestellt. 1952 legte er das Gewerbe zurück.
Obwohl einige mittelmäßige Streich- und Zupfinstrumente seiner Produktion bekannt sind, dürfte er hauptsächlich Handel betrieben haben.
Literatur
J. Brandlmeier, Hb. der Zither 1963; Hopfner 1999; C. W. Jaura in Musikpädagogische Zs. 16 (1926); G. Last, Die Zither im Rahmen des Wr. Musiklebens, Hausarbeit Wien 1985; Lütgendorff 61975; Prochart 1979.
J. Brandlmeier, Hb. der Zither 1963; Hopfner 1999; C. W. Jaura in Musikpädagogische Zs. 16 (1926); G. Last, Die Zither im Rahmen des Wr. Musiklebens, Hausarbeit Wien 1985; Lütgendorff 61975; Prochart 1979.
Autor*innen
Rudolf Hopfner
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Rudolf Hopfner,
Art. „Kiendl, Familie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d43c
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.