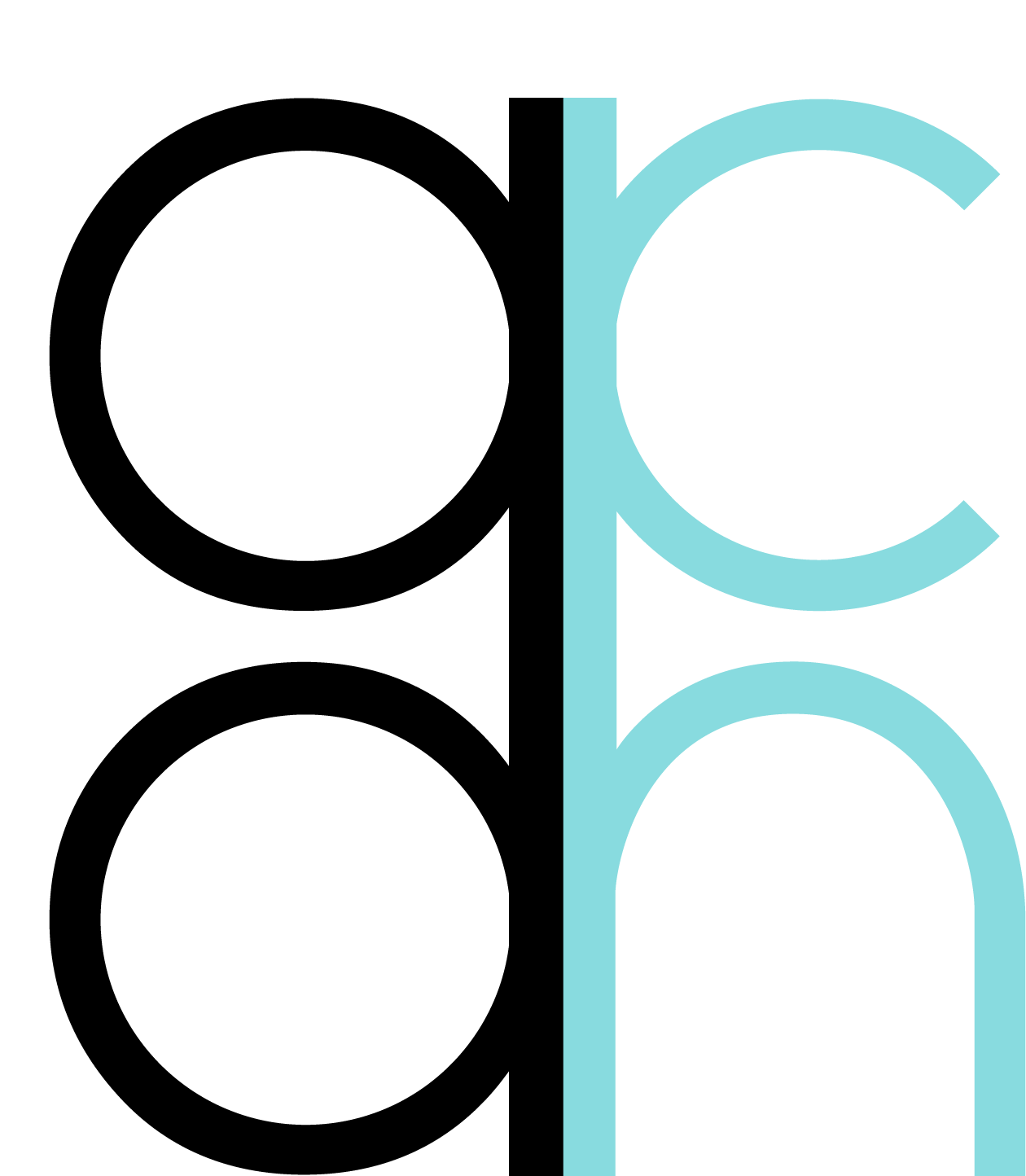Klangfarbenmelodie
Eine Wortschöpfung A. Schönbergs, mit der ein neuartiges Kompositionsverfahren gekennzeichnet werden soll: In der einzigen einschlägigen Veröffentlichung Schönbergs von 1911 wird das Verfahren als Abfolge verschiedener Klangfarben erläutert, „deren Bezeichnung untereinander mit einer Art Logik wirkt“. Schönberg artikuliert hierin die Hoffnung sowohl auf eine qualitative Einordbarkeit klangfarblicher Phänomene wie auf die Möglichkeit, ihrem Ablauf Folgerichtigkeit zu verleihen. Die angesprochene „Logik“ richtet sich zwar am herkömmlichen Melodiebegriff aus, gesteht diesem aber zugleich eine erweiterte ästhetische Wirksamkeit zu. Damit wirft Schönberg weitere, von ihm selbst freilich unbeantwortet gelassene Fragen auf: etwa, ob mit Klangfarbe das Obertonspektrum der einzelnen eingesetzten Musikinstrumente gemeint ist oder ob es sich um bewusst komponierte Mischklangfarben handelt, die zu systematisieren seien. Schönberg hat die mögliche Umsetzung seiner Vorstellungen selbst als „Zukunftsphantasie“ bezeichnet und lediglich einzelne Partien aus eigenen Werken als Vorstudien von K.n gelten lassen. Wichtiger, als die „Logik“ von Klangfarbenverbindungen erfassbar zu machen, war ihm offenbar eine der expressionistischen Kunstutopie nahestehende, ideelle Grundlegung des Begriffs. Sie verweist auf die theosophische Vorstellung von einem „inneren Klang“ (Wassily Kandinsky) aller Dinge, die das menschliche Bewusstsein mithilfe der Musik zu erweitern vermöge. Ein solches Verständnis lässt sich mithin auf empirische und mystische Quellen zugleich zurückführen: So kann man einen Zusammenhang zu Hermann v. Helmholtz’ Lehre von den Tonempfindungen (1863) herleiten, wo die Entwicklungsfähigkeit des Klangfarbenhörens festgestellt (ebd., S. 112) und die melodischen und harmonischen Regelsysteme auf ein unbewusstes Wahrnehmen der Obertonspektren von Einzeltönen zurückgeführt werden (ebd., S. 556). Schönbergs „Logik“ könnte demzufolge als „noch unentwickeltes, aber entwicklungsfähiges“ Gefühl für die Verwandtschaft aufeinander folgender Klangfarben aufgrund der Empfindung gleicher Partialtöne gedeutet werden. Einflussgebend war ebenfalls F. Busonis
Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1907, 21916), daneben auch die Theosophie Emanuel v. Swedenborgs, welche Schönberg durch das Studium von Honoré de Balzacs Séraphita kennen gelernt hatte. Die spätere Rezeption des Begriffs berief sich zwar v. a. auf dessen Urheber Schönberg; aufgrund der Uneindeutigkeiten des Definitionsrahmens wurde er aber in mannigfaltiger Weise gedeutet und eingesetzt. Im zeitlichen Umfeld der expressionistischen Äshetik fand der Terminus zunächst als Schlagwort für einen entgrenzten Ausdruckswillen Eingang in die Musikliteratur. Im Laufe der 1920/30er Jahre erschien er vermehrt als Gegenstand der musikalischen Analysepraxis (etwa bei Paul Bekker, Arnold Schering, E. Stein, später bei P. A. Pisk und Th. W. Adorno). J. M. Hauer verwendete ihn im Sinne eines „melodischen Verhältnisses der Obertöne zueinander“, schloss aber seine Zuhilfenahme bei der Beschreibung von Kompositionsverfahren nachdrücklich aus. A. Webern dienten K.n – anders als Schönberg – in eigenen Werken als Hilfsmittel zur Verdeutlichung motivischer Tonhöhenstrukturen. Der theoretische wie praktische Umgang mit der K. verdichtete sich mithin vorrangig auf die Wiener Moderne um 1910. Als eines ihrer Embleme katexochen faszinierten ästhetische Unmittelbarkeit und systematische Ökonomie, die der Begriff zu verdichten wünschte, auch die Avantgarde der zweiten Jh.hälfte. Die Wortverwendung beschränkte sich nach 1945 stilgeschichtlich und analytisch weiterhin zumeist auf die Musik der Wiener Schule und hierbei insbesondere auf die um und nach 1910 entstandenen Orchesterkompositionen Schönbergs (so das dritte seiner Fünf Orchesterstücke op. 16 mit dem Titel Farben), Alban Bergs (etwa die Mordszene aus dem III. Akt des Wozzeck) und Weberns (z. B. dessen Orchestration des sechsteiligen Ricercars aus J. S. Bachs
Musikalischem Opfer). Vor dem Hintergrund neu entstehender Kompositionstechniken wurde der Terminus seit den 1950er Jahren aber auch als geschichtliche Vorstufe zur „Klangfarbenreihe“ der seriellen Musik aufgefasst (L. Nono, Karlheinz Stockhausen) oder zur Apologie der elektronischen Musik (Herbert Eimert) genutzt. Dass Klangfarbe – als hörbarer Reiz unmittelbar zugänglich – unabhängig von syntaktischen Strukturen bestehen könne, schloss freilich kaum ein, dass sich Schönbergs Hoffnung auf deren logische Systematisierbarkeit in einer späteren kompositionstechnischen Entwicklung folgerecht hätte erfüllen müssen. Die Bedeutung seiner Idee der Klangfarben-Emanzipation besteht für das 20. Jh. v. a. im visionären Erfassen eines Paradigmenwechsels des Verstehens von Musik: als grundlegendes In-Frage-Stellen eines jh.ealten Vorrangs der Tonhöhen- gegenüber den Klangfarbenbeziehungen.
Literatur
A. Schönberg, Harmonielehre 1911 (Vorabdruck in Der Merker 2 [1911], 701–709); A. Schönberg in R. Stephan/S. Wiesmann, [Kgr.-Ber.] A. Schönberg Duisburg 1993, 1996; R. Schmusch in HmT 1994; Ch. M. Schmidt in R. Stephan/S. Wiesmann, [Kgr.-Ber.] A. Schönberg Duisburg 1993, 1996; C. Dahlhaus in C. D., Schönberg und andere 1978, 181–183; R. Busch in [Fs.] H. Berninger 1997; R. Stephan in O. Biba/W. Schuster (Hg.), [Kgr.-Ber.] Klang und Komponist Wien 1990, 1992; H. H. Eggebrecht in H. H. E., Musik verstehen 1995, 63–71; Th. W. Adorno in Th. W. A., Gesammelte Schriften 18 (1984), 59f.; H. Eimert in H. E./H. U. Humbert, Das Lex. der elektronischen Musik 1973; W. Kolneder in ÖMZ 27 (1972).
A. Schönberg, Harmonielehre 1911 (Vorabdruck in Der Merker 2 [1911], 701–709); A. Schönberg in R. Stephan/S. Wiesmann, [Kgr.-Ber.] A. Schönberg Duisburg 1993, 1996; R. Schmusch in HmT 1994; Ch. M. Schmidt in R. Stephan/S. Wiesmann, [Kgr.-Ber.] A. Schönberg Duisburg 1993, 1996; C. Dahlhaus in C. D., Schönberg und andere 1978, 181–183; R. Busch in [Fs.] H. Berninger 1997; R. Stephan in O. Biba/W. Schuster (Hg.), [Kgr.-Ber.] Klang und Komponist Wien 1990, 1992; H. H. Eggebrecht in H. H. E., Musik verstehen 1995, 63–71; Th. W. Adorno in Th. W. A., Gesammelte Schriften 18 (1984), 59f.; H. Eimert in H. E./H. U. Humbert, Das Lex. der elektronischen Musik 1973; W. Kolneder in ÖMZ 27 (1972).
Autor*innen
Matthias Schmidt
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Matthias Schmidt,
Art. „Klangfarbenmelodie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d479
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.