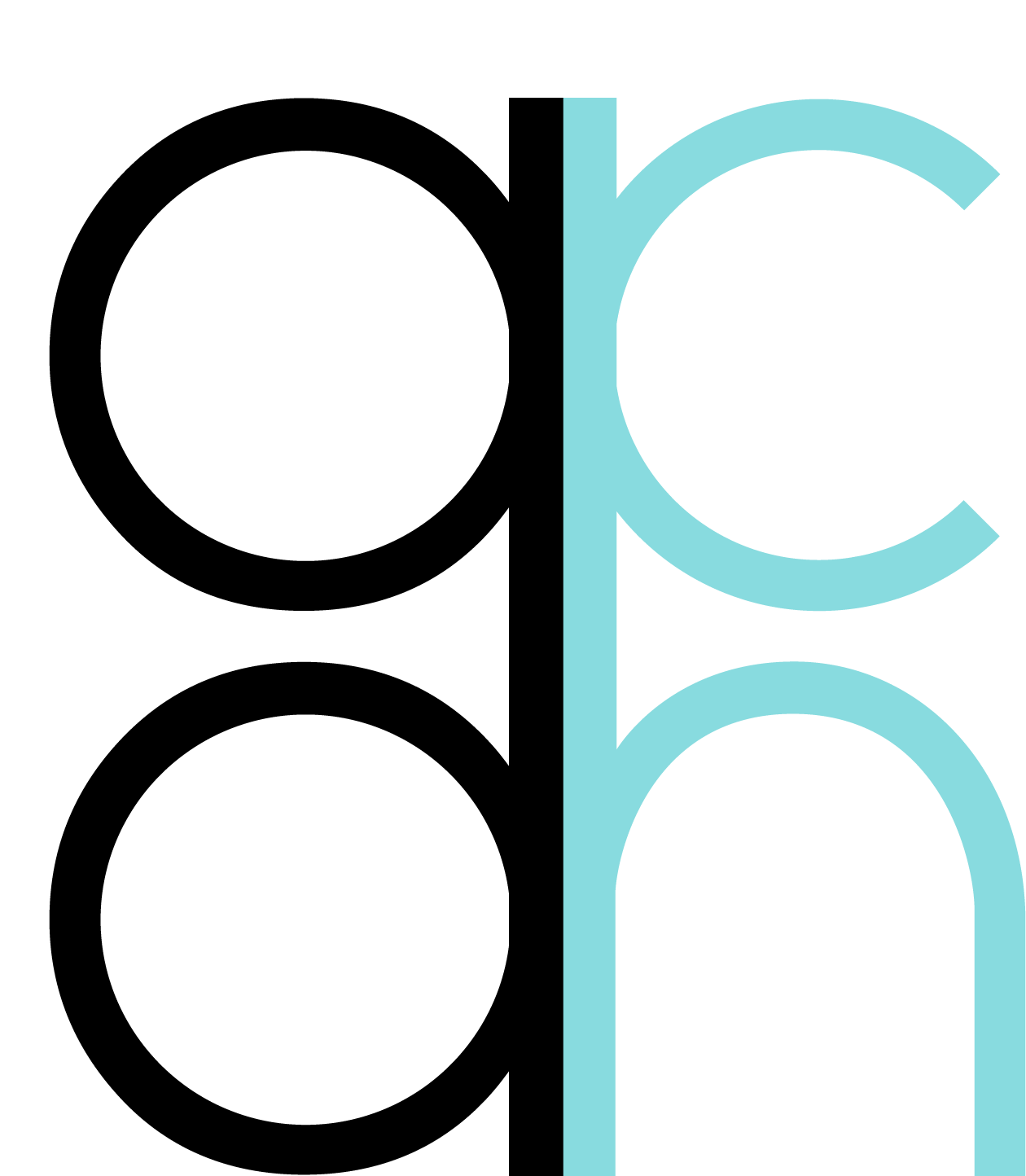Klavierlied
Kunstvolle Vertonung eines Gedichts mit Klavierbegleitung, das als Lied, Ode (Humanismus), Ballade, Kanzone oder Kanzonette erscheinen kann, solistisch vorgetragen wird und in Österreich anfänglich nicht zwingend an die deutsche Sprache gebunden war. Formal existieren Durchkomposition, Strophenstruktur und Mischformen, kompositionstechnisch alle Varianten zwischen schlichtem Satz und arioser Gestaltung mit komplexer Harmonik und schwierigem Klavierpart nebeneinander. Einige K.er erlangten den Status von Volksliedern und Hymnen.(I) Das Wegfallen des Generalbasses führt im 18. Jh. zu einem neuen Klangideal, zu neuen Satztechniken und zur Individualisierung des Ausdrucks. Je nach Rahmenbedingung dominiert fortan im K. entweder das Wort als solches oder sein emotionaler Gehalt. In Deutschland etwa prägt Johann Wolfgang v. Goethes klare Vorstellung von der Vertonung seiner Gedichte das Schaffen zahlreicher Komponisten: der Primat gilt dem Wort, die Musik hat zurückzutreten.
In Österreich, mit Wien als musikalischem Zentrum, bestimmen drei Faktoren das K.: zuerst die Vorherrschaft des Theaters mit großen Emotionen, dann das liberale Verhältnis zur Sprache bei international agierenden Komponisten und schließlich das artifizielle Kunstverständnis; damit verbindet sich die Ablehnung einer schlichten Faktur in bloßer Erfüllung eines Prinzips
Jene frühen Komponisten, die das Gesangsrepertoire bis heute bereichern, sind Ch. W. Gluck, W. A. Mozart und J. Haydn. Keiner verdankt seine Bedeutung allein den K.ern, wodurch ihr Liedschaffen ungeachtet seiner Breitenwirkung bei Publikum und Nachwelt diskreditiert wurde. Die Wahl der Vorlagen, nicht immer hochwertige Dichtungen, provozierte posthum Kritik; ihr subjektiver Zugang entzog sich gattungstheoretischer Vereinheitlichung.
Die Musikpraxis weist die Entwicklung des K.es als kontinuierlichen Prozess aus: Glucks Reform postuliert den Ausdruck wahrer Gefühle anstelle barocker Affekte, veranschaulicht in seiner ersten italienischen Reformoper Orfeo ed Euridice (Wien 1762). Hier tendiert die Melodiebildung zu Fortschreitungen in kleinen Intervallen, vorbereiteten Sprüngen und Dreiklangsbrechungen, wie sie später für so manche K.er F. Schuberts typisch werden sollten. Dieses Prinzip gilt ebenso für weitere Vokalkompositionen, beispielsweise für Klopstocks Oden und Lieder beym Clavier zu singen. Sammelausgaben vereinen Arien, Lieder und Gesänge in verschiedenen Sprachen, mit Klavierbegleitung, wobei man nur nach Schwierigkeitsgrad, nicht aber nach Gattungen differenzierte.
Starke Bezüge zur Bühne finden sich in den 35 K.ern Mozarts: Allesamt minutiös dramaturgisch angelegt, begegnen sie in französischer, italienischer und deutscher Sprache, teils von der Arie kaum unterscheidbar, teils schlicht gehalten, aber niemals mit Volkstümlichkeit kokettierend. Die Begleitung verläuft selten modellhaft, sondern schattiert Empfindungen, während die Gesangsstimme durchaus Eigenständigkeit zeigt. Mozart hat hier nicht bloß eine Gattung bedient. Vielmehr kalkulierte er, wie auch sonst, die Qualifikation der Ausführenden und den Anlass. Volksliedstatus erlangte allerdings eine Nummer aus der Zauberflöte, die durch Umtextierung und Klaviersatz zum K. geriet: Papagenos Lied „Ein Mädchen oder Weibchen“ mit dem Text „Üb’ immer Treu und Redlichkeit“ von Ludwig Hölty, was die Durchdringung der Gattungen exemplifiziert.
Die allmähliche Etablierung des Klaviers zum dominanten Kommunikationsmittel macht die Erstellung von Klavierauszügen für die Verbreitung jeglicher Musik unabdingbar. Unter diesem Aspekt sind Haydns 445 Bearbeitungen schottischer, irischer und walisischer Volkslieder zu sehen. Bereichert um eine Klavierbegleitung, mutierten sie zu K.ern. Seine eigenständige Vertonung von englischer, deutscher und italienischer Lyrik belegt seine Kenntnis der Lieder aus dem Wiener Nationalsingspiel. Haydn überbietet seine Konkurrenz durch subtile immanente Dramaturgie mit Esprit, wodurch er Abnützungserscheinungen der aktuellen Stilmittel minimiert. Einigen seiner deutschen K.er verweigert er eine selbständige Klavierbegleitung: Singstimme und Klavieroberstimme sind identisch, der Text zwischen den Linien notiert, was eine Interpretation ohne Gesang nahe legt (Almanachlied). Damit ist die Beziehung zum Klavierstück determiniert.
Keiner der drei Komponisten schrieb K.er auf Vorrat, keiner reflektierte Lied-Theorien und keiner scheute sich, Lyrik aus dem Bekanntenkreis zu komponieren, ja diese aufzuwerten. Folglich konnte der Primat nur dem emotional-dramaturgischen Gehalt und schwerlich dem (Dichter-)Wort an sich gelten, das nicht zwingend deutsch sein musste.
Mit dem Erstarken des Bürgertums nach 1800 (bürgerliche Musikkultur) entwickelte sich der Markt einer anonymen Liebhaberschaft (Kenner und Liebhaber). Um bestehen zu können, musste man von Gattungen für den Hausgebrauch mehr „produzieren“, sich allenfalls spezialisieren. Unter diesen Auspizien durchläuft das K. des frühen 19. Jh.s mehrere Stadien, bis es jene Gestalt erhält, mit der heute der Terminus „Kunstlied“ assoziiert wird.
Zuerst verliert sich der Bezug zum Theater und mit ihm der Nuancenreichtum der Stimmungen. Eine Grundstimmung innerhalb eines K.es – ausgenommen Balladen – wird zum Prinzip. Dann fordert die Ausführbarkeit durch Dilettanten ihren Tribut, nämlich Sistierung von Verzierungen, klare Akzentuierung und Verringerung des Ambitus. Man berücksichtigte die Atemtechnik wenig geschulter Stimmen und ihren geringeren Umfang. Gleichzeitig ermöglichte der kleinere Ambitus Bearbeitungen für unterschiedliche Stimmlagen. Der Klavierpart unterlag gleichfalls Adaptierungen, wobei die Begleitfiguren exakt jenen Bewegungsabläufen entsprechen, die im Klavierunterricht trainiert werden: Trommel-, Murky- und Alberti-Bässe, Triolenläufe, Akkordrepetitionen in beiden Händen. Der schlechte Ruf all dieser Techniken resultiert aus der einfallslosen Anwendung durch zahllose Epigonen; bei namhaften Komponisten erfüllen sie ihre Aufgabe optimal.
Nur aus dieser Perspektive erklärt sich das K. Schuberts und mit gewissen Einschränkungen auch jenes von L. v. Beethoven. Während Beethoven allemal noch in der Gunst adeliger Mäzene stand, kam Schubert nicht mehr in den Genuss einer langfristigen persönlichen Förderung. Folglich bildet Beethovens Schaffen noch den „Allround“-Komponisten des 18. Jh.s ab, Schuberts Œuvre die Spezialisierung auf das K. als Modegattung seiner Zeit. Beide Komponisten wählen Dichter (etwa Gottfried August Bürger, J. W. v. Goethe, Gottfried Herder, Ludwig Hölty, Friedrich Rückert oder Friedrich v. Schiller), ziehen zudem Gedichte aus dem Umfeld oder der Modelyrik heran und gruppieren sie mitunter in Zyklen: Beethoven fasst K.er mit gleichem Dichter zusammen, Schubert bietet zusätzlich einen inhaltlichen Konnex. Stets darauf bedacht, die Melodie im Vordergrund zu halten, führen beide die Klavieroberstimme häufig parallel oder verwenden zur Begleitung Terzen und Sexten; selbst in vollgriffigen Akkorden bleibt die Singstimme deutlich hörbar. Abseits von strukturellen Übereinstimmungen ergeben jedoch Einfall und Verarbeitung individuelle Lösungen. Schubert achtete Beethoven, war während seiner Studienzeit sehr von Johann Rudolf Zumsteegs Balladen beeindruckt und kannte die Stilmittel der italienischen Oper. Doch außer Anregungen übernahm er keine Verfahrensweisen; so treten etwa Spuren italienischer Melodiebildung in D 965 Der Hirt auf dem Felsen zutage – übrigens ein K., das um den Klang der Klarinette bereichert ist. Sein unverkennbarer Personalstil liegt in der emotionalen Trübung. Dies mag schaffenspsychologisch begründbar sein, denn Schubert liebte Experimente mit der Harmonik. Aus der Sicht der Zeit ist es für einen jungen Komponisten verlockend, das harmonische Stil-Prinzip der Vorgänger hinter sich zu lassen und den ausbaufähigen Bereich der Molltonarten, der Dissonanzbehandlung, der Septakkorde und der Terzverwandtschaften auszuloten. Die Konsequenzen für den Stimmungsgehalt liegen auf der Hand.
Die sich bei Haydn abzeichnende Tendenz zur Instrumentalmusik setzte sich fort: Hat Beethoven dem Lied in seiner 9. Symphonie einen besonderen Platz zugewiesen, so zitiert Schubert Liedmelodien gleichermaßen außerhalb des ursprünglichen Kontextes, etwa im Streichquartett D 810 Der Tod und das Mädchen. Auf Liedthemen beruhen Variationssätze, liedhafte Gestaltungsprinzipien fanden Eingang in die Instrumentalmusik der Zeitgenossen.
Nach Schuberts Tod herrschte wegen der emotionalen Eintrübung und der permanenten Motorik Ratlosigkeit. Dass seine K.er trotzdem bald weite Kreise zogen, ist F. Liszts Transkriptionen zu verdanken. Liszt integrierte die Singstimme in den Klaviersatz und erweiterte manche Phrasen um virtuose Passagen, damit er Schuberts berühmteste K.er im Konzertsaal als Klavierstücke wirkungsvoll präsentieren konnte. Seine eigenen K.er lassen Affinitäten zum französischen Geschmack erkennen, konkret bezüglich der Sprachbehandlung, der Dramaturgie oder der Autonomie von Singstimme – die mitunter effektvoll auftritt – und Klavierpart, der Orchesterqualität annimmt. Der Dilettant wird technisch kaum berücksichtigt. Seine charakteristische Harmonik steigert besonders in seinen fünf Melodramen die Dramatik der Vorlagen: Hier gibt das Klavier die begleitende Rolle auf und malt plastisch die Stimmung des gesprochenen Wortes, eine Technik, die das K. an seine Gattungsgrenzen rückt.
Während alle Komponisten Texte stets individuell handhaben, zeigt sich bei K.ern religiösen Inhalts Übereinstimmung in der Verwendung des traditionellen Choralsatzes. Ebenfalls herrscht Konsens über die Art und Weise, wie Gemeinschaft stiftende Hymnen zu klingen haben (vgl. Haydns Oesterreichisches Nationallied, die Mozart zugeschriebene Bundeshymne oder Beethovens Ode an die Freude nach F. v. Schiller als Hymne der Europäischen Union).
Am politischen Wert des gemeinsamen Absingens der eigenen Hymne bestand in der Historie kein Zweifel. Aus signifikanten Stilmitteln der jeweiligen Region erstellt, schafft sie nach innen Identität und signalisiert nach außen Mentalität und Selbstverständnis der Bevölkerung. Diese Funktionen nutzte C. A. Spina, Inhaber des Musikverlags Diabelli, um Kaiserin Elisabeth zur Hochzeit am 24.4.1854 einen bemerkenswerten Bildband zu schenken: Österreichs National Melodien, illustriert mit Nationaltrachten von Albert Decker. Um die Nationalhymnen des Vielvölkerstaates zu kommunizieren, druckte Spina die Melodien mit Klaviersatz ab, allen voran Haydns Kaiserhymne, deren neuen Text von Johann Gabriel Seidel Kaiser Franz Joseph I. noch rasch vor der Hochzeit genehmigte. Solcherart verwandelten sich Volkslieder in K.er, um der Kaiserin die Vielfalt an Mentalitäten ihrer neuen Heimat einschlägig musikalisch zu präsentieren.
(II) Mit dem Tod Fr. Schuberts war die Ära des Liedes keineswegs beendet; als zentrale Figur der Liedkomposition beeinflusst Schubert die Komponisten bis in das 20. Jh. hinein. Sein Verdienst ist die Integration von Rezitativ und Arioso und eines neuen Deklamationsstils in die Liedkomposition. Obwohl kein gebürtiger Österreicher, wäre ein Abriss über das österreichische K. ohne den Namen J. Brahms unvollständig. Formale und melodische Geschlossenheit bilden die Grundtendenz seines Liedschaffens; der Klavierpart nimmt, trotz der Momente von interpretierender Textausdeutung, vorwiegend die Rolle einer Begleitung ein. Als Gegenpol ist H. Wolf zu sehen, der das Lied von den Merkmalen der bürgerlichen Kunst (die ihm in den Werken von Schubert, R. Schumann und Brahms eigen waren) löste. Die melodischen Bögen werden in deklamierenden Sprechgesang aufgelöst, das bis dato im Lied dominante melodische Prinzip wird zugunsten einer textinterpretierenden Harmonik hintangestellt und der Klavierpart zum Träger psychologischer Textausdeutung. Mit Wolfs Tod verlor die österreichische Musikgeschichte den letzten großen Vertreter des K.es romantischer Prägung. Die nachfolgenden Generationen mussten sich der Aufgabe stellen, die Ästhetik Brahms’ oder Wolfs weiterzuentwickeln oder neue Wege in der Liedvertonung zu finden.
Eine stark vom Symphonischen geprägte Zugangsweise charakterisiert das Liedschaffen von G. Mahler. Die meisten seiner mit Klavierbegleitung vorliegenden Lieder sind als Orchesterlieder konzipiert. Die melodische Ausgestaltung der Singstimme und die Textverständlichkeit werden zugunsten der motivischen Arbeit des Klavier- bzw. Orchesterparts zurückgestellt. Die Synthese aus Volksliedtexten und großer symphonischer Konzeption lässt in seinem Werk eine neue Dimension des Liedes entstehen, die im Aufblühen der Gattung des Orchesterliedes ihren Höhepunkt findet.
W. Kienzl hält in seinen Vertonungen am Primat des Melodischen fest; Deklamationskunst und psychologisierende Ausdeutung bleiben, unberührt von den Errungenschaften H. Wolfs, ein Randbereich in seinem Schaffen. Wie bei Mahler findet sich bei ihm eine Neigung zum Volksliedhaften, das, als ein Teilaspekt des Schubertschen Schaffens, die Ästhetik des österreichischen Liedes nicht unwesentlich bestimmt. Stärker an der symphonischen Ausgestaltung des Klavierparts orientiert sich J. Bittner, der als Opernkomponist dramatische Ausformung seiner Lieder nicht scheut. Der Einfluss Claude Debussys macht sich im Liedschaffen von C. Prohaska bemerkbar. Die Melodik der Singstimme wird durch eine vom frühen 20. Jh. beeinflusste Harmonik bereichert: Chromatik, Quartenakkorde, Bitonalität und die von Debussy übernommenen Mixturklänge bilden die klanglichen Charakteristika. Gleichfalls am Übergang von der Spätromantik (Romantik) zur Moderne komponiert C. Lafite, der der österreichischen Musiklandschaft gehoben populäre Liedkunst beisteuert. A. Zemlinsky verbindet in seinen Liedern musikdramatischen Gestus mit einem stark chromatisierten Satz. Der Einfluss, der in seinen Liedern spürbar ist, reicht von Brahms über Wolf bis zu Mahler und A. Schönberg. Vorwiegend in seinem frühen Werk widmet sich Fr. Schreker der Liedkomposition. Seine ungewöhnlichen harmonischen Lösungen, die zwischen Debussy und atonaler Schreibweise angesiedelt sind, lassen auch sein Werk abseits der Opern bedeutsam erscheinen.
Einen wesentlichen Beitrag zur Liedgeschichte des 20. Jh.s leistet die Zweite Wiener Schule. Im Schaffen A. Schönbergs finden sich K.er vorwiegend unter den frühen Werken; im späteren Vokalschaffen wird das Klavier zugunsten von a-cappella-Besetzungen oder gemischten Ensembles zurückgedrängt. Die Textvorlagen weisen eine große Bandbreite auf; Petrarca, Richard Dehmel und Jens Peter Jacobson stehen neben heute weniger bekannten Namen wie Karl Henckell oder John H. Mackay. Mit den Liedern op. 15 Das Buch der hängenden Gärten (nach Stefan George) leitet Schönberg die Ära der Atonalität im vokalen Schaffen ein. Eine dominante Rolle nehmen Lieder im Werk von Alban Berg ein. Die frühen, zum Teil unveröffentlichten Lieder beziehen kaum die Errungenschaften der Romantik (etwa die Deklamationskunst Wolfs) mit ein. Die in der Lehrzeit bei Schönberg komponierten Lieder zeigen im Vergleich mit den zw. 1905/08 entstandenen Sieben frühen Liedern eine Steigerung der Expressivität und der Deklamationskunst; im Harmonischen zeichnen sie den Weg zur Atonalität vor. Bei A. Webern sind Vokalwerke den Instrumentalwerken nicht nur quantitativ überlegen, sondern nehmen eine Schlüsselstellung zwischen den Schaffensperioden ein. So wird in den George-Liedern op. 3 der Weg in die Atonalität beschritten und ab den Liedern op. 16 (in denen das Klavier durch kammermusikalische Begleitung ersetzt ist) übernimmt Webern die dodekaphone Satztechnik Schönbergs (Zwölftontechniken). In der engen Zusammenarbeit mit Hildegard Jone, der Textdichterin der späten Lieder (u. a. der K.er op. 23 und 25), zeigt sich Weberns persönlicher Zugang zur Liedkomposition.
Aus der Generation Bergs und Weberns sind J. Marx, J. M. Hauer und E. Wellesz als bekannteste Komponisten zu nennen, die im Bereich des K.es von der Romantik ausgehen, in der individuellen Ausformung jedoch eine eigenständige Ästhetik entwickeln. Marx trifft mit seinem kompositorischen Idiom (charakteristisch ist die in den üppigen, klangvollen Klaviersatz verwobene Singstimme) den Geschmack des Publikums und steht bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs im Mittelpunkt der österreichischen Liedkomposition. Hauers zahlreiche Hölderlin-Vertonungen prägt eine asketisch-objektive Vertonungstechnik, die die dichterische Aussage unverfälscht in den Mittelpunkt zu stellen trachtet. Wellesz schließlich entwickelt, auch wenn er dem Kreis um Schönberg nahe steht, im Bereich der Liedkomposition eine eigene Tonsprache, in der das orchestrale Denken des Symphonikers zu entdecken ist, wie auch eine minutiöse, sich ganz am Text orientierende Ausgestaltung von Singstimme und Klavierpart (z. B. Lieder aus Wien op. 82 nach H. C. Artmann). Umfangreichere Liedkompositionen liegen u. a. von E. Kornauth, F. Mittler, R. Maux, J. Rinaldini, W. Grosz, M. Bach, H. Eisler, V. Ullmann und G. v. Zieritz vor.
E. W. Korngold ist mehr für sein Opernschaffen als für seine Lieder bekannt. O. Siegl weist neben seinen Chorwerken ein umfassendes Liedschaffen auf, das „als für das österreichische Lied des 20. Jh.s charakteristisch zu bezeichnen“ (Schollum) ist. Brahms, Wolf, die Tonsprache des jungen Schönberg und volksliedhafte Elemente sind die Ausgangspunkte seiner Komposition. Zahlreiche Liedkompositionen finden sich im Schaffen von E. Krenek; früh emanzipiert er sich vom Vorbild seines Lehrers Schreker, indem er dessen Klangfülle einen ausgesparten Stil gegenüberstellt. In Kreneks Liedern, die häufig auf eigenen Texten basieren, finden sich verschiedene Satztechniken wie Tonalität, Atonikalität, Zwölftontechnik und Clusterbildung.
H. E. Apostel steht dem Schönberg-Kreis nahe; er macht die Zwölftontechnik nach einer tonal-romantischen und einer atonal-expressionistischen Periode zur kompositionstechnischen Ausgangsbasis seines Liedschaffens. Einer der wenigen Komponisten seiner Generation, der gleichfalls in dodekaphoner Technik komponiert, ist L. Spinner, der mit seinen Nietzsche- und Rilke-Vertonungen in unmittelbarer Webern-Nachfolge steht. Stilistisch vielgesichtig präsentiert sich H. Jelinek in seinem Liedschaffen, das von den frühen, von der Spätromantik geprägten Liedern über zwölftontechnisch Gearbeitetes bis zu Chanson-Anklängen im späteren Werk (das auch die Verwendung gemischter Ensembles anstelle des Klaviers zeigt) eine große Bandbreite aufweist. In der Schubert-Nachfolge – v. a. was dessen Umgang mit der Atmosphäre der Gedichte anbelangt – ordnet sich M. Rubin ein, der als Schüler Darius Milhauds auf Melodik im Gesangspart und Sparsamkeit in der Klavierbegleitung bedacht ist. Die Auswahl der Texte zeugt von seinem Anliegen, die Humanitas durch das Medium des Liedes zu verkünden.
Aus der Komponistengeneration, deren Werk zum größeren Teil nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, sind als Liedkomponisten zu nennen: F. Wildgans, C. Bresgen, K. Schiske, H. Eder, E. Werba, P. Kont, R. Schollum und G. v. Einem. Der Stilpluralismus, der das 20. Jh. prägte, spiegelt sich in ihrem Werk wider, wobei der häufige Rückgriff auf die Romantik (Ausgangspunkt Schubert und Wolf) und die Tendenz zum Neoklassizismus (Klassizismus) neben einer meist temporären Auseinandersetzung mit Dodekaphonik zu beobachten ist. Die von Olivier Messiaen geprägte Klangwelt eines A. Heiller und die – ohne epigonal zu sein – in bester Tradition die Nachfolge der Wiener Schule weiterführenden Werke von F. Cerha, dessen K.er überwiegend vor 1945 entstanden, zeigen eine eigenständige Ausformung des Liedes.
Bei den jüngeren Komponisten wird der untergeordnete Stellenwert des K.es offensichtlich; die Gesangstimme wird mit anderen (meist mehreren) Instrumenten kombiniert. Als Komponisten und Komponistinnen, die der Gattung K. weiterhin einen Stellenwert in ihrem Werk einräumen, seien Th. Ch. David, H. Ebenhöh, K. H. Füssl, K. A. Hueber, H. Kann, D. Kaufmann, H. Kratochwil, G. Lampersberg, H. Neumann, K. Rapf, H. Schiff-Riemann, G. Rühm, K. Schwertsik, S. Sommer, H. Stuppner, B. Sulzer und G. Waldek genannt.
Literatur
E. A. Ballin, Das Wort-Ton-Verhältnis in den klavierbegleiteten Liedern Mozarts 1984; W. Dömling, Franz Liszt und seine Zeit 1998; W. Dürr, Das dt. Sololied im 19. Jh. 1984; A. Feil, Franz Schubert – Die schöne Müllerin – Winterreise 1975; L. Finscher, Joseph Haydn und seine Zeit 2000; Flotzinger 1988; T. Georgiades, Schubert. Musik und Lyrik 1967; T. Kabisch, Liszt und Schubert 1984; G. Mraz (Hg.), Österreich Ungarn in Lied und Bild 1998; W. Wiora, Das dt. Lied 1971; R. Schollum, Das österr. Lied des 20. Jh.s 1977; MaÖ 1997.
E. A. Ballin, Das Wort-Ton-Verhältnis in den klavierbegleiteten Liedern Mozarts 1984; W. Dömling, Franz Liszt und seine Zeit 1998; W. Dürr, Das dt. Sololied im 19. Jh. 1984; A. Feil, Franz Schubert – Die schöne Müllerin – Winterreise 1975; L. Finscher, Joseph Haydn und seine Zeit 2000; Flotzinger 1988; T. Georgiades, Schubert. Musik und Lyrik 1967; T. Kabisch, Liszt und Schubert 1984; G. Mraz (Hg.), Österreich Ungarn in Lied und Bild 1998; W. Wiora, Das dt. Lied 1971; R. Schollum, Das österr. Lied des 20. Jh.s 1977; MaÖ 1997.
Autor*innen
Margareta Saary
Barbara Dobretsberger
Barbara Dobretsberger
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Margareta Saary/Barbara Dobretsberger,
Art. „Klavierlied‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d48f
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.