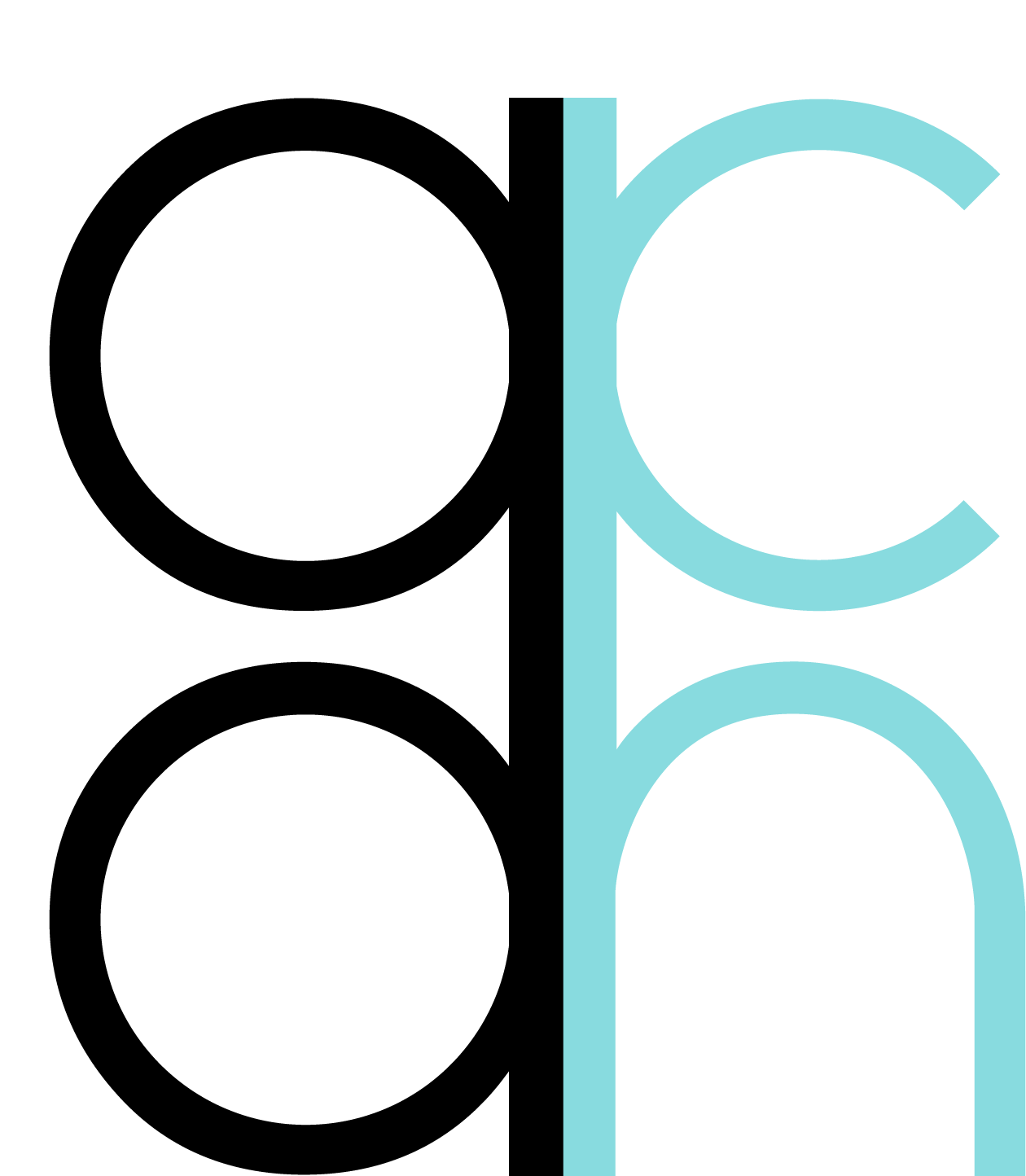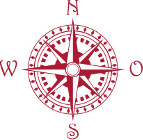Kontrabass
Das größte und tiefste der heutigen Streichinstrumente. Er wird als Vier- oder Fünfsaiter gebaut, ist als Viersaiter auf E1 – A1– D – G gestimmt und hat als Fünfsaiter eine zusätzliche H2 - bzw. C1-Saite. Selten wird eine hohe c-Saite verwendet. Anstelle von Holzwirbeln sitzen an der Außenseite des Wirbelkastens metallene Schraubenmechaniken, die auch den Einbau von Feinstimmern erübrigen. Eine Alternative zum Fünfsaiter ist der Viersaiter mit Kontra-C-Mechanik. Die bis zum C1 verlängerte E1 Saite wird in eine Anordnung von Druckhebeln oder in ein System von vier ineinanderliegenden Messingröhrchen eingesetzt, die es ermöglichen, die unterhalb von E1 liegenden Töne zu greifen. In Europa war dieser Art kein großer Erfolg beschieden, in amerikanischen Orchestern ist sie alltäglich.Die Notierung des K.es ist in allen Schlüsseln eine Oktave höher als klingend. Beim Konzertspiel hat sich die einen Ganzton über der Orchesterstimmung stehende Skordatur Fis1 – H1 – E – A allgemein durchgesetzt.
Die ältesten erhaltenen Kontrabässe sind ein heute viersaitiges Instrument, zugeschrieben Ventura Linarol, Venedig 1548, eine sechssaitige K.-Viola-da-braccio von Hans Vogel, Nürnberg 1563, und eine sechssaitige K.gambe, ebenfalls von V. Linarol, Padua 1585. Die Echtheit aller drei Instrumente ist jedoch, wie die der Streichinstrumente des 16. und 17. Jh.s generell, fraglich. Im Falle des ersten hätte Linarol das Instrument mit acht Jahren gebaut, die beiden anderen sind neueren Untersuchungen zufolge aus Teilen meist jüngerer Instrumente zusammengefügt.
Ungeachtet dessen, kann als Urbild des heutigen K.es die Linarol zugeschriebene K.gambe von 1585 in der Instrumentensammlung des Wiener Kunsthistorischen Museums angesehen werden. D. h., der K. gehört genealogisch zur Viola-da-gamba-Familie, enthält darüber hinaus aber auch zahlreiche Merkmale der Viola da braccio. Diese seine Mischform ist im Italien des späten 16. Jh.s durch ein Abgehen von der reinen Gambenform entstanden und hat zwei idealtypische Ausprägungen hervorgebracht: eine gambendominierte mit flachem, oben abgeschrägtem Boden, geraden Zargenecken ohne Randüberstand von Decke und Boden, und eine violindominierte mit gewölbtem Boden, ausgezogenen Zargenecken und Randüberstände von Decke und Boden. Letztere war v. a. in Italien sehr beliebt. Der Korpus beider Formen hat die zum Hals hinaufgezogenen Schultern der Gambe.
Daneben gab es auch Kontrabässe des da-braccio-Typs, allerdings nie in reiner Ausprägung.
Viktor-Charles Mahillon verzeichnet in seinem Catalogue descriptive eine Basse quinte de viole de braccio aus dem frühen 17. Jh., ein 16-Fuß-Instrument in Form eines übergroßen Violoncells mit flachem Boden und fünf Saiten mit der Stimmung F1 – C – G – d – a. James Talbot führt in seinem 1692–95 verfassten Instrumentenkundetraktat aus, dass der Bass der Violin-Familie in England viersaitig (B1 – F – c – g), in Frankreich fünfsaitig und sonst eventuell auch sechssaitig ist. In der Orchester- und Kammermusik hatten diese Kontrabässe wenig Erfolg, sowohl weil die Quintenstimmung spieltechnische Probleme bereitete, als auch weil man offenbar den gedeckten Klang der Gambenbässe, deren dolce risonanca, bevorzugte. Vereinzelt waren sie als „Kirchenbässe“ anzutreffen, lediglich in der Volksmusik haben sie als „Bassettl“ bis ins 19. Jh. überlebt.
Die verwirrende Vielfalt der Bauformen, Stimmungen und Namen resultiert aus dem Bedürfnis der Verstärkung der Bassstimme im 16-Fuß-Register in der Orchesterpraxis des 17. Jh.s und der damit verbundenen Probleme. So konnten gleiche Instrumente verschiedene Namen tragen (Groß Contra-Bas-Geig, Violone in Contrabasso, Violone grosso), sich unter einem Sammelbegriff (Baßgeig, Violone, Double Basse) aber auch verschiedene Instrumente verbergen. Betrug die Saitenzahl zunächst sechs, so wurde sie bis zum letzten Drittel des 18. Jh.s sukzessive auf drei verringert. L. Mozart berichtet in der 2. Auflage seiner Violinschule erstmals von Dreisaitern, und Christian Friedrich Daniel Schubart bemerkte in seinen Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst: „Er [der Violone] hatte ehemals vier bis fünf Saiten, nun aber braucht er zur Begleitung nicht mehr als drei“. Der Dreisaiter war im letzten Drittel des 18. Jh.s weit verbreitet, in Italien wurde er vereinzelt bis ins 20. Jh. gespielt, und er war das bevorzugte Soloinstrument von Domenico Dragonetti und Giovanni Bottessini.
Diese heutige Quartstimmung ist von Mitteldeutschland ausgegangen und war dort um 1800 bereits Standard. J. G. Albrechtsberger berichtet in seiner Anweisung zur Komposition (Leipzig 1790) außer über den Wiener Fünfsaiter auch über den „Violon, welcher nur vier Saiten und keine Bünde hat. Dessen Stimmung aber anders lautet, nämlich: G A d g oder F A d g. Dieser und der dreyfache sind selten mehr zu sehen.“ In der Zweitauflage von 1837, hg. v. I. v. Seyfried , ist die Häufigkeit des Wiener Fünfsaiters bereits stark eingeschränkt, v. a. aber findet sich der Viersaiter mit E1 – A1– D – G oder F1 – A1– D – G. „Dieser, und auch der dreysaitige sind jetzt fast allgemein in wohl organisierten Orchestern zu finden.“ Wenzel Hause (1764–1847) erwähnt in seiner Schule von 1809 an Stimmungen: die „jetziger Art (in E A D G)“, die „der Violonen (in G D A D)“, die des „Bariton Violon (in A D G C)“, die des „Fünfsaitigen Terz Violon“ in F1 – A1 – D – Fis – A) und die italienische Dreisaiterstimmung A1 – D – G.
Einen eigenen Weg des K.baues ging man im 18. und frühen 19. Jh. in Wien. Dieser sog. „Wiener Quart-Terz-Violon oder K.“ hat möglicherweise ältere Vorläufer (vgl. Hans von Francolini, 1560; Michael Praetorius, 1619), besitzt Gambenumriss, einen flachen nach oben abgeknickten Boden, Decke und Boden sind ohne Randüberstand, das Griffbrett hat Bünde und er ist fünfsaitig. Der Wirbelkasten hat ein charakteristisches gezacktes Profil. Das Instrument wurde nicht mit einem Stachel, sondern mit einem etwa faustgroßen Holzknopf auf den Boden gestellt, diskantseitig war an die Ecke von Boden und Zargen oft ein Holzknauf geleimt, gelegentlich mit Eisendorn, wodurch das Instrument, wenn man es linksgeneigt wie eine Gambe hielt, beinahe ohne Hilfe des Musikers stehen blieb. Die auf dem D-Dur-Dreiklang aufgebaute Stimmung F1 – A1 – D – Fis – A entpuppt sich vor dem Hintergrund der bei J. J. Prinner genannten Vorform F1 – A1 – D – Fis – H ebenfalls als Nachfahre der alten Gambenstimmung. Seine Blüte erlebte er zwischen etwa 1730 und 1830, erst das große Symphonieorchester der Romantik hatte für dieses schlank klingende Instrument keine Verwendung mehr.
Die Annahme, dass nur dank seiner Präsenz der Gambentyp erhalten geblieben sei, erscheint übertrieben, doch verdanken wir ihm, dass in Wien im ausgehenden 18. Jh. das konzertierende K.spiel einen beispiellosen Höhenflug erlebte. Am Beginn stehen die K.soli in den Tageszeitensinfonien (Hob.I: 6-8) von J. Haydn, der 1763 auch das erste, leider unwiederbringlich verlorene, K.konzert (Hob.VII/c) schuf. Ihm folgen die Konzerte und Kammermusikwerke von C. Ditters von Dittersdorf, J. B. Vanhal, W. Pichl, A. Zimmermann und F. A. Hoffmeister.
Mit F. Pischelberger und J. Sperger sind nicht nur die Namen zweier K.virtuosen der Zeit erhalten, sondern auch ein Repertoire, das bis heute gespielt wird. Für ersteren, 1765–69 unter Dittersdorf in der Kapelle des Bischofs von Großwardein (Oradea/RO), schrieben Dittersdorf und Pichl je zwei Konzerte, Dittersdorf eine Konzertante Sinfonie und ein Duett für Viola und K. Als Musiker im Orchester des Schikanerderschen Freihaustheaters auf der Wieden komponierte W. A. Mozart für ihn und F. Gerl, den ersten Sarastro, die Arie für Bass mit obligatem K. Per questa bella mano (KV 612). Sperger war nach Lehrjahren in Wien, u. a. bei J. G. Albrechtsberger, in den Kapellen von Erzbischof Kardinal Joseph Graf v. Batthyány in Pressburg und von Graf Ludwig v. Erdödy in Fidisch bei Eberau/Bl tätig. Als Komponist hat er ein umfangreiches Œuvre hinterlassen, u. a. 45 Sinfonien und 18 K.konzerte.
Herausragende Wiener K.bauer waren A. und A. St. Posch, J. Ch. Leidolff, J. J. und M. I. Stadlmann, J. G. und M. Thier, S. Dallinger, M. Stoss, Fr., G. und Ferd. Fielnreiter, Joseph Hamberger sen. und jun., G. Lemböck u. a.
Der akademische K.-Unterricht beginnt auf österreichischem Boden mit der Gründung des Prager Konservatoriums im Jahre 1811. Erster K.-Lehrer war Wenzel Hause (1764–1847), der mit seinem dreibändigen Schulwerk dem Unterricht neue Wege wies. Sein Schüler A. Sláma wurde Mitglied des Wiener Hofopernorchesters und 1833 Lehrer am Konservatorium der GdM. Josef Hrabě (1816–70) übernahm die Klasse seines Lehrers Hause und führte sie zu überregionaler Bedeutung, u. a. mit Josef Rambousek, dem Lehrer Sergej Koussevitzkys, und F. Simandl. Aus dessen Klasse kamen Ludwig Emanuel Manoly (1855–1927), ab 1876 in den USA (Metropolitan Opera, New Yorker Philharmoniker), Joseph Clam (1860–1935), ab 1879 in Berlin (Lindenoper), A. Mišek, nach zwei Jahrzehnten in Wien ab 1920 am Prager Nationaltheater und am Konservatorium, E. Madensky, Simandls Nachfolger als Konservatoriumslehrer, u. v. a. Simandls Unterrichtswerke werden noch heute (2018) verwendet, Mišek und Madensky waren auch kompositorisch tätig.
K.klassen bestehen heute an allen österreichischen Musikuniversitäten und Konservatorien. In Wien gibt es seit 1974 ein in der Österreichischen Nationalbibliothek untergebrachtes K.archiv, das sich der Dokumentation und wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themenkomplexes „Der K. in Österreich“ widmet.
Das Solospiel auf dem K., in Österreich eher stiefmütterlich behandelt, hat durch das Wirken von L. Streicher neuen Aufwind erhalten. Sein Nachfolger als Hochschullehrer ist sein Schüler Josef Niederhammer (* 1954); auch er ist als Solist tätig.
Auch im Jazz war der K. von Anfang an dabei, wenngleich mit starker Konkurrenz der Tuba. Außerdem wurde er meist und v. a. auf Schallplatte mit dem Bogen gespielt, weil bei den akustischen Schalltrichteraufnahmen der gezupfte K. und die Basstrommel des Schlagzeugs die Aufnahmenadel aus der Wachsmatritze springen ließen. Erst die elektrische Aufnahmetechnik ließ ab 1926 das heute allgemein übliche Pizzicato-Spiel zu. Aus der Reihe österreichischer Jazzbassisten sind hervorzuheben: A. Roidinger, der sich stilistisch weitläufig zwischen modernem Mainstream-Jazz und frei improvisierter und computergenerierter Musik bewegt und seit Mitte der 1970er Jahre auch pädagogisch tätig ist, u. a. als Leiter der Abteilung Jazz und Popularmusik am Bruckner-Konservatorium des Landes Oberösterreich, ferner der Austro-Amerikaner W. Darling, der 1977–2003 an der Grazer MHsch./MUniv. unterrichtete und u. a. an der Seite F. Guldas aufgetreten ist, sowie P. Herbert, ein Wayne-Darling-Schüler, der sich sowohl als Soloimprovisator wie auch als Komponist profilieren konnte.
Literatur
L. Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule 1756, 21769/70; W. Hause, Schule des K.-Spiels 1–2 (1809) u. 3 (1844); F. Simandl, Neueste Methode des Contrabaßspiels, 3 Teile 1874f; V.-Ch. Mahillon, Catalogue descriptif du Musée instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles 1893ff, Nr. 1434; A. Meier, Konzertante Musik für K. in der Wiener Klassik 1969; A. Planyavsky, Die Gesch. des K.es 1970, 21984; A. Planyavsky, Der Barock-K. Violone 1989; W. Salmen (Hg.), K. und Baßfunktion 1986; L. Huppertsberg in jazzforschung/jazz research 19 (1987); J. Focht, Der Wr. K. 1999.
L. Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule 1756, 21769/70; W. Hause, Schule des K.-Spiels 1–2 (1809) u. 3 (1844); F. Simandl, Neueste Methode des Contrabaßspiels, 3 Teile 1874f; V.-Ch. Mahillon, Catalogue descriptif du Musée instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles 1893ff, Nr. 1434; A. Meier, Konzertante Musik für K. in der Wiener Klassik 1969; A. Planyavsky, Die Gesch. des K.es 1970, 21984; A. Planyavsky, Der Barock-K. Violone 1989; W. Salmen (Hg.), K. und Baßfunktion 1986; L. Huppertsberg in jazzforschung/jazz research 19 (1987); J. Focht, Der Wr. K. 1999.
Autor*innen
Herbert Relinger
Letzte inhaltliche Änderung
9.11.2022
Empfohlene Zitierweise
Herbert Relinger,
Art. „Kontrabass‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
9.11.2022, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d577
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.