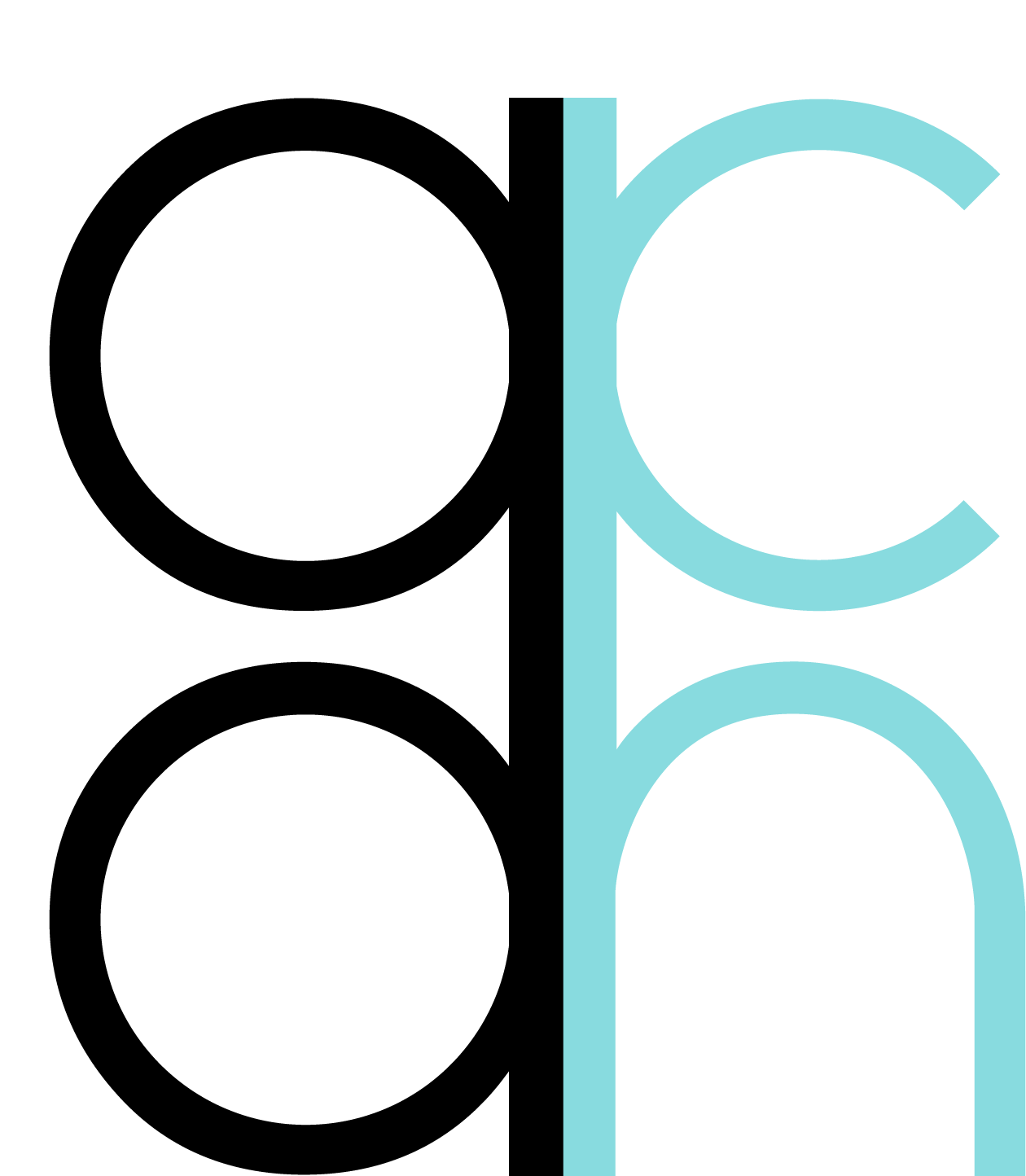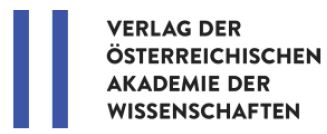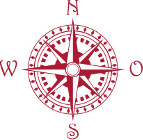Müller,
Familie
Mathias
d. Ä.:
* 24.2.1770 Wernborn bei Frankfurt a. M./D,
† 28.12.1844 Wien.
Klavierbauer.
Kam als Geselle nach Wien und erhielt trotz eines Hofrekurses der bürgerlichen Orgel- und Instrumentenmacher 1796 die Erlaubnis, sein Meisterstück abzulegen. Am 5.5.1797 erhielt er das Bürger- und Meisterrecht verliehen. Wohnhaft war er auf der Wieden („beym weißen Hirschen“ 30), ab 1799 an der Wien 32 (im Haus „zu den 3 Hufeisen“). Am 24.12.1804 erhielt M. eine Fabriksbefugnis verliehen, die Produktionsstätte befand sich an der Wien in der oberen Gestättengasse 175 im eigenen Haus. Ab diesem Zeitpunkt durfte er seine Signaturen mit dem kaiserlichen Doppeladler versehen. Ab 1819 verlegte er die Fabrik in die Leopoldstadt („Praterstraße, bey der Kirche 502“). M. war Vorsteher der bürgerlichen Klaviermacher (Klavierbau) und beeideter Schätzmeister. Er hinterließ seiner Ehefrau Elisabeth (geb. Kilian, * 1783), und seinen elf Kindern ein beträchtliches Vermögen.M. war einer der innovativsten Wiener Klavierbauer und ließ mehrere Verbesserungen sowie Neuerfindungen patentieren. Bereits 1797 kündigte er ein neu erfundenes Klavierinstrument an, dessen Korpus die Form einer quer gelegten Harfe besaß. Der Vorteil lag in der Platzersparnis. Größere Bedeutung für die Entwicklung des Klavierbaus kommt jedoch der erstmals 1800 gebauten sog. Dittaleloclange (auch Ditanaclasis) zu. Bei diesem Vorläufer des modernen Pianinos handelt es sich um ein aufrechtstehendes, 5½ Oktaven umfassendes Hammerklavier, bei dem im Gegensatz zu den Pyramiden- und Giraffenklavieren die Saiten nahe dem oberen Befestigungspunkt angeschlagen werden. Dies hat Auswirkungen auf den Klang und ermöglicht darüber hinaus eine geringere Bauhöhe. Das Klavier wurde als Doppelinstrument angeboten, wobei eines der Instrumente eine Oktave höher gestimmt war und die beiden Spieler über das Gehäuse hinweg Blickkontakt halten konnten. Ab 1803 fertigte er die Ditanaclasis auch in einer einfachen Version. 1801 versah M. das Instrument mit einer verschiebbaren Klaviatur, was zusätzliche dynamische Schattierungen ermöglichte. Nach C. L. Roellig Tod übernahm M. von den Erben alle von Röllig erworbenen Privilegien und fertigte die Instrumente.
Lt. Haupt soll das Panmelodicon, ein Reibidiophon mit Messingstäben, nicht von Franz Leppich, sondern 1810 von M. erfunden worden sein. M. entwickelte auch eine oberschlägige Klaviermechanik (1823 und 1824), bei der die Hämmer auf einer Hammerbank befestigt waren und die Auslöser am Tastenende. Sie war auf flügel- und tafelförmige Instrumente anwendbar. Das Privileg erlosch 1826. Interessanterweise ließ 1823 auch J. B. Streicher eine oberschlägige Mechanik patentieren und baute sie bis ca. 1840 mit Erfolg. Weitere Patente betrafen eine Stoßzungenmechanik (1835) sowie verbesserte Rahmenkonstruktionen aus Eisen (1829) und Holz (1833). Beim Gabel-Harmon-Pianoforte (1827) verwendete M. anstatt der Stegstifte Stimmgabeln, die mit dem jeweiligen Ton korrespondierten. Die dadurch erzielte zusätzliche Resonanz machte die dritte Saite des jeweiligen Chors ohne klangliche Einbuße entbehrlich. Sein Sohn
Mathias d. J.: * 10.4.1807 Wien, † nach 1835 (Ort?). Klaviermacher. Scheint in den Wiener Adressenverzeichnissen bis 1835 in der Praterstraße Nr. 502 auf. 1827 suchte er um ein Gewerbe und Abgabe der Meisterprobe an, 1828 erhielt er es, worauf er den Bürgereid ablegte. Lt. einer Eintragung im Konskriptionsbogen hielt er sich 1829 in Paris auf. Über seine Arbeit ist nichts bekannt. Einige der Anträge auf Privilegien sind gemeinsam von Vater und Sohn eingebracht worden.
Literatur
NGroveD 17 (2001); M. N. Clinkscale, Makers of the Piano 1700–1820, 1993, 208; R. E. M. Harding, The Piano-Forte 1933, 221–223; H. Haupt in StMw 24 (1960); Hopfner 1999; Ottner 1977; [Anonym], Beschreibung der Erfindungen und Verbesserungen für welche in den kaiserlich-königlichen Österr. Staaten Patente ertheilt wurden, und deren Privilegiumsdauer jetzt erloschen ist 1 (1841); WStLA (Konskriptionsbogen Leopoldstadt 502).
NGroveD 17 (2001); M. N. Clinkscale, Makers of the Piano 1700–1820, 1993, 208; R. E. M. Harding, The Piano-Forte 1933, 221–223; H. Haupt in StMw 24 (1960); Hopfner 1999; Ottner 1977; [Anonym], Beschreibung der Erfindungen und Verbesserungen für welche in den kaiserlich-königlichen Österr. Staaten Patente ertheilt wurden, und deren Privilegiumsdauer jetzt erloschen ist 1 (1841); WStLA (Konskriptionsbogen Leopoldstadt 502).
Autor*innen
Rudolf Hopfner
Letzte inhaltliche Änderung
14.3.2004
Empfohlene Zitierweise
Rudolf Hopfner,
Art. „Müller, Familie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
14.3.2004, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x000276ef
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.