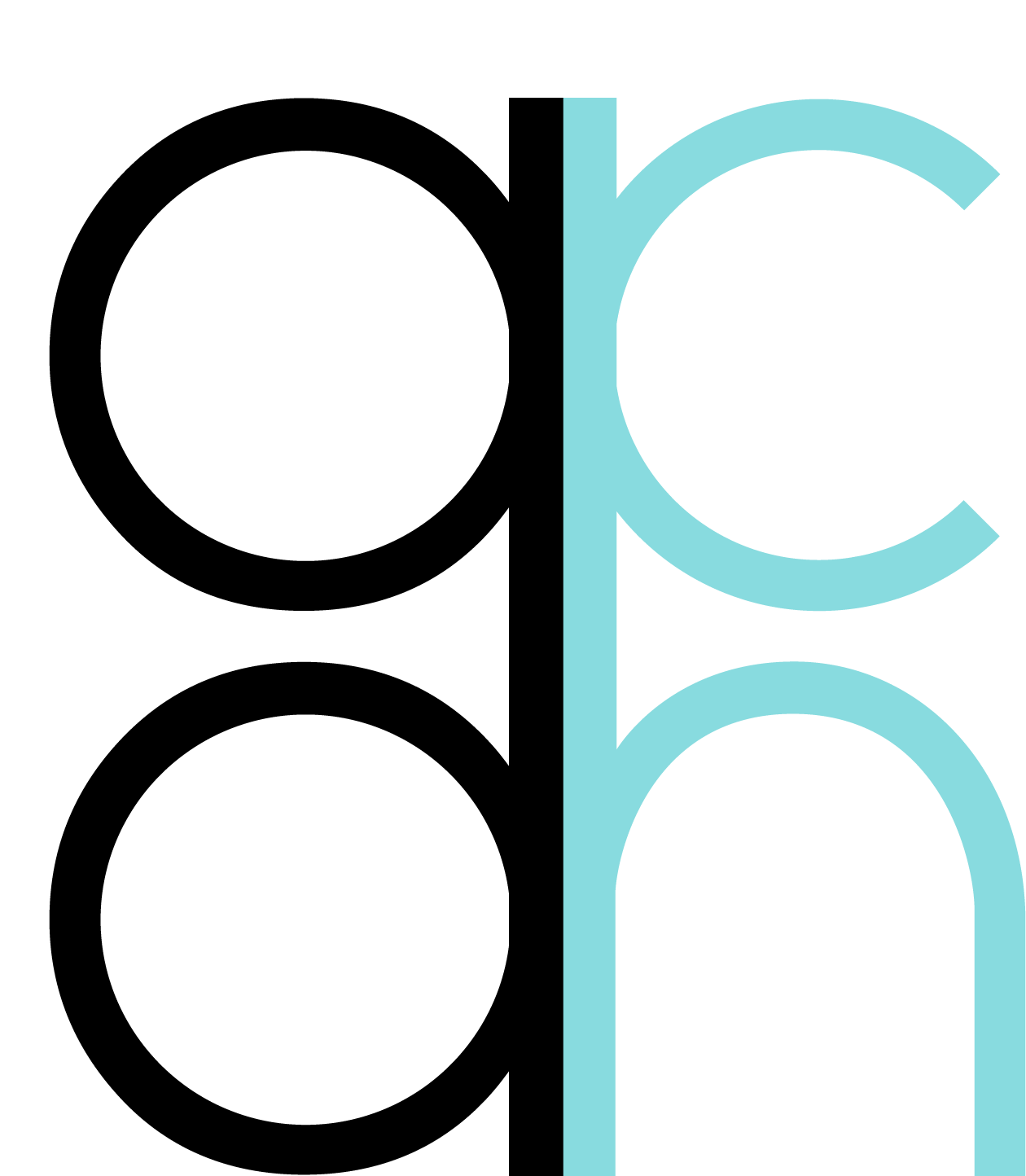Musiktheorie
Bezeichnet das Erkennen, systematische Erfassen und Lehren von Grundlagen, Erscheinungsformen und Gesetzmäßigkeiten der Tonkunst. Im Laufe der Geschichte hat es dabei mehrfach Begrenzungen und Erweiterungen der Wortbedeutung gegeben: von einer breitgefächerten philosophischen Grundlagendisziplin der Antike (verstanden im Sinne des griechischen θεωρία = Anschauung, Betrachtung, Einsicht) über die funktional eingeschränkte Handwerksausrichtung des 18. Jh.s bis zu einem weitgefassten Ästhetik-Verständnis seit dem 19. Jh. Zwar wurde der Begriff zumeist pragmatisch als Überlieferung von Erkenntnissen innerhalb und in Bezug auf die abendländische Musikgeschichte aufgefasst. Er hat sich dabei aber auch fortwährend auf außergeschichtliche Instanzen zur Rechtfertigung der eigenen Grundlagen berufen. Die u. a. durch Astronomie, Mathematik, Physik (Akustik) oder Theologie geprägte Geschichte der M. war mithin – insbesondere seit der Aufklärung des 18. Jh.s – von der beständigen Frage bewegt, ob es „zeitlose Beziehungen“ geben könne, „auf denen die Aktivitäten des erkennenden und erlebenden Subjekts beruhen“ (de la Motte-Haber). An der Verlockung, übergreifend gültige Prinzipien zu formulieren, hat sich die M. ebenso oft versucht wie sie daran scheiterte: Da „weder der Geschichts- noch der Musik- oder der Theoriebegriff unverrückbar feststehen“ (Dahlhaus), können lediglich die Sicht- und Sprechweisen der jeweils aktuellen Gegenwart zur Verständigung herangezogen werden, auch wenn sie im geschichtlichen Nachhinein unzulänglich und wandelbar erscheinen mögen.Ausgehend hiervon kann die auf den Bereich des heutigen Österreich verdichtete Geschichte der M. beschrieben werden: Die mittelalterliche Rezeption des antiken Musikverständnisses zielt zunächst wie vordem auf die Ergründung von akustischen, kosmologischen, physio- oder psychologischen Zusammenhängen der Musik und erfasst wesentlich erst mit der Entfaltung der Mehrstimmigkeit bis ins 17. Jh. die technischen Grundlagen und Bedingungen des polyphonen Komponierens. Zumindest die größeren österreichischen Klosterbibliotheken besitzen im Mittelalter das musiktheoretische Schrifttum bedeutender zeitgenössischer Autoritäten (so von Boethius, Bern v. Reichenau oder Hermannus Contractus; auch die Namen Alcuin, Calcidius, Macrobius, Cassiodor, Hucbald sowie die Musica enchiriadis erscheinen fallweise). Dabei sind unter den erhaltenen Traktaten bis etwa 1200 lediglich zwei Autoren vertreten (Guido v. Arezzo, Johannes v. Affligemensis), die sich auch mit dem improvisierten, über Verfahren der reinen Stimmparallelität hinausgehenden Organum beschäftigt haben. Von der in Paris um 1200 entwickelten modalrhythmischen Mehrstimmigkeit und ihrer eigens geschaffenen Notationsweise findet sich hingegen keine Spur. Die schriftliche Überlieferung liturgischer Mehrstimmigkeit setzt auf dem Gebiet des heutigen Österreich mithin erst vergleichsweise spät ein. Einer der wenigen namentlich bekannten österreichischen Autoren der Zeit um 1300 ist Engelbert v. Admont, dessen nahezu drei Dutzend Schriften zu theologischen, philosophischen und naturhistorischen Gegenständen zumeist kompilatorischen und traditionsbestimmten Charakter besitzen. Bemerkenswert erscheint freilich der Umstand, dass er (mit seinem Traktat De musica) allein der Musik unter den trivialen und quadrivialen Disziplinen eine eigene Behandlung zugesteht. Aber auch die an der Wiener Universität gelehrte M. verbleibt bis ins 16. Jh. hinein weitgehend abseits praktischer Entwicklungen der mittelalterlichen Überlieferung verhaftet. Sie prägt in dieser Gestalt auch noch die ersten musiktheoretischen Druckerzeugnisse, so etwa W. Khainers Musica choralis, das als einfache Chorallehre nur einen marginalen Einblick in die kompositorischen Techniken der Mehrstimmigkeit gewährt. Innerhalb der zeitgenössischen ästhetischen Theorie, die handwerkliche Anachronismen mit spekulativer Philosophie vereint (wie die aus der Wiener akademischen Praxis hervorgegangenen Musicorum libri quatuor des V. Philomathes), nimmt die Bedeutung der Musik als Lehrdisziplin schrittweise ab und führt um die Mitte des 16. Jh.s zur gänzlichen Streichung aus dem Unterrichtsplan der Wiener Univ.
Die offenkundige Unkenntnis und fehlende Reflexionsbereitschaft gegenüber den neuesten kompositorischen Techniken muss freilich eher als Zurückhaltung denn als Rückständigkeit gedeutet werden. In der zeitgenössischen Musikentwicklung lösen sich die Anforderungen an die praktische Anwendbarkeit offensichtlich so stark vom spekulativen Erfahrungsraum der Theorie, dass diese ihren Gegenstandsbezug einbüßt. Deutlicher an Gewicht gewinnt im folgenden Jh. entsprechend aber eine an zweckmäßigen Belangen ausgerichtete, zumeist nicht durch Druck verbreitete theoretische Unterweisung. Auch die gedruckten Generalbasslehren der 2. Hälfte des 17. Jh.s, so jene W. Ebner, J. J. Prinner oder A. Bertalli, beschränken sich weitgehend aufs praxisbezogene Anleiten. Eine in dieser Hinsicht erstaunlich bruchlose Spurlinie von Musiklehren lässt sich zwischen dem späteren 17. und dem frühen 19. Jh. von Ge. Muffat über M. Gugl, J. E. Eberlin, A. C. Adlgasser bis zu M. Haydn in Salzburg lokalisieren. Ge. Muffats in einer Abschrift von 1699 erhaltene Regulae concentuum partiturae stellen dabei die wichtigste deutsche Generalbasslehre des 17. Jh.s dar. Als Elementarmusik-, Generalbass-, Kompositions- und Chorallehre fassen sie das musiktheoretische Wissen und Können ihrer Zeit zusammen und bilden darin bereits die wesentliche Voraussetzung für eine weitere, nur wenig später entstandene Kompositionslehre: J. J. Fux' Gradus ad parnassum (1725), welche wohl die letzte ars poetica eines gleichermaßen als Komponist und Theoretiker tätigen Künstlers darstellen.
Ein traditionsorientierter Grundzug sowie das ausgesprochene Nahverhältnis zur künstlerischen Praxis prägt mithin die musiktheoretische Unterweisung im süddeutsch-katholischen Raum bis weit ins 18. Jh. hinein. Gegenüber den deutlich systematischen und lehrhaften Tendenzen des protestantischen Nordens sind es v. a. pragmatische Rücksichten, aus denen sich etwa Fux veranlasst sieht, auf Palestrina zurückzugreifen oder an den Techniken der Solmisation festzuhalten (was beispielsweise die scharfe Kritik Johann Georg Matthesons aus Hamburg hervorrief). Für Kompositionen und Unterrichtswerke erscheint hierbei ein selbstverständlicher Anspruch auf die insbesondere kirchenmusikalische Anwendbarkeit des Gelernten zu gelten, wie er in Stiften von Kremsmünster über St. Florian bis St. Pölten gepflegt wird. Die von der maria-theresianischen Schulreform 1774 auch nominell festgelegte Personalunion von Lehrern und Kirchenmusikern bestärkt zugleich den Zug zu einer methodisch konservativen Verfestigung innerhalb der Theorie. Die Öffnung gegenüber breiteren Publikumsschichten, die im 18. Jh. von englischen und französischen Ästhetikern ausgegangen war und später etwa in den Schriften des Wiener Aufklärers J. v. Sonnenfels zum Tragen kommt, setzt sich mithin zwar allmählich auch in Österreich durch: Ausdrücklich für Dilettanten verfasst ist so ein Lehrbuch J. F. Daubes aus den 1770er Jahren, das in gemeinverständlicher Form den Weg von der Generalbass-Begleitung über die Modulation zu Improvisation und Komposition schildert. Daube knüpft dabei aber inhaltlich kaum zufällig zugleich an seine frühere Schrift Der General-Baß in drey Accorden (Leipzig 1756) an, in der unabhängig von Jean-Philippe Rameau oder Friedrich Wilhelm Marpurg eine Tradition fortgesetzt wird, die auch noch den wichtigsten Musiktheoretiker Österreichs um 1800, J. G. Albrechtsberger, prägen sollte. Mit ihr wird die barocke Generalbasslehre (im Rückgriff auf Fux und die Salzburger Theorieüberlieferung) auch an breitere Interessentenkreise herangetragen, obgleich sie für das zeitgenössische Komponieren etwa der „Wiener Klassiker“ bereits wesentlich an Bedeutung zu verlieren beginnt. Insbesondere J. Haydn, aber auch W. A. Mozart (über Padre G. B. Martini) und L. v. Beethoven (über Albrechtsberger) lernen neben anderem noch Kontrapunkt in der Fuxschen strengen Satztradition, ungeachtet der zeitgenössischen Ablösung des melodiebegleiteten, später motivisch-thematisch beherrschten Satzbaus vom Generalbass.
Dass die musikästhetische Reflexion im Süden des deutschsprachigen Raums etwa gegenüber den nördlichen Zentren Leipzig, Berlin oder Hamburg eine geringere Rolle spielt, kann kaum allein auf eine „theorieferne süddeutsch-österreichische Musizierfreude“ (Finscher) zurückgeführt werden. Zwar besteht hier in der Tat vergleichsweise geringer Bedarf an den Erzeugnissen der im 18. Jh. entstehenden philosophischen Ästhetik; das auf Handwerklichkeit ausgerichtete musiktheoretische Schrifttum erweist sich aber auch nach Fux als breitgefächertes. Die unmittelbare Anwendungsbezogenheit fördert dabei zugleich die Kontinuität von Lehrer-Schüler-Linien, welche etwa die Fundamentalbass-Theorie von Fux über Albrechtsberger, J. Preindl, I. v. Seyfried bis zu S. Sechter und in Einzelheiten zu A. Bruckner und A. Schönberg weiterträgt. Das Fehlen richtungweisender musikästhetischer Abhandlungen in Wien vor 1850 kann als Symptom auch für die Ausrichtung der sich nach der Jh.mitte entfaltenden Ästhetik gelten: Mit E. Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen wird 1854 (im Umkreis von Denkern wie Johann Friedrich Herbart, R. Zimmermann oder B. Bolzano) eine Musikanschauung greifbar, die sich als „exacte Musikwissenschaft“ (Hanslick) versteht. Sie beansprucht (im bewussten Absetzen etwa gegenüber den späten Erben einer idealistischen Ästhetik wie Adolf Bernhard Marx oder Hugo Riemann) als Handwerksüberlieferung Geltung und schließt metaphysische oder psychologisierende Systematisierungen des Formbegriffs aus. Noch bei G. Adler als Nachfolger Hanslicks an der Wiener Univ. und dem eng mit diesem verbundenen Kreis der „Wiener Schule“ Schönbergs setzen sich die grundlegenden Vorbehalte gegen eine „Systemästhetik“ (Adler) zugunsten einer aus empirischer Erfahrung gewonnenen Grundlegung des Musikdenkens durch.
Dieser vergleichsweise undogmatische und vorrangig an handgreiflich kompositionstechnischen Belangen ausgerichtete Zusammenhang der Lehre trug dazu bei, dass sich in Österreich auch im 20. Jh. keine einheitliche musiktheoretische Schulenbildung entfaltet hat. Begünstigt wurde diese Entwicklung zudem durch äußere Umstände: So unterrichteten viele wichtige Lehrerpersönlichkeiten im Ausland – beispielsweise E. Kurth in Bern und F. Schreker (seit 1920) in Berlin – bzw. wurden (wie Schönberg, die bedeutenderen Schüler H. Schenkers oder Persönlichkeiten wie H. Keller) in den 1930er Jahren in die Emigration (Exil) gezwungen. Die Grundsätze einer handwerksorientierten und historisch fundierten, zugleich ästhetisch beweglichen Lehre freilich lassen sich auch weiterhin verfolgen: Schönberg, der bereits mit seiner Harmonielehre von 1911 als Kompositionslehrer keine allgemeingültigen „Gesetze“, sondern anwendungsbezogene „Gedanken“ zu vermitteln trachtete, hat in dieser Hinsicht noch im amerikanischen Exil bedeutende Wirkung als Lehrer entfaltet (hervorgegangen sind aus seiner dortigen Unterrichtstätigkeit auch eine Formen- bzw. eine Kontrapunktlehre für Anfänger). Österreichische Handwerkslehren – und nicht etwa Ästhetiken – der Zwölftonkomposition entstehen ab den 1940er Jahren, so von E. Krenek, J. Rufer oder H. Jelinek. Schönbergs bewegliche, empirisch ausgerichtete Denkhaltung wirkt etwa noch in R. Kolischs Theory of Performance, Kellers Functional Analysis, H. Swarowskys Taktgruppen-Analytik oder in E. Ratz' Formenlehre nach. Schenkers Hauptwerk Neue musikalische Theorien und Phantasien (1906–35) kommt mit seinem Verfahren eines für nahezu jede Komposition erschließbaren harmonischen „Ursatzes“ (aus linearen Einzeltönen) zwar erst spät zu Geltung. Verschiedene Schüler Schenkers, v. a. O. Jonas und F. Salzer, haben allerdings in den USA eine Lehrtätigkeit entfaltet, die bis heute (2004) den Grundstock für die einflussreiche Stellung der Ideen Schenkers innerhalb der amerikanischen music theory bildet.
In Österreich haben sich die Vorbehalte etwa gegenüber H. Riemanns Harmonie- und Formenlehre-Systematik bis in die 2. Jh.hälfte hinein gehalten; erst die Publikations- bzw. Lehrtätigkeit von Persönlichkeiten wie H. Grabner und D. de la Motte erweiterte die methodische Ausrichtung hier allmählich auch auf Riemanns Funktionstheorie. Bemerkenswert erscheint hingegen, dass noch um 1900 nahezu sämtliche bedeutenden Wiener Theorielehrer (von A. Zemlinsky und R. Fuchs bis zu Schreker und Schönberg) das streng an Fux ausgerichtete Kontrapunkt-Lehrbuch Heinrich Bellermanns verwendeten. Und in einer von der linearen Energie des Einzelklangs (und weniger seiner harmonischen Funktionslogik) bestimmten Tradition stehen noch so unterschiedlich ausgerichtete Musikdenker wie Kurth (mit seinen einflussreichen Grundlagen des linearen Kontrapunkts, 1917), E. Toch (Melodielehre, 1923) oder E. Tittel (Der neue Gradus, 1959). In Österreich ist es also nicht erst auf die seit dem 18. Jh. verlagerte Gesamtperspektive der M., die sich von generellen Aspekten des Tonsatzes auf das jeweils Besondere unwiederholbarer Einzelwerke bewegt, zurückzuführen, dass keine umfassenden Theorieentwürfe entstanden sind. Es erscheint vielmehr kaum als Zufall, dass eine strengstmöglich an der Regelüberlieferung ausgerichtete Lehre mit den so überaus neuerungsfreudigen Entwicklungen des österreichischen Komponierens seit Mitte des 18. Jh.s zusammentrifft: Gerade die gewissenhafte Beachtung handwerklich überlieferter Leitlinien hat das Verfolgen übergeordneter Systeme entbehrlich und die Kompositionspraxis für ebenso anpassungsfähige wie weittragende Änderungen offen werden lassen.
Literatur
MGG 6 (1997); K. Blaukopf in F. Stadler (Hg.), Wissenschaft als Kultur. Österreichs Beitrag zur Moderne 1997; MGÖ 1–3 (1995); D. Damschroder/D. R. Williams, Music Theory from Zarlino to Schenker. A Bibliography and Guide 1990; C. Dahlhaus in F. Zaminer (Hg.), Ideen zu einer Gesch. der M. 1985; H. de la Motte-Haber/P. Nitsche in H. de la Motte-Haber/C. Dahlhaus (Hg.), Systematische Musikwissenschaft 1985; C. Dahlhaus, Die M. im 18. und 19. Jh. Grundzüge einer Systematik 1984; F. Zaminer (Hg.), Gesch. der M. 1984ff; E. Tittel in M. Vogel (Hg.), Beiträge zur M. des 19. Jh.s 1966.
MGG 6 (1997); K. Blaukopf in F. Stadler (Hg.), Wissenschaft als Kultur. Österreichs Beitrag zur Moderne 1997; MGÖ 1–3 (1995); D. Damschroder/D. R. Williams, Music Theory from Zarlino to Schenker. A Bibliography and Guide 1990; C. Dahlhaus in F. Zaminer (Hg.), Ideen zu einer Gesch. der M. 1985; H. de la Motte-Haber/P. Nitsche in H. de la Motte-Haber/C. Dahlhaus (Hg.), Systematische Musikwissenschaft 1985; C. Dahlhaus, Die M. im 18. und 19. Jh. Grundzüge einer Systematik 1984; F. Zaminer (Hg.), Gesch. der M. 1984ff; E. Tittel in M. Vogel (Hg.), Beiträge zur M. des 19. Jh.s 1966.
Autor*innen
Matthias Schmidt
Letzte inhaltliche Änderung
14.3.2004
Empfohlene Zitierweise
Matthias Schmidt,
Art. „Musiktheorie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
14.3.2004, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001daa6
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.