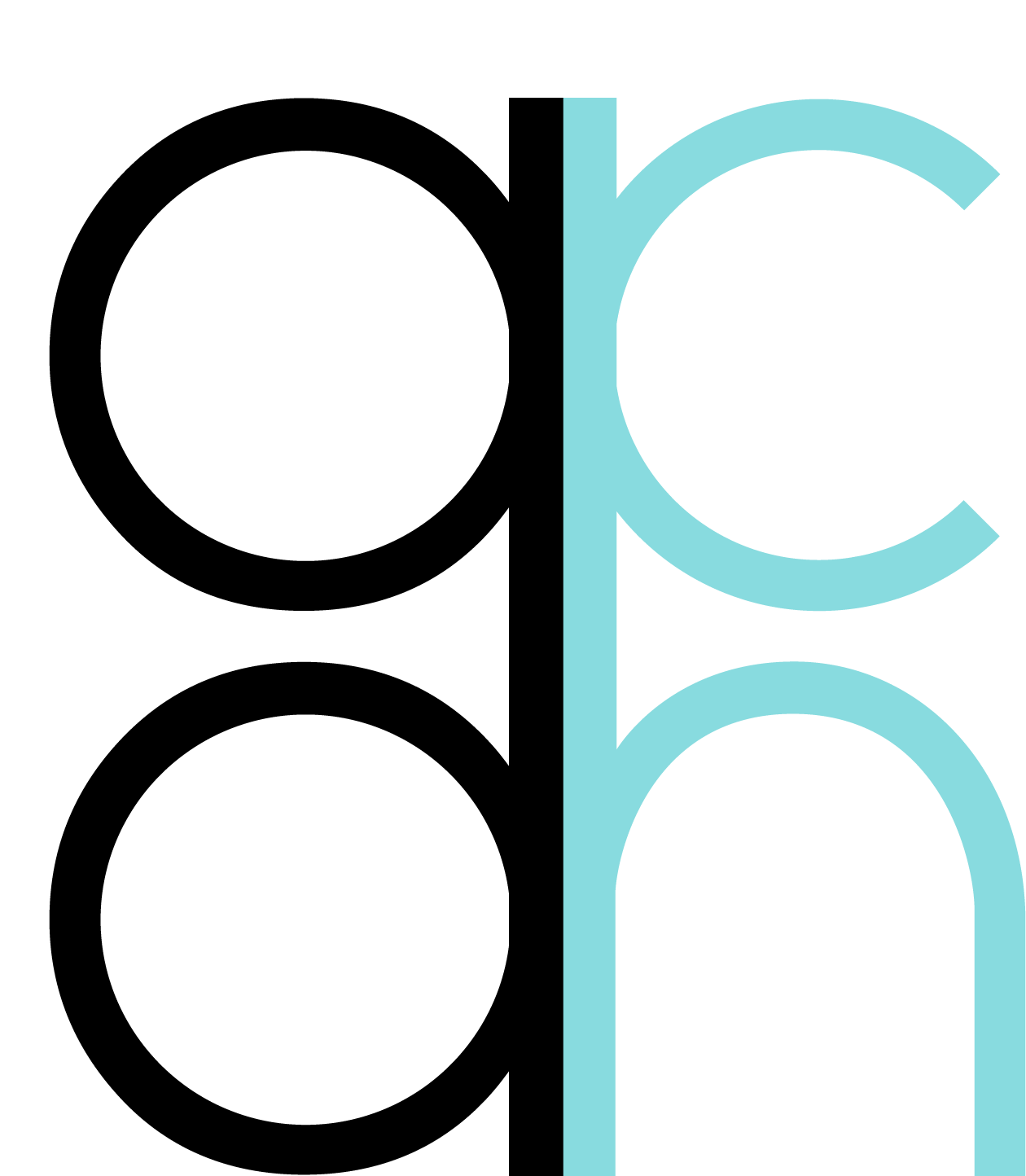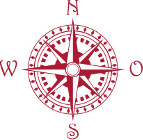Neumen
Notenzeichen, mit denen die einstimmige, in der Regel liturgische Musik (Choral) des europäischen Mittelalters aufgezeichnet wurde. Abendländische N. erscheinen erstmals in liturgischen Handschriften der 1. Hälfte des 9. Jh.s, die aufgezeichneten gregorianischen Melodien sind aber viel älter. Der Name wird von „neuma“ (Zeichen) oder „pneuma“ (Hauch) abgeleitet. Frühestens ab dem 11. Jh. gilt die Gleichsetzung „neuma“ = „nota“ (Notation).Je nach Zusammenhang kann der Terminus neuma entweder notationstechnisch (als graphisches Zeichen der Notation), als Begriff für melodische Figuren (z. B. Intonationsformeln und Vokalisen des Alleluja oder mancher Responsorien) oder als Begriff für eine musikalische Form (die chorisch gesungenen Schlussteile der Responsorien) gebraucht werden. Im Folgenden wird der Begriff N. in der Bedeutung als graphisches Zeichen verwendet. Der genaue Ursprung der N. ist ungewiss. Im Gegensatz zur karolingischen Minuskel, die als Buchstabenschrift für eine sehr große Schreiblandschaft verbindlich wurde, zeigen N. stets regionale Besonderheiten und bilden sog. N.familien. In Regionen mit bestimmten N.schriften können fremde Schriften (etwa durch Klosterneugründungen) oder durch Überlagerung gemischte N.schriften („Kontakt-N.“) entstehen. Man unterscheidet Akzent-N. (benannt nach dem vermuteten Ursprung aus den lateinischen Akzenten) und Punkt-N. (benannt nach der Zeichenform). Die N.schrift ist entweder adiastematisch (die N. geben über den genauen Tonhöhenverlauf keine sichere Information) oder diastematisch (die N. geben über den Tonhöhenverlauf sichere Information: „Tonortschrift“). Diastematische N. können ohne Linien „in campo aperto“ (relative Diastemie) oder auf Linien (entwickelt durch Guido v. Arezzo zu Beginn des 11. Jh.s) notiert werden. N. sind ikonisch in dem Sinn, als sie „höhere“ oder „tiefere“ Töne anzeigen, symbolisch (die Bedeutung basiert auf Konventionen) oder indexikalisch (indem sie auf eine bestimmte Artikulation einer Silbe hinweisen, z. B. in der Graphie der Liqueszenzen). Die Schriftrichtung der N. ist für jede Region charakteristisch und für die Bestimmung wichtig. Sie kann für die Wiedergabe von Tonschritten nach oben oder unten schräg oder senkrecht verlaufen. Zu unterscheiden ist die deskriptive Schrift (beschreibt, was gehört wird; Nach-Schrift) von der präskriptiven (normativen) Schrift (schreibt vor, was zu musizieren ist; Vor-Schrift).
Da die Melodien wesentlich älter als ihre ersten Aufzeichnungsweisen sind, muss mit mündlicher Überlieferung gerechnet werden, auch noch nach Einführung der N.notation. Die ältesten adiastematischen N.schriften dürften daher zunächst im Wesentlichen deskriptive Notationen sein, die nur oder gerade das ausdrücken, was sie bezwecken. Sie zeichnen einen melodischen Verlauf nach, der bestimmte Bewegungseinheiten vorstellt. Sie sind nur zu verstehen, wenn man die Melodie kennt, und dienen als „Kontrollnotation“. Die Übertragung der linienlosen N. ist daher nur mit Hilfe späterer Versionen auf Linien möglich. Eine Übertragung ohne Informationen, welche die N.schriften enthalten, zu unterdrücken, ist problematisch.
Die Entwicklung der N.schrift im heutigen österreichischen Raum verlief bei allen Skriptorien relativ einheitlich. Die verwendeten adiastematischen N. gehörten dem im gesamten süddeutschen Raum verwendeten deutschen Typ an. Diese kurzschriftartigen Zeichen stehen oberhalb des Textes. Sie geben keine exakten Tonhöhen an, sondern lediglich den ungefähren Verlauf der Melodie und ähneln den grammatischen Akzent- und Interpunktionszeichen für die Textaussprache. Ein N.zeichen kann für einen oder mehrere Töne stehen. Auch kann eine Neume aus mehreren Zeichen zusammengesetzt sein. Aus neumierten Handschriften wurde nicht gesungen oder dirigiert. Sie dienten in erster Linie als Belegexemplare und zum Nachschlagen.
Bis zum 11. Jh. sind in Österreich nur vereinzelte Fragmente überliefert, so eine der ältesten N. für Gesänge des Offiziums, ein Antiphonarfragment ÖNB, Cod. ser. nov. 3645, 2. Hälfte des 9. Jh.s, süddeutsch, sehr selten mit N. des Typs von St. Gallen mit rhythmischen Zusatzzeichen (z. B. Salzburg, Nonnberg, Cod. 23 C 13, Schutzblatt, oder Klosterneuburg, Stiftsbibliothek CCl 987, das sog. „Gebetbuch“ des Hl. Leopold). Doch ist die Herkunft der Fragmente nicht gesichert. Ab dem 11. Jh. sind einzelne Denkmäler in Deutschen N. nachweisbar, z. B. das Graduale-Sequentiar-Sakramentar-Lektionar ms. 2235 (o. ms. lat. III 124) der Biblioteca Marciana in Venedig, das wahrscheinlich aus einem von Stift Nonnberg abhängigen Augustiner- oder Kollegiatstift in Kärnten, vielleicht St. Georgen am Längsee stammt, oder das Breviarium Cod. Michaelbeuern Man. perg. 6 (um 1100 oder Beginn des 12. Jh.s, vielleicht aus dem Kollegiatstift Mattsee). Erst im 12. Jh. vermehren sich die Quellen im Zuge der Reorganisation bzw. Neugründung von Klöstern und Chorherrenstiften. Typisch für die linienlosen N. des 13. und 14. Jh.s v. a. auf dem Gebiet der alten Passauer Diözese sind hohe schmale Zeichen, die eine Minuskel um das Doppelte übersteigen, eine oben spitze Virga mit leicht gebogenem Schaft und ein Pes mit geschlossenem Haken („Passauer Duktus“). Die Schriftlinie ist oft vollkommen waagrecht.
Spätestens seit Beginn des 12. Jh.s entsteht im Umfeld der Benediktinerklöster, die sich der Hirsauer Reform angeschlossen hatten, eine Schreibweise der Deutschen N., die es ermöglicht, unter Anwendung von Hilfszeichen, wie Episemata, Oriscusgraphien oder Buchstaben, zumindest Halbtonintervalle zweifelsfrei festzulegen. So bedeutet eine episemierte Virga in diesen Handschriften stets einen Ton über einem Halbtonintervall (c, f, b). Eine Clivis oder ein Torculus mit Episem geben einen Halbtonschritt nach unten wieder (z. B. c h, f e, a c h, e f e usw.). Zu Handschriften mit N. dieses Typs gehören u. a. ein Graduale vom Nonnberg (D-Mbs clm 11004, 1. Hälfte d. 12. Jh.s), das bekannte Antiphonar von St. Peter in Salzburg (ÖNB Ser. nov. 2700, um 1160) und das Graduale der Petersfrauen (A-Ssp a IX 11 vom Ende des 12. Jh.s). Viele dieser Handschriften stammen aus Klöstern, welche die Hirsauer Reform angenommen hatten. N. mit melodischer Zusatzbedeutung findet man bis ins 14. Jh. (so in clm 15730, Süddeutschland oder Österreich).
Bis zum 14. Jh. wurde nur unter besonderen Umständen eine Notation auf Linien gebraucht. Die Quadratnotation ist aus den offiziellen liturgischen Büchern unserer Zeit bekannt. Die Bezeichnung rührt daher, dass die Mehrzahl der Töne durch ausgefüllte Quadrate wiedergegeben werden. Diese Notation wird v. a. in romanischsprachigen Ländern verwendet. Im österreichischen Raum ist sie ursprünglich nicht heimisch. Ausnahmen bilden schon in früherer Zeit Klöster zentral gelenkter Orden, die ihre Notationsweisen nach den Mutterklöstern ausrichteten, wie die Dominikaner, Franziskaner, Augustiner-Eremiten, Prämonstratenser und später auch die Kartäusermönche. Sie konnten (wie im Prämonstratenser Chorherrenstift Wilten) eigene Charakteristika ausbilden. Die Zisterzienser gebrauchten eine Notation, die sich von den zentralfranzösischen N. herleitet, wie sie in der Region von Cîteaux bei Dijon/F, dem Ursprungsort des Ordens, verwendet wurde. Die Augustiner Chorherren hingegen bedienten sich entweder der Schrift der jeweiligen Region, in der sich das Kloster befand, so in Klosterneuburg bis zum 1. Drittel des 14. Jh.s der Deutschen N., z. B. A-Wn 13314, einem Graduale-Sequentiar-Sakramentar mit Deutschen N. um 1150 aus Klosterneuburg (Schmidt, F. K. Praßl) oder St. Nikola bei Passau (Flotzinger). Daneben entwickelten sie im 12. Jh. eine Notation auf Linien, die nach dem Aufbewahrungsort eines großen Teils der Quellen (18 Hss. und einige Fragmente) als „Klosterneuburger Notation“ bezeichnet wird und ebenfalls bis ins 14. Jh. Verwendung fand. Es handelt sich dabei um einen Mischtypus zwischen Lothringischen (Schriftrichtung, Uncinus als Einzelneume) und Deutschen N. (z. B. Strophici) auf vier Linien mit vier Schlüsselbuchstaben. Hauptvertreter ist das Graduale Graz, UB 807 aus dem 12. Jh. (nach Flotzinger aus St. Nikola). Von wem und für welchen Ort die einzelnen Handschriften geschrieben wurden, ist allerdings nicht immer sicher festzustellen, zumal die älteren Quellen verschiedene liturgische Ordnungen und Melodiefassungen enthalten. Beispiele für frühgotische lothringische N. (nach Stäblein „Metzer Notation der 2. Epoche auf Linien“) sind seltener, z. B. das Antiphonar Salzburg Nonnberg Cod. 28 C 15 (o. 26 E 1b) (nach 1320).
Erst im 14. Jh. erfolgte allgemein die epochale Umstellung auf Liniennotation und damit die letztgültige Festlegung der relativen Tonhöhen. Ein wesentlicher Grund für das Beharren auf linienlosen N. war wohl, dass die im liturgischen Gesang zu dieser Zeit gesungenen chromatischen Töne nicht auf Linien übertragen werden konnten. Die Liniennotation ließ ja nur die Alteration von b-durum in b-molle zu. Die Umstellung bedeutete auch nicht, dass die linienlosen N. in Vergessenheit gerieten. So werden in einem Antiphonar aus Wilten (Cod. 710 der UB Innsbruck, um 1300) adiastematische N. und Quadratnotation nebeneinander gebraucht. Die Kenntnis der linienlosen N. blieb noch bis ins 15. Jh. erhalten. Am wichtigsten war ihre Anwendung bei Lektionszeichen für den Gesang von Lesung und Evangelium. Verwendet wurden v. a. Punctum, Virga und Pes.
Im Allgemeinen wurde in Österreich die aus den adiastematischen N. der Lothringischen Notation entwickelte sog. Gotische Choralnotation eingeführt. Eine Ausnahme bildet etwa Kremsmünster, wo auch Quadratnotation verwendet wurde. Ab dem 15. Jh. vergrößert sich die Anzahl der erhaltenen Quellen beträchtlich. Zunehmend werden auch auswärtige Schreiber herangezogen, die ihre eigenen Traditionen mitbringen. Die ostländische Notation – auch als „östliche“ oder „böhmische“ bezeichnet (Stäblein) – ist eine besondere Ausprägung der Gotischen Notation, bei der v. a. der Pes mit durch einen Schrägstrich verbundenen Puncta notiert wird. Der gotischen Notation sehr ähnlich ist die in Österreich allerdings seltene sog. Hufnagelnotation mit Notenformen, die sich aus den adiastematischen Deutschen N. ableiten, und deren Grundneume daher die Virga (Einzelnote mit Schaft) und nicht die Raute (Einzelnote ohne Schaft) ist. (In der Literatur, besonders in der älteren, wird hingegen die Gotische Notation meist als Ganzes als „Hufnagelnotation“ bezeichnet.). Im 15. Jh. übernahmen einige Klöster, welche die Melker Reform eingeführt hatten (z. B. Melk, St. Peter u. a.), in Anlehnung an die in Subiaco/I verwendete Notation die Quadratnotation.
Eine besondere Notationsweise ist die semimensurale Notation. Mit einfachen Zeichen (Verdopplung oder Längung einer Note, Abfolge von Rhomben und Quadraten, Zeichen aus der Mensuralnotation, v. a. die Minima) wird eine Verdopplung oder Halbierung eines Notenwertes angezeigt. So kann man einfache rhythmische Gegebenheiten wiedergeben, etwa bei Hymnen, rhythmisierten syllabischen Choralmelodien („cantus fractus“) und bei Liedkompositionen, so beim Mönch v. Salzburg (D-Mbs cgm 715 aus der Mitte des 15. Jh.s und A-Wn 2856, Mondsee-Wiener Liederhandschrift) und bei Oswald v. Wolkenstein. Verschiedene Notationen können auch nebeneinander benützt werden. Im Sammelcodex Man. cart. 1 in der Stiftsbibliothek von Michaelbeuern (Salzburg, St. Peter, 1. Drittel des 16. Jh.s), der das Repertoire geistlicher Gesänge Salzburgs außerhalb von Graduale und Antiphonale enthält – darunter viele deutsche Lieder – sind die traditionellen bzw. diözesanen Gesänge in Gotischer Choralnotation, die aus der Melker Reform übernommenen Singweisen jedoch in Quadratnotation notiert. Im 17. Jh. übernimmt man, so man noch Handschriften anfertigt, die allgemein übliche nachtridentinische Choralnotation, wie sie auch in Drucken jener Zeit verwendet wird.
Literatur
B. Stäblein, Schriftbild der einstimmigen Musik 1975; J. Szendrei in Stud. mus. 27 (1985); R. Flotzinger in Stud. mus. 31 (1989); Beiträge von F. K. Praßl, St. Engels u. I. de Loos in MusAu 14/15 (1996); St. Engels in St. Engels/G. Walterskirchen (Hg.), [Kgr.-Ber.] Musica Sacra Mediaevalis. Geistliche Musik Salzburgs im Mittelalter. Salzburg 1996, 1998; St. Engels in Musikgesch. Tirols 1 (2001).
B. Stäblein, Schriftbild der einstimmigen Musik 1975; J. Szendrei in Stud. mus. 27 (1985); R. Flotzinger in Stud. mus. 31 (1989); Beiträge von F. K. Praßl, St. Engels u. I. de Loos in MusAu 14/15 (1996); St. Engels in St. Engels/G. Walterskirchen (Hg.), [Kgr.-Ber.] Musica Sacra Mediaevalis. Geistliche Musik Salzburgs im Mittelalter. Salzburg 1996, 1998; St. Engels in Musikgesch. Tirols 1 (2001).
Autor*innen
Stefan Engels
Letzte inhaltliche Änderung
16.5.2004
Empfohlene Zitierweise
Stefan Engels,
Art. „Neumen‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
16.5.2004, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001db2c
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.