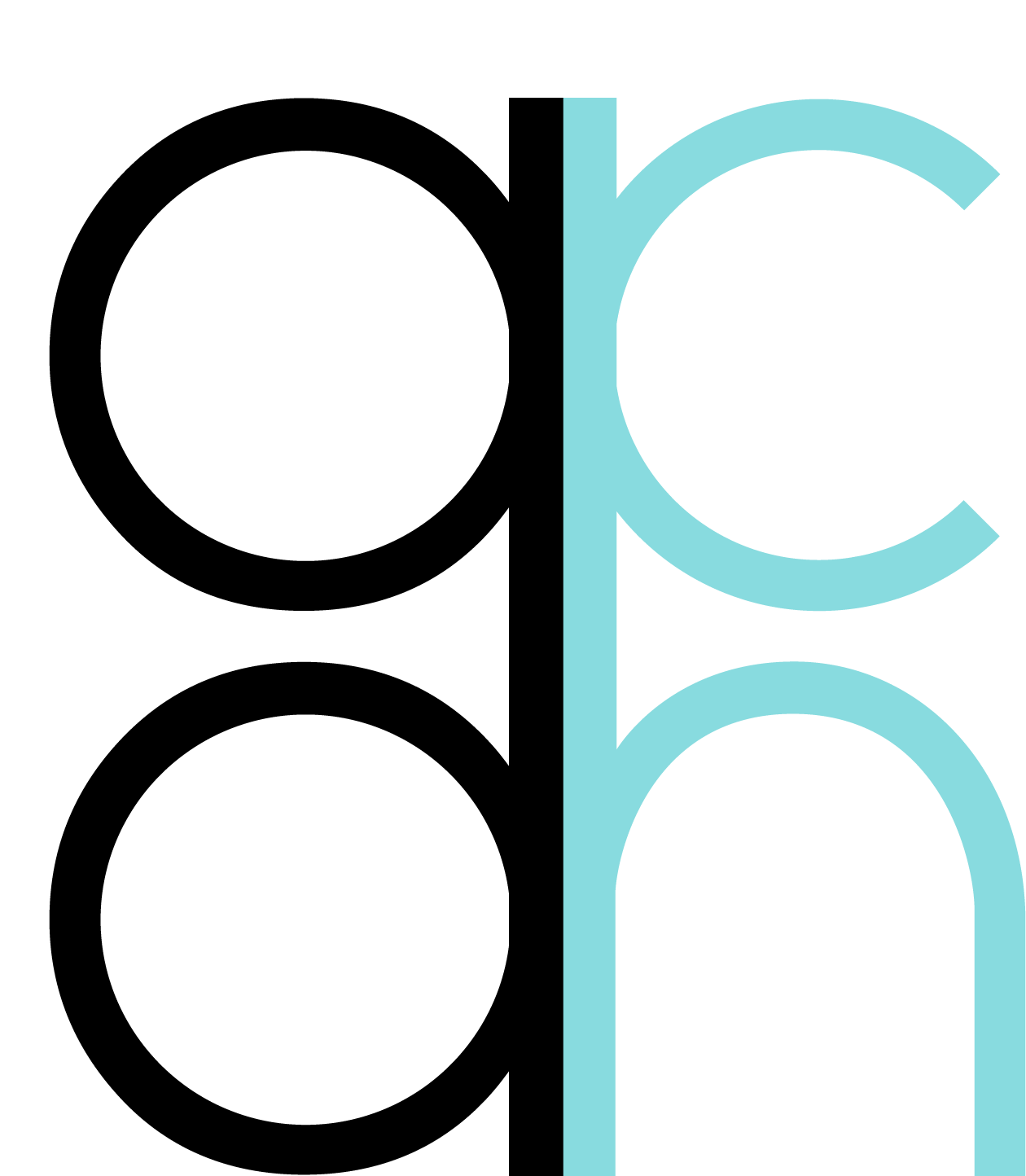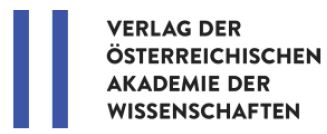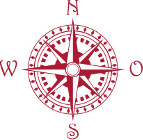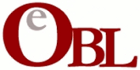Pachler,
Familie
Marie Leopoldine
(geb. Koschak):
* 2.2.1794 Graz,
† 10.4.1855 Graz.
Pianistin, Komponistin.
Stammte aus einem musikalischen Elternhaus, galt ursprünglich als pianistisches Wunderkind, trat jedoch nach 1811 nur mehr im privaten Bereich auf, für den auch ihre Kompositionen (heute weitgehend verloren) bestimmt waren. Nach ihrer Heirat (1816) wurde ihr Wohnhaus in der Grazer Herrengasse (Ecke Pfarrgasse) bis um 1830 Zentrum des Bildungsbürgertums. M. P. widmete sich besonders den Klavierwerken L. v. Beethovens und Fr. Schuberts, sie improvisierte aber auch „musikalische Porträts“, durch die sie anwesende Personen charakterisierte. Im Sommer wurde der Salon im Gut Sparbersbach („Hallerschloss“, heute Hallerschloss-Straße in Graz) fortgesetzt (1825, 1826, 1828–31). Die Historiker Julius Schneller, der wesentlich zur Bildung der jungen Marie beigetragen hatte, und A. v. Prokesch-Osten, Jugendfreund Maries, waren prägende Gäste des Hauses. Hinzu kamen A. Hüttenbrenner, A. Halm, Gottfried v. Leitner u. a. 1827 besuchte Fr. Schubert auf Vermittlung J. B. Jengers Graz und war vom 3.–20.9. Gast der Familie P. (Ausflüge mit „Schubertiaden“ zum Hallerschloss und zum Schloss Wildbach bei Deutschlandsberg). Fr. Schubert, der in Graz die „vergnügtesten Tage“ erlebte, widmete M. P. die Lieder Das Weinen D 926, Vor meiner Wiege D 927, Gesang („An Sylvia“) D 891. Heimliches Lieben D 922 und Eine altschottische Ballade D 923 komponierte Schubert in Graz. Zum Namenstag von K. P. (4.11.1827) entstand auf Wunsch M. P.s der „Kindermarsch“ in G-Dur für „Pianoforte zu 4 Händen“ D 928, auch Zwölf Grazer Walzer D 924 und Grazer Galopp D 925 sind im Zusammenhang mit Schuberts Aufenthalt in Graz zu sehen.M. P.s persönliche Beziehung zu Beethoven ist in Briefen und zwei Treffen (1817 und 1823) belegbar. Der oft zitierte Ausspruch Beethovens über M. P.: „Ich habe noch niemand gefunden, der meine Compositionen so gut vorträgt, als Sie, […] Sie sind die wahre Pflegerin meiner Geisteskinder“ gilt neueren Forschungen zufolge als Fälschung (Beethoven Briefwechsel GA 1996).
M. P. kann als die bedeutendste Frau im Grazer Geistesleben der Biedermeierzeit bezeichnet werden. Ihre Begabung als Musikerin, ihre hohe Bildung und ihre familiären bzw. gesellschaftlichen Verbindungen waren die Voraussetzungen für ihre Funktion im sozio-kulturellen Netzwerk ihrer Zeit. Die Bedeutung dieser Funktion ist besonders auch im Zusammenhang mit dem kulturellen Austausch zwischen Graz und Wien zu sehen. Ihr Ehemann
Karl: * 4.11.1789 Graz, † 22.10.1850 Graz. Advokat, Brauereibesitzer. Versuchte erfolglos eine Aufführung von Schuberts Oper Alfonso und Estrella D 732 zu vermitteln. 1835 nahm das Ehepaar P. Friedrich Kaltenegger (1820–92), den späteren Landeshauptmann von Krain, als Adoptivsohn auf.
Gedenkstätten
P.weg (Graz XI).
P.weg (Graz XI).
Deren Sohn Faustus (Faust; Pseud. C. Paul): * 18.12.1819 Graz, † 5.9.1891 Graz. Jurist, Lyriker, Dramatiker, Erzähler, Übersetzer. Erhielt Klavierunterricht von seiner Mutter, studierte Rechtswissenschaften (Dr. Wien 1844) und wurde 1843–86 Beamter an der Wiener Hofbibliothek; verfasste Romane, Gedichte, Dramen. Herausgeber der Werke F. Halms. Auch mit Marie von Ebner-Eschenbach und F. Grillparzer befreundet. 1851 Heirat mit Jenny zur Helle. Zog sich 1889 auf den Familienbesitz Panoramahof, Graz (Rosenberg), zurück.
Schriften
Beethoven u. M. P.-Koschak. Beiträge und Berichtigungen 1866.
Beethoven u. M. P.-Koschak. Beiträge und Berichtigungen 1866.
Literatur
G. Locher, Der Salon M. P.s – ein Beitrag zur österr. Elitenforschung, Diss. Graz 1990; ÖBL 7 (1978); W. Aderhold in E. Badura-Skoda et al. (Hg.), Schubert und seine Freunde 1999; S. Brandenburg (Hg.), Ludwig van Beethoven, Briefwechsel GA 1996; K. Dieman-Dichtl, Schubert auf der Reise nach Graz 1997; Deutsch, Schubert Dokumente 1964; Th. Gorischek, Franz Schubert (1797–1828): Sein Freundeskreis. Seine Beziehung zu Graz 2000; W. Häusler in Jb. d. Vereins f. Gesch. der Stadt Wien 34 (1978); R. v. Hoorickx in Musical Times 122/1659 (1981); H. Lohberger in Bll. f. Heimatkunde 36 (1962) u. 39/1 (1965); M. Raffler, Dt.sprachige Lesegesellschaften am Beispiel des von Erzhzg. Johann begründeten Lesevereins am Joanneum (1819–1871), Diss. Graz 1988; M. Raffler in H. Stekl et al. (Hg.), „Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit“. Bürgertum in der Habsburgermonarchie 2 (1992); Wurzbach 21 (1870); StMl 1962–66; SchubertL 1997.
G. Locher, Der Salon M. P.s – ein Beitrag zur österr. Elitenforschung, Diss. Graz 1990; ÖBL 7 (1978); W. Aderhold in E. Badura-Skoda et al. (Hg.), Schubert und seine Freunde 1999; S. Brandenburg (Hg.), Ludwig van Beethoven, Briefwechsel GA 1996; K. Dieman-Dichtl, Schubert auf der Reise nach Graz 1997; Deutsch, Schubert Dokumente 1964; Th. Gorischek, Franz Schubert (1797–1828): Sein Freundeskreis. Seine Beziehung zu Graz 2000; W. Häusler in Jb. d. Vereins f. Gesch. der Stadt Wien 34 (1978); R. v. Hoorickx in Musical Times 122/1659 (1981); H. Lohberger in Bll. f. Heimatkunde 36 (1962) u. 39/1 (1965); M. Raffler, Dt.sprachige Lesegesellschaften am Beispiel des von Erzhzg. Johann begründeten Lesevereins am Joanneum (1819–1871), Diss. Graz 1988; M. Raffler in H. Stekl et al. (Hg.), „Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit“. Bürgertum in der Habsburgermonarchie 2 (1992); Wurzbach 21 (1870); StMl 1962–66; SchubertL 1997.
Autor*innen
Ingeborg Harer
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2005
Empfohlene Zitierweise
Ingeborg Harer,
Art. „Pachler, Familie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2005, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001dc24
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.