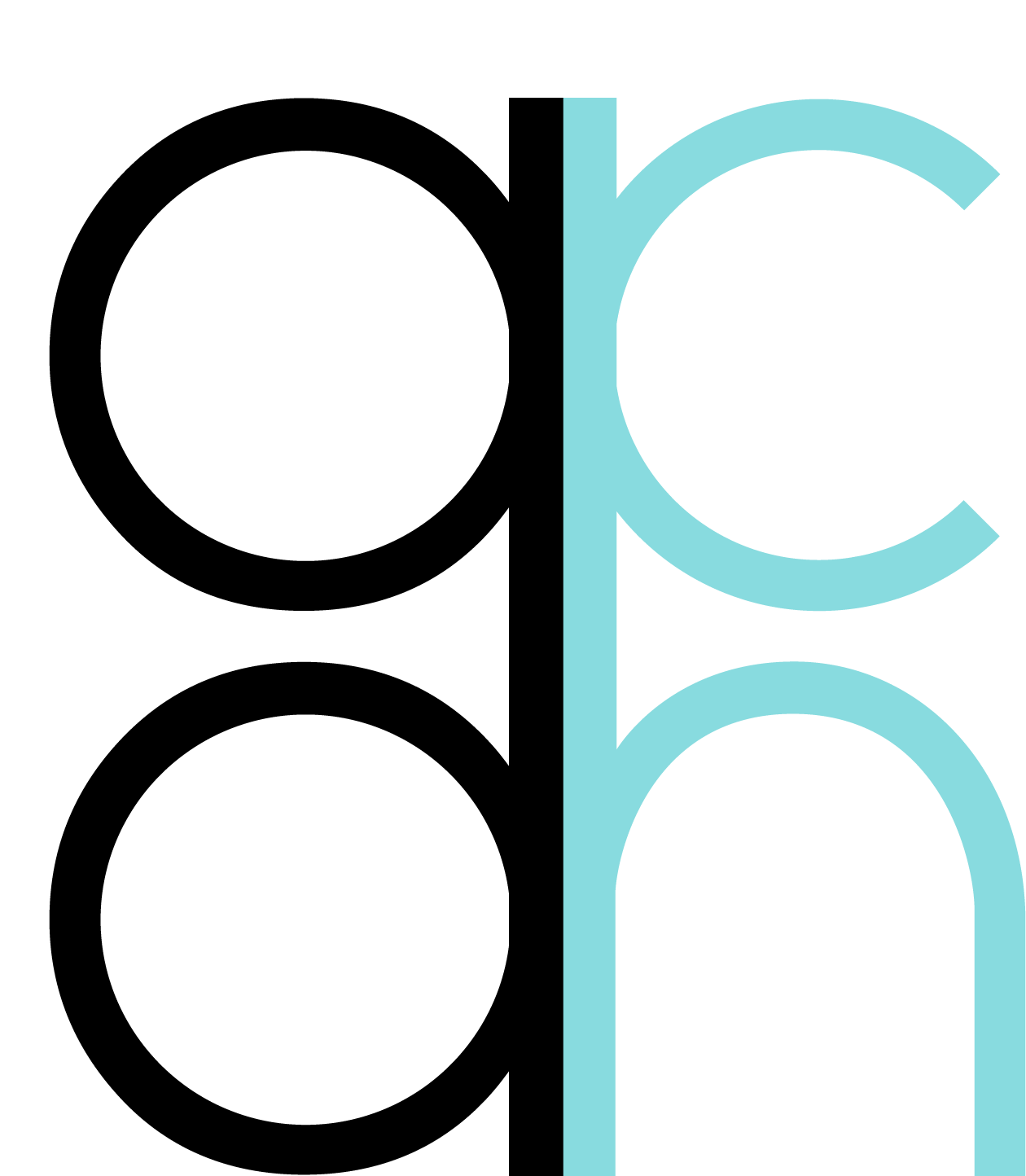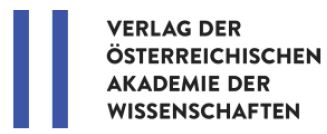Polonaise
(polonoise, polonelle, polonesse, polonez u. a.)
Eine sowohl im Gesellschafts- als auch im theatralischen Tanz bedeutsame Tanzform, mit der charakteristischen rhythmischen Figur: 1 Achtel- + 2 Sechzehntel- + 4 Achtelnoten. Choreographisch definiert sich die P. als Prozessions- bzw. Aufzugstanz. Eine angeblich vom polnischen Adel anlässlich der Krönung Heinrichs III. von Anjou zum polnischen König 1572 in Warschau aufgeführte Ur-P. soll geradtaktig gewesen sein.Die musikalischen Quellen (z. B. Chr. Loeffelholz v. Colberg, Tabulaturbuch 1585, Virginia Renata v. Gehema, Lautenbuch, ca. 1640, Sperontes Singende Muse an der Pleisse, Leipzig 1736â45, Johann Philipp Kirnberger, Der allzeit fertige Polonaisen- und Menuettencomponist, Berlin 1757) lassen vier Entwicklungsphasen des Tanzes erkennen: im 16. Jh. Entstehung und Ausbildung eines geradtaktigen polnischen Tanzes mit Nachtanz bzw. Proporz; in der 1. Hälfte des 17. Jh.s Aufwertung des Proporz durch Ãbernahme polnischer Musikelemente; 2. Hälfte des 17./Anfang 18. Jh. Verselbständigung des Proporz, der nunmehr mit seinem charakteristisch rhythmisierten Tripeltakt eine einfache P. repräsentiert; schlieÃlich im Verlauf des 18. Jh.s Vervollkommnung der Form unter Mitwirkung von Komponisten diverser Nationalität. P.n finden sich bereits in den Werken von G. F. Händel, Georg Philipp Telemann, J. S. Bach und der Bach-Söhne; bekannte Belege im Schaffen der Wiener Klassiker sind etwa W. A. Mozarts Rondeau en polonaise in der Klaviersonate in D, KV 284 (1775), L. v. Beethovens Serenate in D, op. 8. Die P., die v. a. in der Romantik äuÃerst beliebt war, fand in F. Chopins Schaffen ihre höchste Sublimierung.
Choreographisch ist die P. durch ihre Funktion als âgravitätischeâ, feierliche Eröffnung groÃer Ball- und Festveranstaltungen geprägt, d. h. sie besteht aus einem prozessionsartigen Aufzug der Paare, der durch diverse â meist aus Kontretanz- (Countrydance) und Quadrilleformationen übernommene Figuren verfeinert werden kann. Das Schrittmaterial ist in Hinblick auf eine groÃe Teilnehmerzahl sehr einfach (traditionell bestehend aus einem gebeugten und zwei gehobenen Schritten mit verfeinernden Varianten). Die choreographische Aufzugs- bzw. Prozessionsform der P. wurde auch in das klassische Ballett übernommen.
Literatur
MGG 7 (1997).
MGG 7 (1997).
Autor*innen
Sibylle Dahms
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2005
Empfohlene Zitierweise
Sibylle Dahms,
Art. „Polonaise (polonoise, polonelle, polonesse, polonez u. a.)‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2005, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001dd73
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.