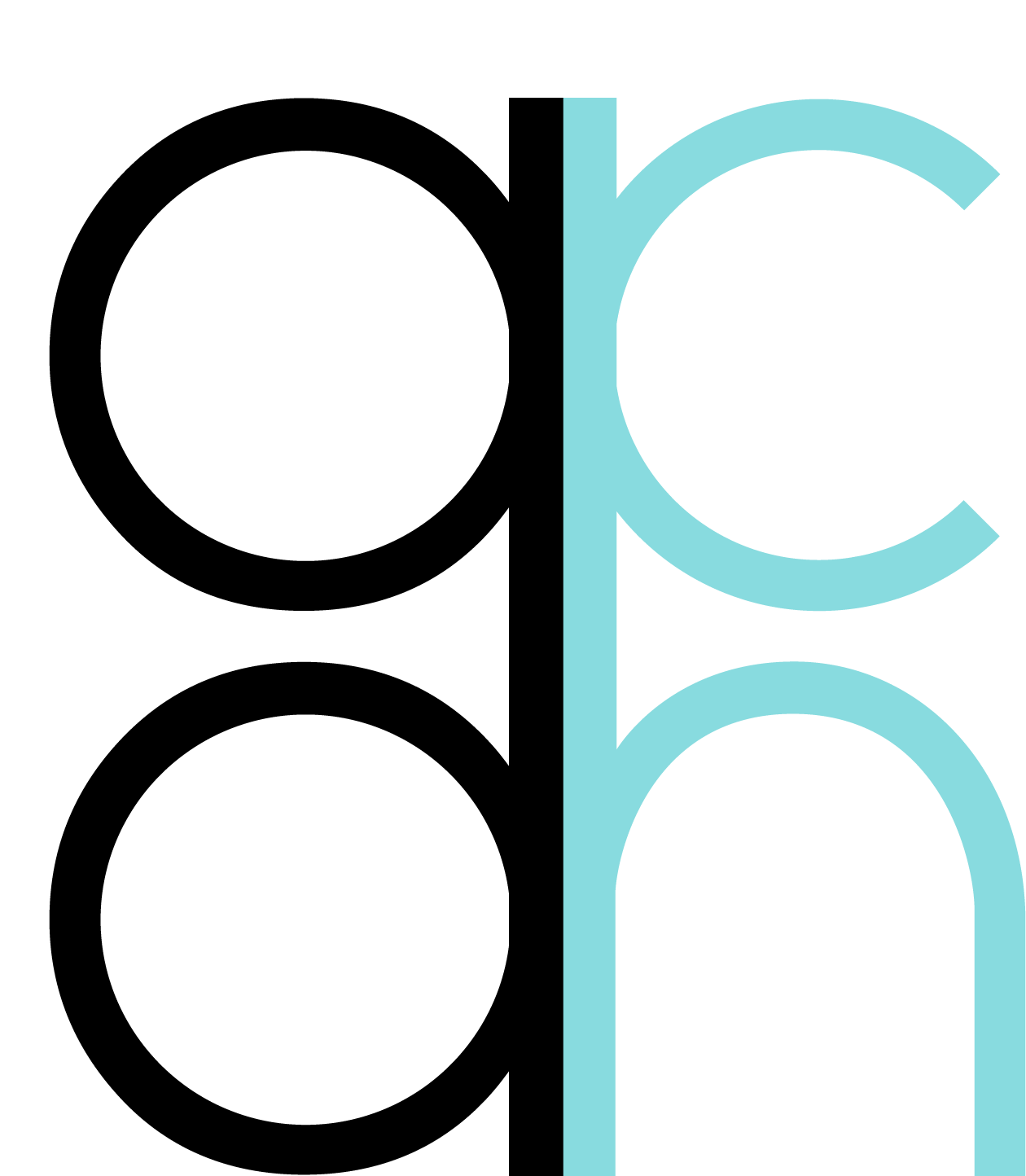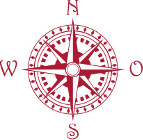Publikum
Hier die öffentliche (lat. publicus, d. h. nicht grundsätzlich eingeschränkte, z. B. nur an den Erwerb einer Eintrittskarte gebundene) Zuhörerschaft einer musikalischen Darbietung. Analoge Gruppen (Zuseher, Teilnehmer usw.) sind zwar auch in vielen anderen Bereichen schon seit langem bekannt (z. B. bei religiös-kultischen, sportlichen Veranstaltungen, doch gelten dafür nicht unerheblich unterschiedliche Regeln: z. B. ist die Teilnahme an kultischen Handlungen meist auf passiv-staunende Beobachtung beschränkt, sind hingegen bei Wettkämpfen Parteinahmen möglich und damit im Extremfall sogar Ausschreitungen gewissermaßen vorprogrammiert), während bei Theater und Musik innerhalb gewisser (ästhetischer) Rezeptionsnormen durchaus individuelle Reaktionen möglich sind und normalerweise auch toleriert werden. Die größte Vergleichbarkeit besteht mit den Zusehern theatralischer Aufführungen, doch ist die oftmals vorgenommene Ausweitung des Begriffs P. auf alle Rezipienten (= Aufnehmende, Hörer) von Musik entweder (bei informationstheoretischer Argumentation nach dem einfachen Modell Sender – Empfänger) unzulässig oder (wenn man Musik als ein Kommunikations-, d. h. Interaktionssystem versteht) einseitig. V. a. handelt es sich um ein relativ junges Phänomen, das zwei Momente voraussetzt, die keineswegs immer gegeben waren/sind: die mit Hörern rechnende (wenn schon nicht dezidiert auf sie gerichtete) Aufführung einerseits und (ebenfalls zumindest mögliche) Öffentlichkeit andererseits.Im Gegensatz zum Theater, das per definitionem Zuschauer voraussetzt, sind die musikalischen Analoga (Konzert bzw. Zuhörer) im Wesentlichen Kinder des 18. Jh.s, in Österreich v. a. der Aufklärung (Joseph II., bürgerliche Musikkultur) und außerdem an spezielle Präsentationsformen gebunden. Hingegen lassen die seit dem 20. Jh. gegebenen Möglichkeiten der technischen Reproduzierbarkeit (Medien, Rundfunk, Schallplatte, Tonband, CD usw.; Tonträger) nur bedingt von P. sprechen: entweder von bloßen Rumpfformen (weil mehr oder weniger individualisiert) oder überhaupt von Abstrahierungen, sowohl der Hörerschaft als auch der Musikkonserve als bestenfalls einem Pendant zur (stattgefundenen [= live] oder im Aufnahmestudio fiktiv vorgenommenen und zunehmend technisch veränderten, insbesondere perfektionierten) Aufführung. Die allein dadurch bedingten Veränderungen des Hörens werden als „Mediamorphose“ zusammengefasst (K. Blaukopf).
Zu bedenken ist v. a., dass Hören zwar wesentlich zur Musik gehört (nämlich deren intendierter Zweck ist und durch Spontanreaktionen zu einer Art Wechselwirkung zwischen Musiker und Hörer führen kann), die intendierten Hörer aber nicht immer öffentliche, ja nicht einmal Menschen sein müssen. Z. B. ist das Hören der Musiker während ihrer Tätigkeit nicht nur ein unverzichtbares Kontrollmittel, sondern kann beim „Spielen für sich selbst“ sogar das eigentliche Ziel darstellen. (So wurde im 18. Jh. das Streichquartett-Spiel als musikalische Unterhaltung der vier Spieler idealisiert; dies wiederum wird oft auf jegliche Kammermusik projiziert.) Das Ziel von Musik z. B. im Rahmen religiöser Kulte ist primär das vorgestellte Gehörtwerden durch die Gottheit, in einer Reihe anderer Fälle handelt es sich um einen Bestandteil komplexerer Zusammenhänge oder schließlich bloß um die Begleitung bestimmter Tätigkeiten (z. B. Tanz, Arbeit, Arbeitslied). Sodann wurde ein großer und wird noch immer ein ansehnlicher Teil von Musik nur für eine bestimmte, gerade nicht öffentliche Zuhörerschaft gemacht: z. B. höfische Kunstmusik, Volksmusik (bei der die Gemeinsamkeit aller Beteiligten im Vordergrund steht); ja in gewissem Sinne könnten überhaupt alle Zweck-gerichteten Musikformen hier subsumiert werden. Demgemäß unterschied man früher zwischen geschichtlich primärer, zweckgebundener Umgangs- bzw. sekundärer, von unmittelbaren Zweckfunktionen emanzipierter Darbietungsmusik. Auf Letztere wäre P. in besonderer Weise zu beziehen (absolute Musik). Übergangsformen sind wieder nicht zufällig erst nach der Aufklärung feststellbar (z. B. gewisse Abschnitte des klassischen Wiener Walzer-Zyklus, die zum Tanzen nicht geeignet sind). Der Begriff einer vermittelnden „Zwischenmusik“ hat sich bisher (2004) nicht durchgesetzt. Wohl aber wird die Kategorie „Übertragungsmusik“ zunehmend als zweckmäßig angesehen.
Gerade in Österreich ist neben dem Mittel der allgemeinen Verbreitung musikalischer Neuerungen und Bildung (Musikunterricht) für die Vorbereitung von Öffentlichkeit im obigen Sinn die Wirkung der figuralen Kirchenmusik und deren Promulgierung nach der Wiener Türkenbelagerung 1683 von den Städten bis in die Dörfer hinaus (Landmesse) nicht zu unterschätzen. Die Freude sowohl am Hören als auch Gehörtwerden hat zweifellos einen großen Anteil daran, dass obrigkeitliche Einschränkungsversuche in der 2. Hälfte des 18. Jh.s hier weitgehend unbeachtet blieben und zumindest Schwundformen der Hochkunst (Volksbarock) bis heute gepflegt werden. Argumentiert wird dabei längst nicht mehr mit dem Bestmöglichen, das man „Gott darbringen“ wolle (wie im Mittelalter), sondern schlicht mit dem angestrebten besonderen Festcharakter. (Nahe liegender Weise sollte daher auch mit einer „mittleren“ Ästhetik gerechnet werden.) Andererseits war das entstehende Musik-P. durch bereits traditionelle Formen geprägt, nicht zuletzt durch solche des Musiktheaters (Oper, Pantomime, Ballett, Puppentheater usw.). Insbesondere entspringt der seit dem frühen 19. Jh. allgemein durch Händeklatschen ausgedrückte Beifall keineswegs nur einem zunehmenden Warencharakter von Musik, der durch den allgemeinen Verkauf von Eintrittskarten (höfische Theater in Wien ab 1728) eingeleitet worden war. Applaus (von lat. ap- [= zu] plaudere [klatschend schlagen, klopfen]) ist durchaus als eine urtümliche Reaktionsform (ebenso wie z. B. Lachen für Zustimmung oder Gähnen für Ablehnung) zu verstehen, bereits im antiken Theater üblich und im Mittelalter (wohl abgeleitet von der Herrscher-Akklamation) selbst bei Predigten bekannt gewesen, im Übrigen auch keineswegs das einzige zusätzliche Zahlungsmittel des P.s (Starkult war dem 18. Jh. keineswegs unbekannt). Ruhe während der Aufführung und das Unterlassen anderer gleichzeitiger Tätigkeiten (Unterhaltung, Kartenspiel, Speisen etc.) hat sich im Konzert offenbar früher als im Theater allgemein durchgesetzt (wo sie um 1780 noch anzustrebende Ziele darstellten und erst um 1800 einsetzten): zweifellos als eine Stilisierungsform (die Interaktionen zwischen Ausführenden und Hörern waren naturgemäß subtiler), die aus ästhetischen Forderungen (Stichwort: absolute Musik) resultierte.
Die Entstehung des P.s ist nicht nur an Darbietungsmusik gebunden, sondern repräsentiert auch entsprechende Lebensverhältnisse (Publikumsforschung). Kein Zufall ist, dass sowohl der Bau von eigenen Konzertsälen als überhaupt der Aufbau eines „modernen“ Musiklebens als besonders wichtig angesehene Momente der Urbanisierung und der Identität in der Moderne wurden. Initiatoren und wichtige Träger waren v. a. die verschiedensten Musikvereine. Die komplementäre Verschiebung innerhalb derselben während des 19. Jh.s, nämlich die Abnahme der musikalisch aktiven Mitwirkung der Mitglieder als Musiker bei gleichzeitiger Vermehrung des möglichen passiven (= nur mehr hörenden) P.s, spiegelt die skizzierten Verhältnisse wider. (Analoges ist übrigens heute in der sog. Dritten Welt zu beobachten.) Einen ähnlich bedeutsamen Schritt hatte zuletzt die Einführung des Rundfunks in den 1920/30er Jahren markiert (zahlenmäßige Erweiterung des P.s, Schaffung eigener Musikformen wie z. B. die sog. gehobene oder symphonische Unterhaltungsmusik).
Literatur
K. Blaukopf, Musik im Wandel der Ges. Grundzüge der Musiksoziologie 1982; G. Tanzer, Spectacle müssen seyn. Die Freizeit der Wiener im 18. Jh. 1992; H.-W. Heister, Das Konzert. Theorie einer Kulturform 1983; H. Kindermann, Die Funktion des P.s im Theater 1971; M. Wagner in M. Wagner (Hg.), Kultur und Politik. Politik und Kunst 1991, 322–329; R. Flotzinger Hamburger Jb. für Musikwiss. 8 (1985).
K. Blaukopf, Musik im Wandel der Ges. Grundzüge der Musiksoziologie 1982; G. Tanzer, Spectacle müssen seyn. Die Freizeit der Wiener im 18. Jh. 1992; H.-W. Heister, Das Konzert. Theorie einer Kulturform 1983; H. Kindermann, Die Funktion des P.s im Theater 1971; M. Wagner in M. Wagner (Hg.), Kultur und Politik. Politik und Kunst 1991, 322–329; R. Flotzinger Hamburger Jb. für Musikwiss. 8 (1985).
Autor*innen
Rudolf Flotzinger
Letzte inhaltliche Änderung
9.11.2022
Empfohlene Zitierweise
Rudolf Flotzinger,
Art. „Publikum‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
9.11.2022, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x00021d79
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.