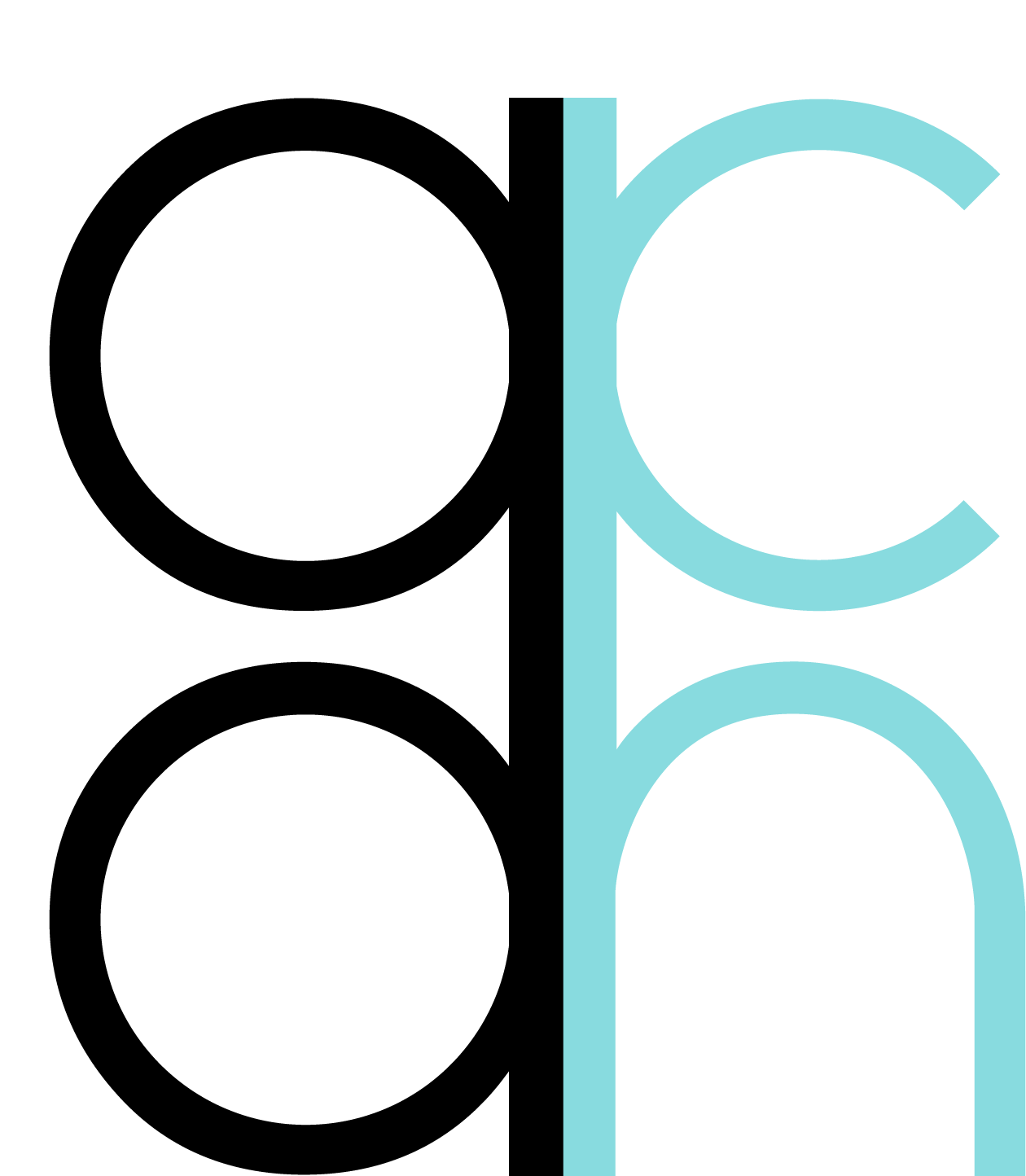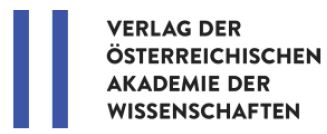Publikumsforschung
Jener Teil der empirischen Rezeptionsforschung, der mit den Methoden der offenen bis standardisierten Befragung Angaben über antizipiertes oder memoriertes, mit der (externen bzw. teilnehmenden) Beobachtung das tatsächliche Verhalten in Bezug auf Interaktionen mit musikalischen Darbietungen festhält. Angaben über musikbezogenes Rezeptionsverhalten und allgemein soziales Verhalten zu machen, reiht P. in musiksoziologische Forschung ein; die motivationalen Gründe für dieses Verhalten zu erheben, ist weiterhin (psychologisch) aufklärender Teil jener Forschung (Musikpsychologie). Statistische Methoden dienen dabei der Beschreibung der beobachteten (Zufalls- bzw. bei Kenntnis der sozialen Struktur der untersuchten Einheit nach relevanten Merkmalen quotierten) Stichproben und die Schätzung des Verhaltens der Population.Allgemein sind extrinsische und intrinsische Motivation zu unterscheiden. Intrinsische gibt die „persönlichen“ Motive an, Musik zu erleben. Internalisierte Werte aus der musikbezogenen Sozialisation werden dafür als erklärende Variablen erachtet, extrinsische Motivation beachtet zudem wesentlich die soziale Situation eines Musikerlebnisses als bestimmende Größe für die Teilnahme an diesem. Die methodische Messung solcher verhaltensbestimmender motivationaler Größen geschieht über die indirekte Befragung, die bewusst kontrollierte Antworten und Antworten der sozialen Erwünschtheit ausschließt und somit möglichst valide auch hinsichtlich solcher Bestimmungsgrößen ist, die den Befragten selbst nicht bewusst sind, ihr Verhalten aber (mit-)bestimmen.
Als solche, die allgemeinen Daten über das Verhalten von Publika ausdifferenzierenden Variablen gelten die klassischen soziodemographischen Variablen Alter, Geschlecht, die als soziale Größen auf dem Hintergrund historischer und kultureller Prozesse als Generation und Rollen betrachtet werden, sowie Indikatoren der Zugehörigkeit zu bildungs- und einkommensbedingten sozialen Gruppen.
Zusätzlich zum Bildungs- und ökonomisch bestimmten erweist sich ein soziales Kapital als verhaltensbestimmend. Gerade hier zeigt sich die Unzulänglichkeit, eine kausale Richtung in der Erklärung des Verhaltens vorzunehmen; im systemischen Bezug mit anderen sozialen Größen stehen die beiden in korrelativem Bezug: Einerseits ist der Besuch musikalischer Veranstaltungen Ausdruck der sozialen Position, des sozialen Kapitals, andererseits wird soziale Positionierung (erst) durch den Besuch erworben.
P. trifft zuerst Aussagen über Verhalten und Motive bezüglich des Besuches von musikdominierten Ereignissen, ihr prognostischer Wert erlaubt dann die Vorhersage des zukünftigen Verhaltens des Publikums, aber auch Voraussagen über Entwicklungen des Musiklebens, betrachtet man dieses eingebunden in den marktwirtschaftlichen Regelkreis von Nachfrage und Angebot (Musikindustrie).
In dieser Art Teil der Markt-Meinungsforschung, deren politisch motivierte Avantgarde sich im „Wiener Kreis“ findet, verwundert nicht, dass P. in den 1960er Jahren erstarkte und ebenso aufklärerisch und didaktisch motiviert war. Die Ergebnisse zeigten damals eine klare Differenzierung sozioästhetisch definierter politischer Positionen: klassische Musik wurde als das rezipiert, was sie von ihrer Genese her stets war, als bürgerliche Musik, dagegen stand die Rezeption populärer Musik und des Jazz.
In den 1980er Jahren des 20. Jh.s mutierte die aufklärerische Kultur in eine hedonistisch bestimmte plurale Erlebnisgesellschaft. Ein stark situations- und rollenbezogenes und damit stets fluktuierendes aktives Rezeptionsverhalten ist beobachtbar. Das Affirmations- und Gegenhaltungskonzept ist ebenso eruierbar, allerdings in weiter entfernten politischen Positionen zwischen den restaurativ konservativen Haltungen bürgerlicher Positionen und jenen in den alternativen Nischen der grün-alternativen Bewegung gelebten Haltungen (Protestsong) – beiden ist ein expliziter Erwerb sozialen Kapitals bzw. eine offene Bekundung sozialer Positionierung über Musik eigen.
P. definiert den Gegenstand ihrer Forschung als zweckgebunden zeitgleich an einem Ort körperlich anwesendes Kollektiv. Die technisch mediale Distribution von Musik (Medien) hat eine Art Publikum geschaffen, das zu verschiedenen Zeitpunkten disloziert individuell (die gleiche) Musik rezipiert und dies oftmals eingebunden in ein Handeln, das einem anderen Zweck folgt. Die Hörerbindung an Radioformate (Rundfunk) erfolgt über die Farbe einer Musik, ihre emotionale konnotative Qualität. Musik dient dabei als Attraktor für den Verkauf zielgerichteter Werbeflächen. Die Ermittlung der Struktur des Publikums von Radioformaten, eingebunden in wirtschaftlich wie kulturell bestimmte (zeitliche) Abläufe, aber auch in biologisch bestimmte Rhythmen, beschreibt die Zielgruppe bestimmter Produktwerbungen.
Literatur
H. Rösing (Hg.), Rezeptionsforschung in der Musikwissenschaft 1983; R. Dollase et al., Demoskopie im Konzertsaal 1986; R. Dollase et al., Das Jazzpublikum. Zur Sozialpsychologie einer kulturellen Minderheit 1978; W. Jauk, Die Musik und ihr Publikum im Graz der 80er Jahre 1988; R. Hafen in H. Gembris et al. (Hg.), Musikpädagogische Forschungsberichte 1993; P. Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft 1984; G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft 1993; K.-H. Bohrer in J. Habermas (Hg.), Stichworte zur geistigen Situation der Zeit 2 (1979).
H. Rösing (Hg.), Rezeptionsforschung in der Musikwissenschaft 1983; R. Dollase et al., Demoskopie im Konzertsaal 1986; R. Dollase et al., Das Jazzpublikum. Zur Sozialpsychologie einer kulturellen Minderheit 1978; W. Jauk, Die Musik und ihr Publikum im Graz der 80er Jahre 1988; R. Hafen in H. Gembris et al. (Hg.), Musikpädagogische Forschungsberichte 1993; P. Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft 1984; G. Schulze, Die Erlebnisgesellschaft 1993; K.-H. Bohrer in J. Habermas (Hg.), Stichworte zur geistigen Situation der Zeit 2 (1979).
Autor*innen
WJ
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2005
Empfohlene Zitierweise
Werner Jauk,
Art. „Publikumsforschung‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2005, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x000fd561
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.