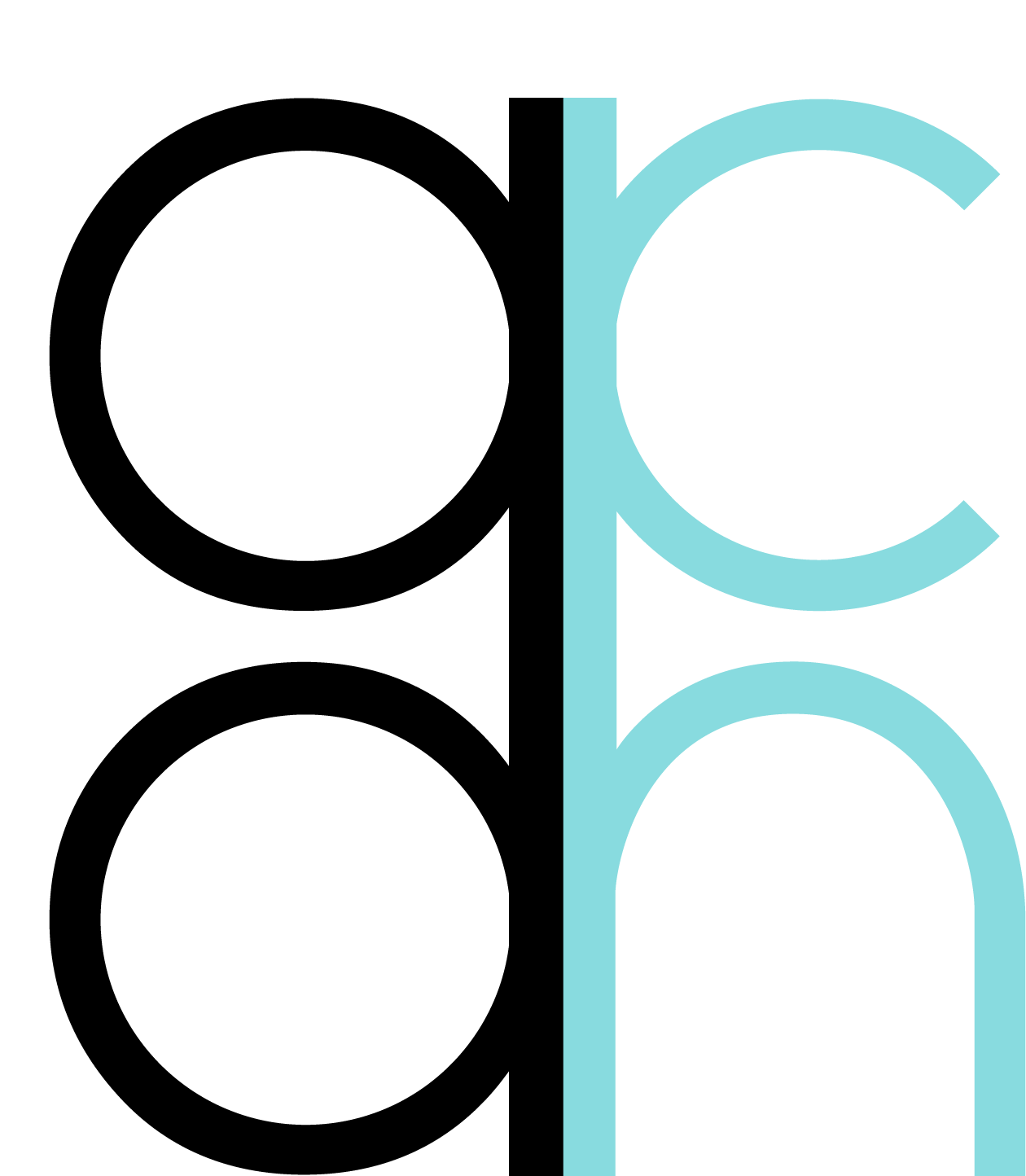Rhetorik und Musik
Analog zur seit der Antike tradierten Rh., die den bestmöglichen Einsatz sprachlicher Mittel bei der Gestaltung einer Rede lehrt(e), sah die musikalische Rh. seit dem 14. Jh. „Zweck und Absicht“ darin, „die gehörige und beste Anwendung der Ton- oder Ideensprache“ zu garantieren. Dieses Verdikt, von J. N. Forkel noch 1788 formuliert, basiert auf der Ansicht, dass die Musik selbst eine „Sprache“ sei und als solche sowohl den Gesetzen der Rh. zu gehorchen als auch „Inhaltliches“ zu vermitteln habe. Und ebenso analog sah man wie der sprachlichen auch der musikalischen Rh. eine Grammatik vorgelagert: Diese lehrte „die Zusammensetzung einzelner Gedanken aus Tönen und Accorden, von ihrer ersten Bildung und Biegung an, bis zur allmähligen Zusammensetzung erst einzelner, dann mehrerer musikalischen Wörter zu einem Satze“.
Bekanntlich hatte bereits die Notation von Musik ihren Ausgang bei Rh. und Prosodie genommen, und die hochmittelalterliche Modalrhythmik fußte auf einer Versmaß-adäquaten Übertragung von Längen und Kürzen der Silben. Im weiteren Verlauf der Musikgeschichte verfestigte sich das allgemeine Bewusstsein von einer tiefgehenden Verwandtschaft von Musik und Rh. noch mehr, und diese Verwandtschaft drückte sich auf drei Ebenen aus. Zunächst einmal wurden „rhetorische“ Mittel zur Textaussage, zur Verdeutlichung des „Inhalts“, herangezogen, und hier konnten ganz bewusst auch „Fehler“ eingesetzt werden. So verglich Marchettus von Padua bereits 1325 die „colores ad pulchritudinem consonantiarum“ in der Musik mit den „colores rhetorici ad pulchritudinem sententiarum“ in der Grammatik: Die Farbwirkungen der Klänge glichen seiner Meinung nach den rhetorischen Mitteln, die den Schönheiten der Sprache gewidmet seien; und um (in Vokalmusik) den jeweiligen Textausdruck adäquat zu erreichen, dürften sie sich sogar „falscher“ Wendungen bedienen. Um 1380 forderte dann Heinrich Eger von Kalkar: „Ornatus habet musica proprios sicut rhetorica“ – die Musik besitzt wie die Rhetorik ganz spezifische Mittel für den „Schmuck“ (der „musikalischen Rede“).
1477 schließlich wendete Johannes Tinctoris für solche Lizenzen in Anlehnung an die Rh.-Lehrbücher des Marcus Fabius Quintilianus den Begriff figura an, und Joachim Burmeister legte um 1600 eine Übersicht über die melodischen und harmonischen „Figuren“ vor. In seinem Gefolge entstanden dann bis weit ins 18. Jh. hinein, ja partiell noch im frühen 19. Jh., zahlreiche Lehrbücher, die die (über 100) „musikalisch-rhetorischen“ Figuren erklären, systematisieren und inhaltlich entschlüsseln, und allgemein herrschte die Meinung vor, man könne ein Musikwerk gar nicht verstehen, geschweige denn vernünftig interpretieren, wenn man nicht seine in allgemeinen Symbolen (Tonsymbolik) und speziellen Figuren verborgene „gantze Meinung“ kenne. Noch 1817 zählte der Prager Kantor J. J. Ryba 31 Figuren auf, darunter (neben melodischen und rhythmischen Symbolen) bildhafte „Malereien“ als Weiterentwicklung der „Mimesis“-Ästhetik sowie akustische Nachahmungen. Und der in Wien wirkende Beethoven-Freund F. A. Kanne bediente sich 1821 weitgehend des Vokabulars der rhetorischen Figuren, um „Inhalt“ und Affektgehalt von W. A. Mozarts Klaviersonaten darzulegen. Insgesamt spiegelt sich hier eine Mehrpoligkeit der Figurenlehre wider, die Kanne als„ob- und subjektive Vermischung“ sah und in der „alte“ Nachahmungsästhetik und „neue“ Gefühlsästhetik einen umfangreichen Fundus von text- und inhaltsausdeutenden Mitteln bilden.
Die zweite Ebene, auf der sich die Sinneinheit von Rh. u. M. konstituierte, war die „sprachlich-grammatikalische“. Sie prägte sich in Formen wie dem Rezitativ aus, sie schlug sich in einer „musikalischen Deklamation“ nieder, die taktfrei oder doch zumindest nicht sklavisch nach dem Takt zu erfolgen hatte, sie führte aber auch zu jenem kleingliedrigen „sprechenden“ Artikulieren, durch welches sich das Interpretieren von älterer Musik von dem üblichen spätromantischen „Dauer-Legato“ unterscheiden muss. Noch für L. v. Beethoven bezeichnete sein erster Biograph A. Schindler „das rhetorische Prinzip“ als „Grundwesen aller seiner Musik“ und deren deklamatorische Ausführung als die allein richtige und mögliche.
Die dritte Ebene der Verwandtschaft zwischen Rh. u. M. ist die großformale. Johann Mattheson etwa meinte 1739, dass Kompositionen wie eine Rede aus „Eingang, Bericht, Antrag, Bekräfftigung, Widerlegung und Schluß“ bestünden, Christian Friedrich Daniel Schubart sah die Sonate 1784 als „musikalische Conversation, oder Nachäffung des Menschengesprächs“, H. C. Koch das Konzert 1802 als „leidenschaftliche Unterhaltung des Concertspielers mit dem ihn begleitenden Orchester" und A. Reicha noch 1824 die Sonatenhauptsatzform als zweiteiliges Drama über ein „Thema“ im inhaltlichen Sinne: der 1. Teil sei die „Exposition der Vorgeschichte“, der 2. Teil die „Schürzung des Knotens" (die „Intrige“) sowie seine „Auflösung“.
Die Lehre, wie eine Rede (und somit auch eine „Klangrede“) zu verfassen (bzw. auszuarbeiten) ist, umfasste auch in der Musik die Arbeitsstufen Inventio, Dispositio, Elocutio (Elaboratio), (eventuell) Memoria sowie Executio (bzw. Actio oder Pronuntiatio). Die Inventio lehrte das „Finden“ von Gedanken (aus dem „Vorratsmagazin“ der „Topik“) durch Analogieschlüsse, Assoziationen, konnotativ verbundene Affektfelder oder auch durch speziell erfundene Zuordnungen. Die Dispositio war die Gliederung der Werke und geschah ebenfalls analog zur sprachlichen Rh., wie dies oben bei Mattheson oder Reicha zu sehen war. Die Elocutio (Elaboratio) ging dann mit Hilfe aller kompositionstechnischen und variativen Mittel vor sich und war zunächst für den Schmuck (ornatus) der „musikalischen Rede“ verantwortlich, hatte aber in erster Linie durch Symbole und „Figuren“ für „Inhalt“ und „Bedeutung“ der Musik zu sorgen. Zweck der Musik war dabei – wie bei der Rede – sowohl movere als auch docere sowie delectare, also zu „bewegen“, zu „lehren“ und zu „erfreuen“.
Der Elocutio folgten schließlich die Memoria, das Lernen, vornehmlich aber das Auswendiglernen, sowie die Executio (Pronuntiatio), die Ausführung (das „sprechende Vortragen“) der Rede bzw. der Musik. Und diese Ausführung hatte nun sowohl selbst den rhetorischen Gesetzen zu gehorchen, erforderte also eine „sprechende“ Artikulation, wie sie auch den von Symbolen und Figuren vermittelten Inhalt weitergeben musste, um den Hörer wirklich zu erreichen, zu „affizieren“.
Literatur
A. Schering in KmJb 21 (1908); H.-H. Unger, Die Beziehungen zw. Musik und Rh. im 16.–18. Jh. 1941; O. Wessely in Orbis musicae 1 (1971/72); M. Bielitz, Musik und Grammatik. Studien zur mittelalterlichen Musiktheorie 1977; D. Bartel, Hb. der musikalischen Figurenlehre 1985; A. Liebert, Die Bedeutung des Wertesystems der Rh. für das dt. Musikdenken im 18. und 19. Jh. 1993; MGG 6 (1996) [Musik und Rh.]; H. Krones in G. Ueding (Hg.), Historisches Wörterbuch der Rh. 4 (1998) [Humanismus] u. 5 (2001) [Musik; Musikalische Figurenlehre].
A. Schering in KmJb 21 (1908); H.-H. Unger, Die Beziehungen zw. Musik und Rh. im 16.–18. Jh. 1941; O. Wessely in Orbis musicae 1 (1971/72); M. Bielitz, Musik und Grammatik. Studien zur mittelalterlichen Musiktheorie 1977; D. Bartel, Hb. der musikalischen Figurenlehre 1985; A. Liebert, Die Bedeutung des Wertesystems der Rh. für das dt. Musikdenken im 18. und 19. Jh. 1993; MGG 6 (1996) [Musik und Rh.]; H. Krones in G. Ueding (Hg.), Historisches Wörterbuch der Rh. 4 (1998) [Humanismus] u. 5 (2001) [Musik; Musikalische Figurenlehre].
Autor*innen
Hartmut Krones
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2005
Empfohlene Zitierweise
Hartmut Krones,
Art. „Rhetorik und Musik‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2005, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001df23
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.