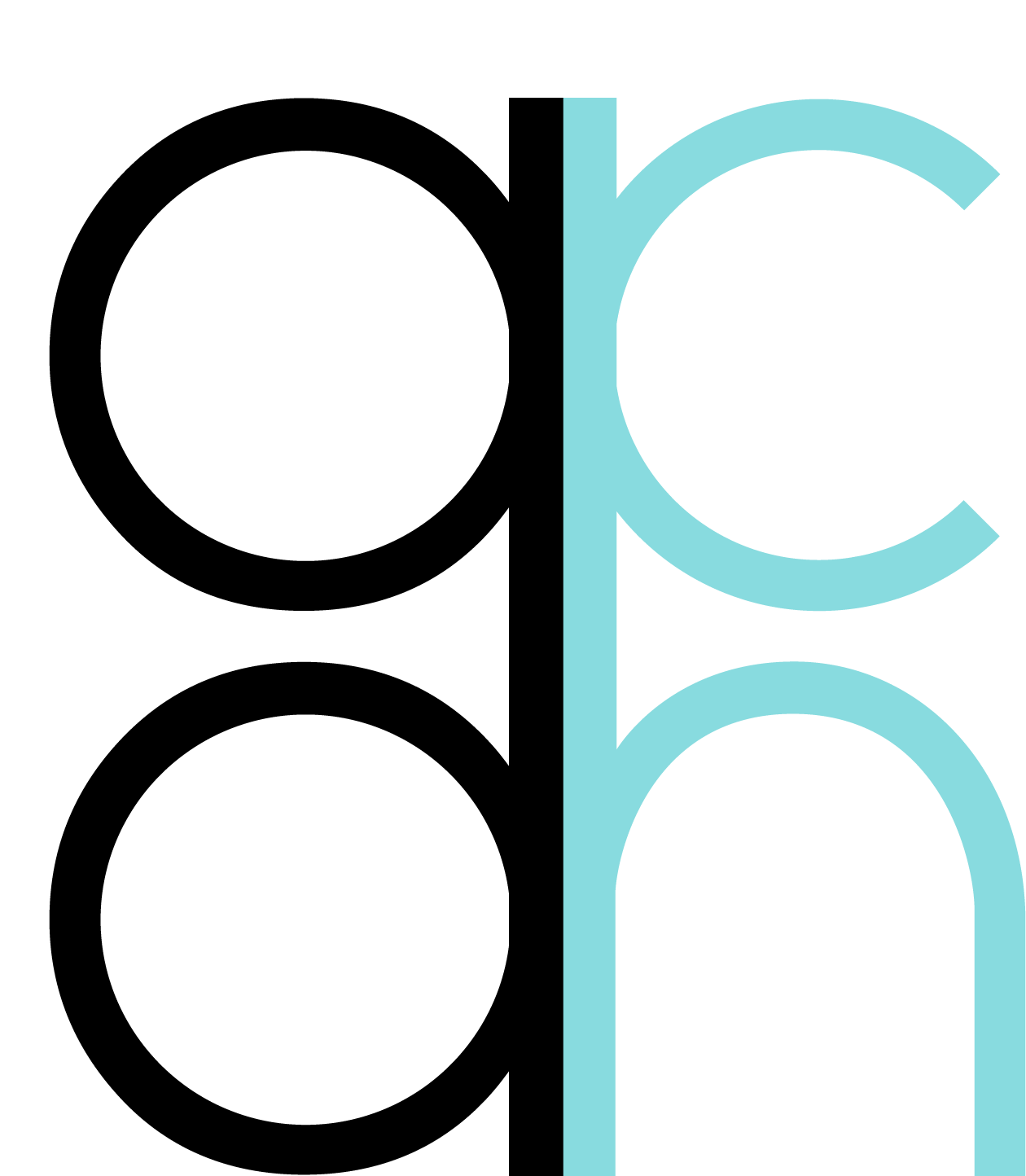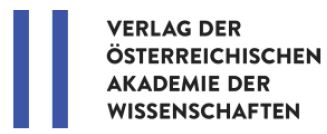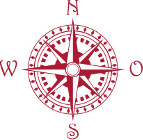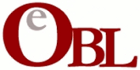Schuppanzigh,
Ignaz Anton
* 20.7.1776 Wien,
† 2.3.1830 Wien.
Violinist, Dirigent und Pädagoge.
Sohn des in Italien geborenen Lehrers Franz Josef Sch. (ca. 1734–1800), lernte zunächst Bratsche, ab ca. 1793 Geige bei A. Wranitzky. Ca. 1794–99 spielte Sch. als Primarius eines Streichquartetts bei Fürst K. Lichnowsky, wo auch J. Haydn verkehrte und Sch. L. v. Beethoven kennenlernte, der 1794 bei dem jungen Sch. Geigenunterricht oder bei dessen Vater Stunden in verschiedenen Wissensgebieten nahm. Seit 1795 (nach Hanslick; sicher seit 1799) leitete Sch. die schon unter W. A. Mozart beliebten, meist 12–16mal pro Saison stattfindenden Wiener Augartenkonzerte, die eher ein gesellschaftliches als künstlerisches Ereignis waren, von Sch. zeitweise auch unternehmerisch betreut und zwischen 1796/1806 zu neuer Blüte geführt wurden. Sch. leitete auch die seit 1805 nachweisbaren populären Morgenkonzerte jeweils am 1. Mai im Augarten (1816 in Berlin). 1804–08 veranstaltete er mit eigenem Quartett ( Sch.-Quartett I: Sch., J. Mayseder, Anton Schreiber, A. Kraft) als Erster öffentliche Quartettsoireen in Wien – gleichzeitig die ersten Kammermusikkonzerte der Welt. 1808–16 war Sch., seit 1807 mit Barbara Killitzky verheiratet, mit einem Quartett bei Fürst A. Rasumowsky auf Lebenszeit angestellt (Besetzung: Sch., zunächst der Fürst, später Louis Sina [1778–1857] sowie F. Weiß und J. Linke) und bezog daher auch – nach Zerstörung des Palais 1814 entlassen – eine lebenslange Pension. 1816–23 unternahm Sch. – sehr lückenhaft dokumentierte – Reisen durch Deutschland, Polen und Russland. 1823 zurück in Wien, veranstaltete er bis 1829 wieder auch von Fr. Schubert oft besuchte Quartett-Zyklen mit Werken v. a. der Wiener Klassik (Sch.-Quartett II: Sch., C. Holz, Weiß und Linke, bei Quintetten unterstützt vom Bratschisten F. Piringer), trat bis 1829 auch wieder im Augarten auf und beendete ein 35 Jahre lang von ihm geprägtes Kapitel der Wiener Musikgeschichte. 1824 war Sch. zum exspektierenden, 1827 zum wirklichen Mitglied der K. k. Hofkapelle ernannt worden, hatte seit 1828 auch die Funktion des Orchesterdirektors am Kärntnertortheater inne. Als Violinlehrer zählte er zu seinen Schülern: Mayseder, F. Pechatschek, Holz, Jos. Strauß.
Besonders als (Erst-)Interpreten von Beethovenschen Streichquartetten wurden die Quartette Sch.s berühmt, der u. a. auch Schuberts ihm gewidmetes Quartett in a-Moll D 804 uraufführte und bei der letzten Schubertiade 1828 mitwirkte. Sch. war zudem Konzertmeister bei den großen Akademien Beethovens, hatte aber als Solist wegen nicht sehr ausgeprägter Virtuosität keine entscheidende Bedeutung. Beethoven widmete dem korpulenten Sch.: Lob auf den Dicken WoO 100; den Kanon „Falstafferel, lass’ dich sehen!“ WoO 184 sowie das Kanonfragment „Hol’ dich der Teufel!“ WoO 173. In der Beethoven-Literatur wird Sch. oft als „künstlerisches Faktotum Beethovens“ bezeichnet – als Gegenstück zu dessen Sekretär Anton Schindler. Als Komponist legte Sch. konventionelle Violinstücke vor.
Werke
W (alle gedruckt): 9 Variationen f. 2 V. über ein Thema aus dem Ballett Alcina von J. Weigl 1798; 5 Variationen über ein (in Europa sehr populäres) russisches Thema (Kalinuská) f. V. m. Streichquartett 1815; 4. Variation von 6 Variationen samt Coda (von versch. Komponisten) über ein Thema von Beethoven f. V. u. Kl. [o. J.]; Violinsolo m. Streichquartettbegleitung 1826.
W (alle gedruckt): 9 Variationen f. 2 V. über ein Thema aus dem Ballett Alcina von J. Weigl 1798; 5 Variationen über ein (in Europa sehr populäres) russisches Thema (Kalinuská) f. V. m. Streichquartett 1815; 4. Variation von 6 Variationen samt Coda (von versch. Komponisten) über ein Thema von Beethoven f. V. u. Kl. [o. J.]; Violinsolo m. Streichquartettbegleitung 1826.
Literatur
C. Hellsberg, I. Sch. (Wien 1776–1830). Leben und Wirken, Diss. Wien 1979; ÖBL 11 (1999); NGroveD 22 (2001) [mit detaillierten Quartettformationen]; MGG 12 (1965); Czeike 5 (1997); Riemann 1961; DBEM 2003; Wurzbach 32 (1876); E. Hanslick, Gesch. des Concertwesens in Wien 1869; MGÖ 2 u. 3 (1995); eigene Recherchen (Beethoven-Literatur); M. Lorenz, Four more months for Ignaz Schuppanzigh (http://michaelorenz.blogspot.co.at, 11/2013).
C. Hellsberg, I. Sch. (Wien 1776–1830). Leben und Wirken, Diss. Wien 1979; ÖBL 11 (1999); NGroveD 22 (2001) [mit detaillierten Quartettformationen]; MGG 12 (1965); Czeike 5 (1997); Riemann 1961; DBEM 2003; Wurzbach 32 (1876); E. Hanslick, Gesch. des Concertwesens in Wien 1869; MGÖ 2 u. 3 (1995); eigene Recherchen (Beethoven-Literatur); M. Lorenz, Four more months for Ignaz Schuppanzigh (http://michaelorenz.blogspot.co.at, 11/2013).
Autor*innen
Uwe Harten
Letzte inhaltliche Änderung
15.12.2013
Empfohlene Zitierweise
Uwe Harten,
Art. „Schuppanzigh, Ignaz Anton‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.12.2013, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e1dd
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.