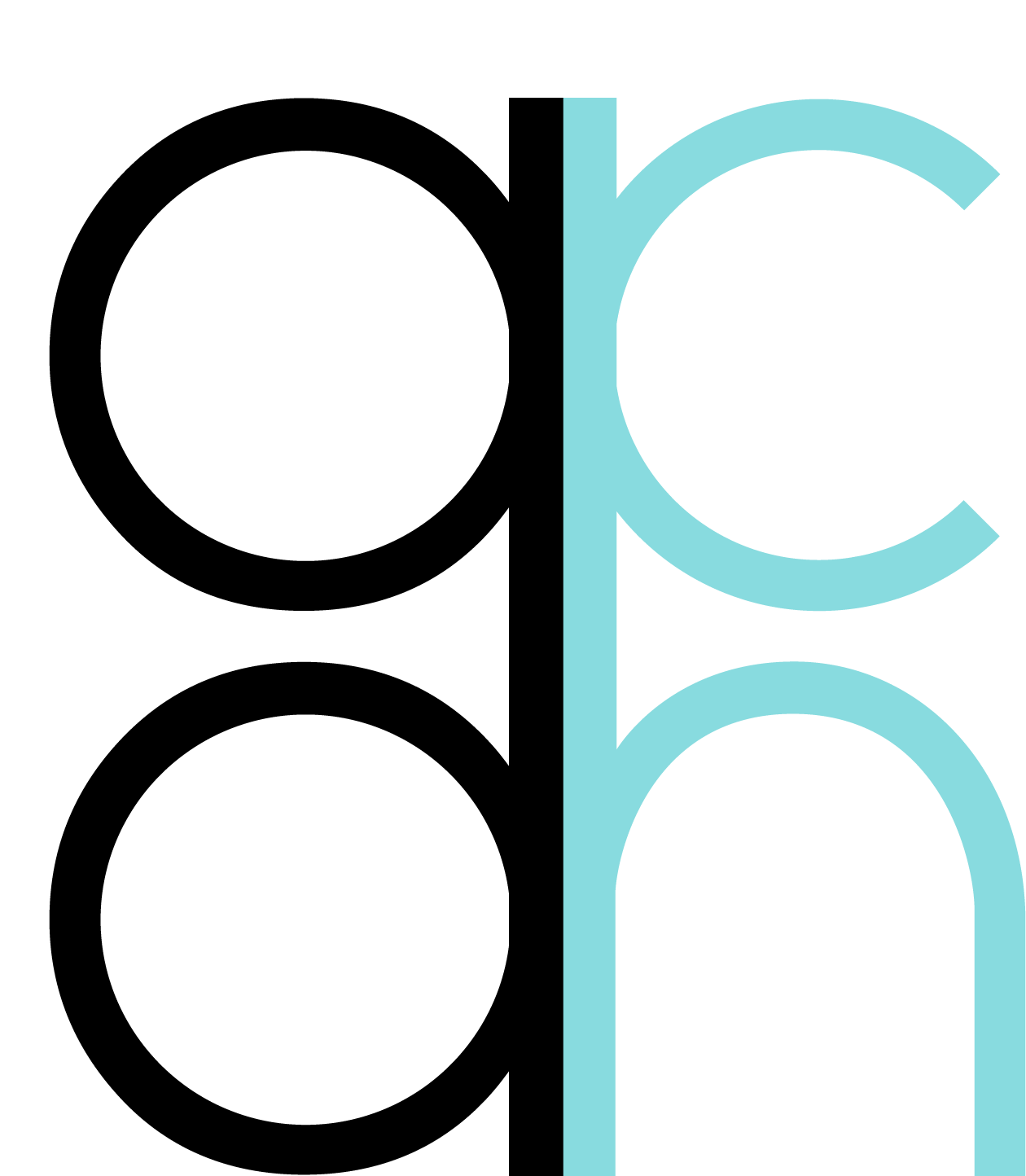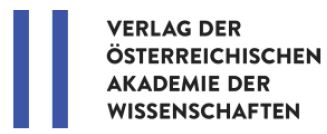Skordatur
Eine von der Norm abweichende Stimmung der Saiteninstrumente (ital. scordatura = Umstimmung), besonders häufig der Violine. Die S. wird meist als Akkord oder mit Buchstaben zu Beginn der Komposition angegeben. Als wichtigste Gründe für die S. gelten einerseits spieltechnische Erleichterung bzw. Ermöglichung bestimmter Passagen, andererseits klangliche Bereicherung (wie etwa Korrespondenz zwischen Tonart und Stimmung, die eine vermehrte Anwendung von leeren Saiten erlaubt) oder Erweiterung des Tonumfanges; die Gewichtigkeit der einzelnen Aspekte variierte jedoch in den unterschiedlichen Epochen. Obwohl die S. in der früheren Musikforschung vernachlässigt oder gar abgelehnt wurde, handelt es sich um ein sowohl in Kunst- als auch Volksmusik weit verbreitetes Phänomen. Bis jetzt (2005) sind mehr als 60 verschiedene Violinstimmungen und mehr als 70 Viola d’amore-Stimmungen bekannt, wobei diese Zahl mit Entdeckungen neuer Quellen höchstwahrscheinlich steigen wird.
Im 17. und 18. Jh. kommt der Begriff S. dem Anschein nach nur in gedruckten Sammlungen schottischer Reel-Musik als Bezeichnung für die Umstimmung zu Beginn eines Stückes vor. Lehrwerke aus dem 17. und 18. Jh. (Daniel Speer, Johann Christoph Weigel, Martin Heinrich Fuhrmann, Johann Philipp Eisel, Johann Friedrich Bernhard Caspar Majer) lassen in Bezug auf Viola da gamba, Violine oder Viola d’amore entweder eine direkte Bezeichnung vermissen oder verwenden die Ausdrücke „verstimmt“ bzw. „Verstimmung“. Thomas Balthasar Janowka (Clavis ad thesaurum magnae artis musicae, Prag 1701) schlägt die Begriffe Accord ordinarium und Extraordinarium vor. Deutsche und österreichische Komponisten der 2. Hälfte des 17. Jh.s verwendeten am häufigsten Bezeichnungen wie „violino discordato“ und „violino (violini) verstimbt“ oder „verstimmt“ etc., darüber hinaus Accord oder Accordatura; bei J. H. Schmelzer findet sich der Ausdruck Cordatura. Der Begriff S. scheint zuerst in dem Lehrwerk L’Art du Violon von Jean-Baptiste Cartier (Paris 1798) auf; in die deutsche Lexikographie führte diesen Ausdruck erst Eduard Bernsdorf (Neues Universal-Lexikon der Tonkunst, Offenbach 1861) ein. Die Unterscheidung in Accordatura für die normale Stimmung und S. für Umstimmung, wie sie gelegentlich in der neueren Lexikographie vorkommt, war im 17. und 18. Jh. nicht gebräuchlich.Die Anfänge der S. lassen sich bei italienischen und französischen Lautenisten des 16. Jh.s beobachten, die für die Umstimmung der tiefsten bzw. der zwei tiefsten Saiten den Terminus „Bordone descordato“ oder „Basso descordato“ bzw. „avalé“ („avallé“) oder „ravalé“ („ravallé“) gebrauchten. Im 17. und 18. Jh. wurde die S. neben der Laute (z. B. Esaias Reusner, Silvius Leopold Weiss, Johann Anton Graf Logi [Losy], J. de Saint Luc) oder der Viola da gamba und dem Anschein nach auch dem Violoncello (z. B. G. B. Vitali, Domenico Galli, Domenico Gabrielli) v. a. bei der Violine verwendet. Obwohl das erste Beispiel für eine Violinkomposition mit S. von dem Italiener Biagio Marini (Sonate, Symphoniae, Canzoni […] Opera Ottava, Venedig 1629, S. g-d’-a’-c’’) stammt, entwickelte sich diese Technik im 17. Jh. bis auf wenige Ausnahmen (G. M. Bononcini) hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Findet sich die S. zunächst in spieltechnisch einfachen Instrumentalkompositionen (Johann Erasmus Kindermann, Clamor Heinrich Abel, J. Pachelbel u. v. a.) oder vokal-instrumentalen Werken (z. B. G. Arnold, Psalmi de Beata Virgine, Innsbruck 1662), erreichte diese Technik sowohl in Hinsicht auf die Vielfalt der verwendeten Stimmungen als auch den spieltechnischen Anspruch schon um 1680 einen ersten Höhepunkt. Neben Sonaten und Balletten von J. H. Schmelzer wirkten insbesondere Sammlungen wie die sog. Rosenkranz-Sonaten (um 1670), Sonatae Violino solo (1681) und Harmonia Artificiosa-Ariosa von H. I. F. Biber als unübertroffene Vorbilder für die kommende Komponistengeneration (Carl’Ambrogio Lonati, 12 Violinsonaten, Mailand 1701, K. Leopold I. gewidmet; Johann Joseph Vilsmayr, Artificiosus Concentus pro Camera, Salzburg 1715). Die weite Verbreitung der S. im österreichischen Raum belegen des Weiteren zahlreiche singuläre anonyme Manuskripte in der Musikaliensammlung des Fürstbischofs Carl Liechtenstein-Castelcorn in Kremsier sowie umfangreiche handschriftliche Sammlungen (Codex Rost aus F-Pn, Codex 726 aus dem Wiener Minoritenkonvent, die Sammlung M 73 aus dem Klagenfurter Landesmuseum).
Im 18. Jh. wurde die S. vermehrt in Frankreich (Michele Corrette, Tremais) und Italien (A. Vivaldi, Giuseppe Tartini, Pietro Castrucci, Emanuel Barbella, Pietro Nardini) gepflegt, häufig dann, wenn die Umstimmung zur Nachahmung der Viola d’amore („Imitatione della viola d’amore“) diente. W. A. Mozart (Sinfonia concertante in Es f. V., Va. u. Orch. KV 364) verwendete als einer der ersten Komponisten die sog. Transpositions-S., bei der die in der Standardstimmung vorhandenen Intervalle beibehalten werden. Bei A. Lolli diente die S. durch das Hinunterstimmen der G-Saite zur Erweiterung des Violinumfanges; seine Variante f-d’-a’-e’’, die als „dans le stile de Lolly“ bezeichnet wurde, inspirierte möglicherweise auch J. Haydn (Sinfonia Hob. I:60, Per la commedia intitolata Il Distratto).
Einen neuen Höhepunkt erlebte die S. im 19. Jh. bei N. Paganini, der die Transpositions-S. sowie das Hinaufstimmen der G-Saite um eine kleine oder große Terz mit einer nie da gewesenen Virtuosität verband. Setzten Paganini oder auch sein Epigone H. W. Ernst (Le Carneval de Venise op. 18) diese Technik als Mittel zur Erzeugung des Geheimnisvollen oder Schaurigen ein, fand diese Auffassung in der Orchesterliteratur (Camille Saint-Saëns, Danse macabre, G. Mahler, Symphonie Nr. 4, 1899/1900, rev. bis 1910) ihre Fortsetzung (z. B. Heinz Holliger, Violinkonzert Hommage à Louis Soutter, 1993–95/2002). Obwohl die S. im 20. Jh. nach wie vor als exquisites Mittel der virtuosen Spieltechnik galt, wurde sie immer wieder auch insbesondere zur Erzeugung exotischer Klangfarben oder Klangeffekte verwendet (z. B. Igor Strawinsky, Feuervogel 1910, B. Schaeffer, Gasab f. skordierte V. u. Kl. 1983, sowie Konzert f. V. [u. skordierte V.], Ob. u. Orch. 1986, K. Penderecki, Emanationen 1959, f. 2 Streichorchester, in denen das zweite Streichorchester um einen halben Ton höher gestimmt ist). G. Ligeti setzte skordierte Violine und Viola neben Okarinen, Blockflöte und Lotosflöte im Orchester seines Konzertes für Violine und Orchester (1990, 1992) zur Erzeugung eines „schmutzigen“ Klanges ein.
Gelegentlich wurde die S. als eine Art Unterhaltung herangezogen, wie etwa Stücke für die sog. „gebundene Violine“ („gebunden“ auf die Art eines Gitarrenkapodasters) des Wiener Komponisten Ignaz Schweigl († 1803; A-Wgm) oder das Quartett Armonioso/Senza digiti eines sonst kaum bekannten Stefano (?) Ferandini Milanese (um 1800?, A-Wgm).
Literatur
Lit (chron.): MGG 8 (1998); NGroveD 22 (2001); J. W. v. Wasielewski, Die Violine u. ihre Meister 1869; A. Moser in AfMw 1 (1918/19); A. Moser, Gesch. des Violinspiels 1923; H. J. Moser in H. Zingerle (Hg.), [Fs.] W. Fischer 1956; D. D. Boyden, Die Gesch. des Violinspiels von seinen Anfängen bis 1761, 1971; F. W. Riedel in W. Salmen (Hg.), [Kgr.-Ber.] Jakob Stainer u. seine Zeit. Innsbruck 1983, 1984; H. Unverricht in Haydn Studies 1975; M. A. Eddy, The Rost Codex and Its Music 1985; E. Kubitschek in G. Walterskirchen (Hg.), [Kgr.-Ber.] Heinrich Franz Biber. Salzburg 1994, 1997; D. Glüxam, Die Violin-S. in der Gesch. des Violinspiels 1999; D. Glüxam in ÖMZ 54/4 (1999); H. I. F. Biber, Rosenkranz-Sonaten, hg. v. D. Glüxam 2003 (= DTÖ 153).
Lit (chron.): MGG 8 (1998); NGroveD 22 (2001); J. W. v. Wasielewski, Die Violine u. ihre Meister 1869; A. Moser in AfMw 1 (1918/19); A. Moser, Gesch. des Violinspiels 1923; H. J. Moser in H. Zingerle (Hg.), [Fs.] W. Fischer 1956; D. D. Boyden, Die Gesch. des Violinspiels von seinen Anfängen bis 1761, 1971; F. W. Riedel in W. Salmen (Hg.), [Kgr.-Ber.] Jakob Stainer u. seine Zeit. Innsbruck 1983, 1984; H. Unverricht in Haydn Studies 1975; M. A. Eddy, The Rost Codex and Its Music 1985; E. Kubitschek in G. Walterskirchen (Hg.), [Kgr.-Ber.] Heinrich Franz Biber. Salzburg 1994, 1997; D. Glüxam, Die Violin-S. in der Gesch. des Violinspiels 1999; D. Glüxam in ÖMZ 54/4 (1999); H. I. F. Biber, Rosenkranz-Sonaten, hg. v. D. Glüxam 2003 (= DTÖ 153).
Autor*innen
Dagmar Glüxam
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2006
Empfohlene Zitierweise
Dagmar Glüxam,
Art. „Skordatur‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2006, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x00107622
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.