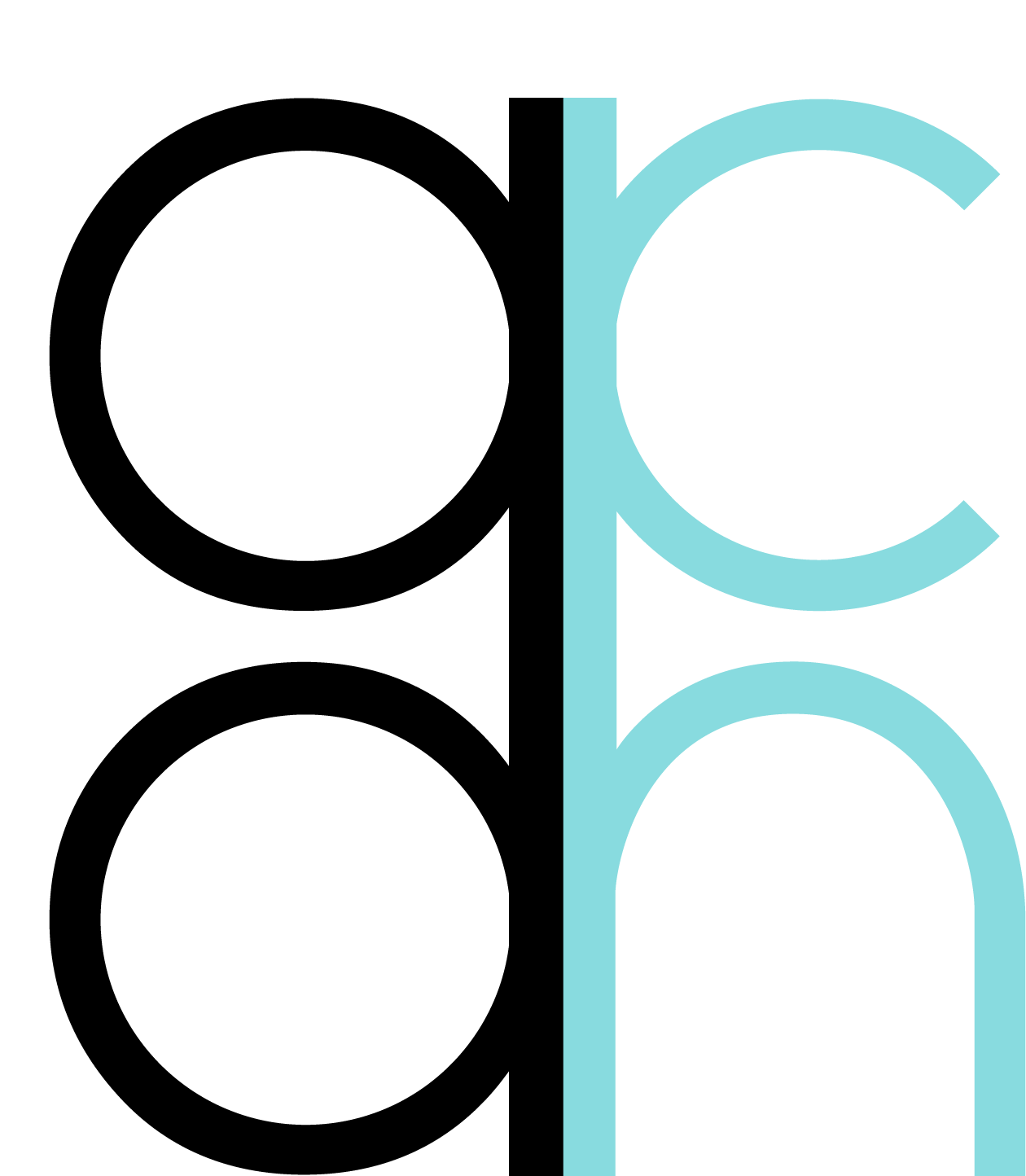Suite
Bezeichnung für Instrumentalwerke, die auf der Reihung von Einzelsätzen, meist Tänzen, beruhen. Die naheliegende Annahme, dass man schon in der frühen, usuellen Tanzmusik nach Bedarf Sätze in verschiedenem Tempo und Metrum aufeinanderfolgen ließ, wird durch die (eher spärliche) musikalische Überlieferung und Nachrichten aus dem 14.–16. Jh. bestätigt, die besonders häufig die Kombination von einem langsamen Zweier- und einem schnelleren Dreiertanz belegen (sog. Urtanzpaar, in dem die ältere Musikwissenschaft den Ausgangspunkt für die Genese der S. erkennen wollte). Die Entwicklung hin zu einer Gattung der Kunstmusik setzte allerdings erst im 17. Jh. ein. Aspekte dieses vielschichtigen Prozesses sind: die auf breiter Front seit dem 16. Jh. einsetzende Verschriftlichung von Tanzmusik und die Übernahme von Tanzformen in die komponierte Kunstmusik mit der Konsequenz zunehmender Stilisierung und Artifizialisierung bei gleichzeitiger Lösung von der Funktion als Gebrauchstanz; die Praxis, Veröffentlichungen von Tanzmusik in – den Tanzarten nach – identischen Folgen unter Beibehaltung je einer Tonart zu organisieren; schließlich die Auffassung bzw. Gestaltung solcher Gebilde als Zyklus, d. h. als geschlossenes Werkganzes (im Unterschied zur unverbindlichen Aneinanderreihung einzelner Stücke). Die betreffenden Entwicklungen verliefen weder geradlinig noch stets parallel zueinander. Vielmehr sind teilweise erhebliche Verschiebungen je nach Region und Besetzungstypus und komplexe Wechselwirkungen zu diversen Gattungsbereichen der solistischen wie der Ensemblemusik in Rechnung zu stellen. Entgegen der von der älteren Musikwissenschaft favorisierten Auffassung eines linearen historischen Ablaufs ist festzuhalten, dass „der“ S. nicht ein einziger historischer Entwicklungsstrang korrespondiert. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in einer höchst uneinheitlichen Terminologie wider. Neben dem Ausdruck S. (der sich als Bezeichnung einer Tanzsatzfolge im Ganzen überhaupt erst im ausgehenden 17. Jh. einbürgerte) begegnen Termini wie Sonata (da camera; Kammersonate), Ouverture und (in Österreich besonders häufig) Partita, Parthie u. ä. In besonderem Maße bedarf die Frage nach dem Vorliegen einer zyklischen Konzeption differenzierter Beurteilung (je nach Region, Komponist oder sogar Einzelwerk). Zwar war um 1700 im deutschen Sprachraum das Verständnis von S. als zyklischer Gattung der Instrumentalmusik ausgebildet (die im Musikschrifttum nun als eigenständige Form der Sonate gegenübergestellt wurde), in der kompositorischen Praxis ist aber weiterhin ein vielfach abgestuftes Spektrum zwischen loser Reihung und zyklischer Geschlossenheit festzustellen.Unter den (hauptsächlich aus dem deutschen Sprachraum stammenden) Drucken des frühen 17. Jh.s, innerhalb derer eine bestimmte Kombination von Tänzen (in jeweils einer Tonart) mehrfach wiederkehrt, finden sich auffällig viele von österreichischen bzw. in Österreich wirkenden Komponisten. Die drei- und viersätzigen, aus Tänzen wie Paduane, Intrada, „Dantz“ und Galliarde gefügten S.en von J. Thesselius (1609), P. Peuerl (1611, 1620, 1625) und I. Posch (1618, 1621) haben insofern schon früh Beachtung in der Musikgeschichtsschreibung gefunden, als darin teils alle, teils je zwei Sätze zueinander in einem Variationsverhältnis stehen. Als Erfinder dieser sog. Variations-S. galt (in Unkenntnis der Stücke von Thesselius) lange Zeit P. Peuerl. Heute wird dagegen von Einflüssen niederländisch-französischer Tanzmusik, der italienischen Lautenpraxis, aber auch der englischen Virginalisten ausgegangen.
In der solistischen Musik (für Laute und Clavier) kam es relativ früh zu einer – jedenfalls im Vergleich zur Ensemblemusik weitreichenden – Standardisierung des S.n-Aufbaus. Ausgangspunkt war die in der französischen Lautenmusik (möglicherweise parallel zu oder in Abhängigkeit von der Ballettmusik) bereits in den 1620/30er Jahren gebräuchliche Folge aus Allemande, Courante und Sarabande, die gegen die Jh.mitte um die Gigue erweitert wurde. Der zumal in Österreich nachhaltigen Wirkung von J. J. Froberger, der dieses Muster konsequent in seinen Cembalo-S.n zur Anwendung gebracht hatte, ist zuzuschreiben, dass es fortan im deutschen Sprachraum den Kern auch der Clavier-S. bildete. Während die Gigue bei Froberger noch an zweiter Stelle (nach der Allemande) steht, rückte sie in der 2. Hälfte des 17. Jh.s (vermutlich in Folge einer Verlangsamung der Sarabande) an den Schluss. Dass Frobergers Werke in einem posthumen Amsterdamer Druck aus 1696 in diesen sog. meilleur ordre gebracht wurden, war ein entscheidender Beitrag zu dessen Etablierung als Norm im Spätbarock (und hatte zudem Auswirkungen auf die Musikwissenschaft des 20. Jh.s, die im meilleur ordre lange Zeit die „klassische“ S.n-Form des ganzen Barock zu erkennen meinte; in beträchtlichem Maße leistete dieser Sichtweise G. Adler Vorschub, der 1899 in den DTÖ Frobergers S.en in der nicht-authentischen Reihenfolge mit der Gigue als Schlusssatz herausgegeben hatte).
Von Froberger ausgehend, spielte die S. in der von den Wiener Hoforganisten getragenen Claviermusiktradition bis um die Mitte des 18. Jh.s eine prominente Rolle (A. Poglietti, J. C. Kerll, F. M. Techelmann, F. T. Richter, Go. Muffat). Wie europaweit üblich konnte der meilleur ordre modifiziert, (seit dem späteren 17. Jh. insbesondere um die damaligen französischen Modetänze wie Menuet, Gavotte, Bourrée oder Rigaudon, aber auch um eine Chaconne bzw. Passacaille und gelegentlich um Charakterstücke) erweitert und an einzelne Sätze eine variierte bzw. diminuierte Fassung (ein sog. double) angeschlossen werden. Es entspricht weiterhin einer gesamteuropäischen Tendenz, wenn ab der 2. Hälfte des 17. Jh.s ein Einleitungssatz (sei es ein quasi-improvisatorisches Präludium, sei es eine Form der freien Tastenmusik wie die Toccata oder seit ca. 1700 auch eine französische Ouverture) vorangestellt wurde. Charakteristisch für die barocke Wiener Produktion ist die schon bei W. Ebner und Froberger einsetzende Kombination von S. und Variationenfolge sowie programmatische S.n-Zyklen (insbesondere bei Poglietti). Bedeutsam sind weiterhin die Clavierpartiten Ge. Muffats. Sie stellen die ältesten überlieferten Beispiele für die Aufnahme von Charakterstücken in die Clavier-S. dar.
Auch im umfangreichen österreichischen Lautenmusikrepertoire war unter französischem Einfluss die viersätzige Standardfolge seit der Mitte des 17. Jh.s die Norm (F. I. Hinterleithner, W. L. v. Radolt, J. G. Weichenberger, J.-A. de Saint Luc, J. A. Losy). Sie tritt hier wie in der Claviermusik häufig in modifizierter bzw. erweiterter Gestalt auf, insbesondere wird ab ca. 1700 gerne mit einem an die französische Ouverture angelehnten Satz eröffnet.
Einen funktional und dadurch ein Stück weit auch stilistisch abgrenzbaren Bereich stellt die Ballett-S. dar, die ihren Platz bei höfischen Unterhaltungen und Festveranstaltungen und v. a. als Tanzeinlage (meist am Aktschluss) in den diversen weltlichen musikdramatischen Produktionen hatte. Infolge der blühenden Festkultur und der Einrichtung eines regelmäßigen Theaterbetriebs am Wiener Hof unter Leopold I. bestand ein immenser Bedarf an solcher Musik, den eigens dafür beschäftigte Komponisten zu befriedigen hatten. Unter ihnen ragt – der Zahl der Stücke wie der Qualität nach – J. H. Schmelzer heraus, dem sein Sohn A. A. Schmelzer und J. J. Hoffer nachfolgten. Weiterhin betätigten sich als Ballettkomponisten in Wien W. Ebner, A. Poglietti und Leopold I., in Kremsier resp. Salzburg H. I. F. Biber. Die barocke österreichische Ballett-S. wird üblicherweise durch eine Intrada eingeleitet und eine Retirada beendet; soweit die lückenhafte Überlieferung erkennen lässt (zumeist sind nur die Außenstimmen erhalten), herrscht eine einfache, homophone, im Regelfall vier- oder fünfstimmige Faktur vor. Zwischen den Rahmensätzen kommen in gänzlich unstandardisierter, offenbar an inhaltlich-programmatischen Vorgaben ausgerichteter Reihenfolge und Anzahl diverse Tanzarten zur Verwendung, teils ältere (italienische) wie Trezza, Canario, Moresca, Saltarello, Passamezzo oder Follia, teils die im Lauf des Jh.s immer stärker hervortretenden französischen wie Courante, Sarabande, Gigue oder die gegen Ende des 17. Jh.s beliebten französischen Modetänze.
Ein äußerst heterogenes Bild bietet dagegen die Kammer-Ensemblemusik. Dies betrifft zunächst die Besetzung – das Spektrum reicht von Violine und Bass über das (erst anfangs des 18. Jh.s dominierende) Trio, die Concerto grosso-Anlage (Ge. Muffat 1682, 1701) und den aus der französischen Ballett- und Theatermusik stammenden fünfstimmigen Satz (Ge. Muffat 1695, 1698) bis zu vielstimmigen, abwechslungsreichen Kombinationen (z. B. J. J. Fux 1701) –, v. a. aber die einzelnen Tanzarten und den S.n-Aufbau, bei dem es in keiner Phase zu einer mit der Clavier-S. vergleichbaren Vereinheitlichung kam. Dies resultiert aus dem Umstand, dass sich in der Kammer-S. besonders in Österreich verschiedene Gattungstraditionen kreuzten (die zudem schon für sich zur Unregelmäßigkeit der Satzfolge tendierten). Zu erwähnen sind zunächst die italienische Sonata da camera (G. B. Buonamente 1629, G. B. Viviani 1678 und, von Arcangelo Corelli beinflusst, Ge. Muffat 1682 sowie J. J. Stuppan von Ehrenstein 1693); dann die (in ganz Europa modellhaft wirkende) französische Ballettmusik, im speziellen seit dem ausgehenden 17. Jh. die – durch selbständige Veröffentlichung der Instrumentalsätze aus Bühnenwerken von Jean-Baptiste Lully entstandene – Ouverturen-S. (Ge. Muffat 1695 und 1698, Fux 1701, Stuppan von Ehrenstein 1702); schließlich wurden häufig Elemente aus der österreichischen Ballett-S. integiert (u. a. bei Biber 1680, 1696, A. Ch. Clamer 1692 sowie Fux 1701) oder gelegentlich der meilleur ordre aus der Clavier-S. übernommen (Biber 1680). Zur Vielfalt trägt nicht zuletzt der Typenreichtum der Einleitungssätze und die gerade in Österreich geübte Praxis bei, in die Tanzfolge „abstrakte“, nur mit Tempobezeichnungen versehene Sätze einzurücken (wodurch zudem die Grenze hin zur häufig verkappte Tanzsätze beinhaltenden Kirchensonate durchlässig wird).
Ab der Mitte des 18. Jh.s wird die S. durch die neuen instrumentalmusikalischen Gattungen verdrängt, in denen abstrakte, nach dem Sonatenprinzip organisierte Sätze die Oberhand gewinnen, und die auf zyklische Abrundung bzw. Entwicklung zielen. Allerdings ist gerade für die österreichische Instrumentalmusik abermals ein vielschichtiger Übergangsprozess charakteristisch. So haben „vorklassische“ Komponisten wie G. M. Monn, G. Ch. Wagenseil und F. Tuma noch Clavier- bzw. Triopartiten vorgelegt, die teils den meilleur ordre zur Grundlage haben, teils in diversen Kombinationen und wechselnder Zahl (auch) barocke Satztypen oder eine von der französischen Ouverture herkommende Eröffnung umfassen. V. a. aber wirkte die S.n-Tradition in Genres wie Partita, Divertimento, Serenade, Kassation etc. insofern weiter, als diese eine grundsätzlich nicht standardisierte Satzfolge aufweisen und regelmäßig mindestens ein Menuett beinhalten. Auch im üblicherweise dreisätzigen Wiener Klavierdivertimento ist das Menuett (im charakteristischen Unterschied zur Klaviersonate italienischer Provenienz) fixer Bestandteil. Abgesehen von seltenen, abseits der allgemeinen Stilentwicklung stehenden Ausnahmen wie W. A. Mozarts Klavier-S.n-Fragment KV 399 (385i), das dem Versuch der produktiven Aneignung der Musik von J. S. Bach und G. F. Händel enspringt, bleiben aus der barocken S. stammende Tanztypen und die Variabilität der Satzfolge im späteren 18. Jh. nur noch in Balletteinlagen in Opern erhalten (z. B. bei Ch. W. Gluck und in Mozarts Idomeneo).
In der 2. Hälfte des 19. Jh.s setzte europaweit eine Renaissance der S. ein. Im Hintergrund stand dabei die intensivierte Auseinandersetzung mit alter Musik, v. a. mit Bach und Händel. Der entscheidende Faktor für die neuerliche Beliebtheit der Gattung war freilich, dass sie – einer niedrigeren Stillage zugeordnet – als kompositorisch wie ästhetisch weniger anspruchsvolle Alternative zur immer weiter monumentalisierten, mit der Bedeutung eines Ideenkunstwerks aufgeladenen Symphonie erschien.
Zu den ersten Komponisten, die wieder ausdrücklich als S.en bezeichnete Werke vorlegten und dabei auch auf barocke Tanzformen zurückgriffen, zählt F. Lachner. In denselben Kontext einer klassizistischen, sich von der Symphonie absetzenden Linie gehört die gerade in Österreich gepflegte Serenade (J. Brahms, R. Fuchs). Die neu etablierte S.n -Tradition (zu der um 1900 u. a. A. v. Zemlinsky und F. Schreker, aber auch G. Mahler mit seiner Einrichtung Bachscher Orchesterouverturen beitrugen) erlebte nach dem Ersten Weltkrieg im Zeichen der neoklassizistischen (Klassizismus) bzw. neusachlichen (Neue Sachlichkeit) Abwendung von der Ästhetik des 19. Jh.s und Rückwendung hin zur alten Musik eine besondere Konjunktur. Die S. stieg nun wieder zu einem allgemein gebräuchlichen Genre auf, das von Komponisten verschiedenster Richtungen, nicht nur von strikt neoklassizistisch orientierten, sondern z. B. auch der Wiener Schule angehörenden aufgegriffen wurde (A. Schönberg, F. Schreker, J. Marx, J. M. Hauer, Alban Berg, E. Wellesz, H. Gál, J. Lechthaler, E. Krenek, J. Takács, C. Bresgen, R. Schollum). In der Folge blieb sie auch während der ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg aktuell, wie zahlreiche Kompositionen von Vertretern der damals älteren wie jüngeren Generation zeigen (H. E. Apostel, L. Spinner, K. Schiske, G. v. Einem, A. Logothetis, P. Kont, E. Kölz, F. Cerha, P. Angerer, O. M. Zykan).
Über die Unterschiede in Stil, Kompositionstechnik und Musiksprache hinaus ist die Gattung seit dem späteren 19. Jh. in mehrfacher Hinsicht durch Diversifikation gekennzeichnet. Neben der gleichsam „klassischen“, zunächst dominierenden Ausprägung als Orchester- oder Klavierwerk entstanden Stücke für die verschiedensten Kammerensembles, für typische Spielmusikbesetzungen mit Blockflöte, Mandoline, Gitarre etc., aber auch (in offenkundiger Anlehnung an Bach) für Solo-Violoncello oder andere solistische Melodieinstrumente. Eine große Bandbreite besteht in Charakter, Gestus und „Inhalt“. So gibt es – in vielfacher Überschneidung bzw. fließendem Übergang – bewusst einfach gehaltene, unbekümmert-beschwingte bzw. in den Bereich der Haus- oder Spielmusik hineinragende, betont musikantische S.en (gern mit Titeln wie „Kleine“, „Heitere“, „Fröhliche“ S. u. ä.), explizit historisierende (sog. S.en „im alten Stil“), programmatische (die z. B. der „Darstellung“ bestimmter Regionen oder Länder oder auch persönlich Biographischem gewidmet sind), „Ballett-“, „Tanz-“, „Etüden-S.en“ usw. S.en können als Originalkompositionen entstehen oder durch Auszug von Nummern bzw. Ausschnitten aus Bühnenwerken (Schreker, Alban Berg, M. Rubin) oder aus Filmmusiken (z. B. H. Eisler) zustande kommen. Geradezu unbegrenzt ist das Repertoire der als Bestandteil einer S. in Frage kommenden Einzelsätze. Neben Tänzen der verschiedensten Epochen, Regionen und musikalischen Sparten begegnen Charakterstücke, „abstrakte“ Sätze und Formen aller Art. Insgesamt erscheinen damit im 19. und 20. Jh. als Signum der S. (und zugleich als Grund für ihre Attraktivität) die Ungebundenheit des formalen Aufbaus, insbesondere die geringeren Anforderungen hinsichtlich eines entwicklungsartigen Zusammenhangs und zyklischer Verknüpfung im Kontrast zu den traditionellen, stärker durch Gattungsnormen „belasteten“ Formen wie Symphonie, Streichquartett oder Sonate.
Literatur
NGroveD 24 (2001); MGG 8 (1998); HmT 1991; E. Wellesz, Die Ballett-S.n von Johann Heinrich und Anton Andreas Schmelzer 1914; K. Nef, Gesch. der Sinfonie und S. 1921; P. Nettl in StMw 8 (1921); K. Geiringer in StMw 16 (1929); F. W. Riedel, Quellenkundliche Beiträge zur Gesch. der Musik für Tasteninstrumente in der 2. Hälfte des 17. Jh.s (vornehmlich in Deutschland) 1960, 21990; H. Beck, Die S. 1964; J. Webster in JAMS 27 (1974); S. C. Park, The Seventeenth-century Keyboard S. in South Germany and Austria, Diss. Bryn Mawr College 1980; I. Stampfl, Georg Muffat. Orchesterkompositionen 1984; MGÖ 1–2 (1995); A. Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 1: Von den Anfängen bis 1750, 1997; G. Fleischhauer (Hg.), [Kgr.-Ber.] Die Entwicklung der Ouverturen-S. im 17. und 18. Jh. Michaelstein 1993, 1996.
NGroveD 24 (2001); MGG 8 (1998); HmT 1991; E. Wellesz, Die Ballett-S.n von Johann Heinrich und Anton Andreas Schmelzer 1914; K. Nef, Gesch. der Sinfonie und S. 1921; P. Nettl in StMw 8 (1921); K. Geiringer in StMw 16 (1929); F. W. Riedel, Quellenkundliche Beiträge zur Gesch. der Musik für Tasteninstrumente in der 2. Hälfte des 17. Jh.s (vornehmlich in Deutschland) 1960, 21990; H. Beck, Die S. 1964; J. Webster in JAMS 27 (1974); S. C. Park, The Seventeenth-century Keyboard S. in South Germany and Austria, Diss. Bryn Mawr College 1980; I. Stampfl, Georg Muffat. Orchesterkompositionen 1984; MGÖ 1–2 (1995); A. Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 1: Von den Anfängen bis 1750, 1997; G. Fleischhauer (Hg.), [Kgr.-Ber.] Die Entwicklung der Ouverturen-S. im 17. und 18. Jh. Michaelstein 1993, 1996.
Autor*innen
Markus Grassl
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2006
Empfohlene Zitierweise
Markus Grassl,
Art. „Suite‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2006, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e3f9
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.