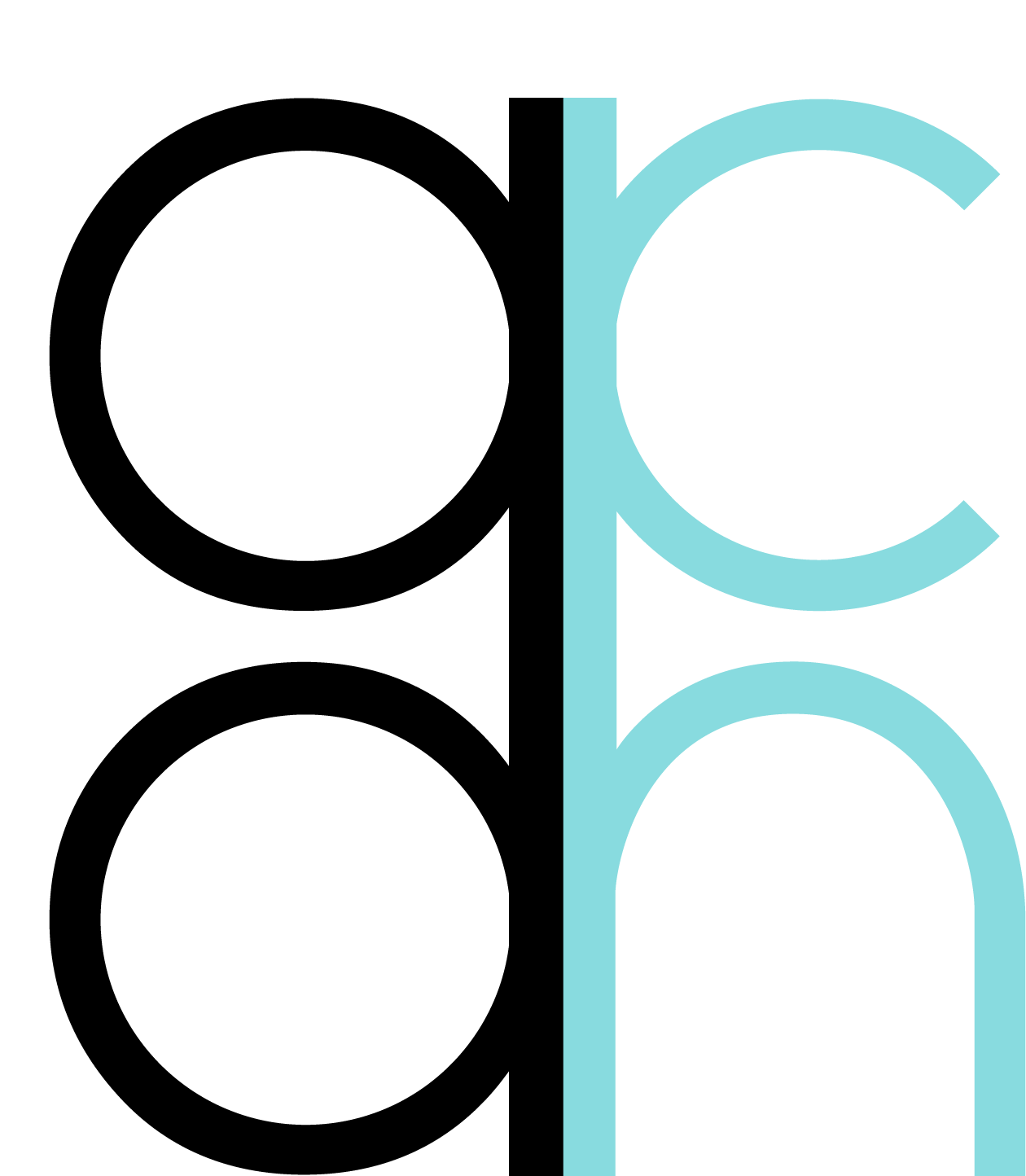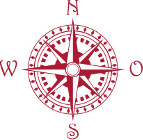Walzer
Paartanz im Dreivierteltakt, der sowohl als Abschlussfigur der österreichisch-süddeutschen Ländler als auch als selbständiger Rundtanz getanzt (I) und in letzterer Form nicht ganz zu Recht als deutscher „Nationaltanz“ (z. B. Johann Wolfgang v. Goethe 1829) oder österreichischer „Tanz“ schlechthin angesehen wurde/wird. Engere Beziehungen zu Österreich weisen nur die Wandlung des Volks- zum Gesellschaftstanz (II) und in diesem Zuge v. a. die Entwicklung jener Kompositionsform auf, die als Wiener W. bezeichnet wird (III). Man sollte demnach verschiedene Begriffsebenen auseinanderhalten.Den W. einfach „als die losgelöste Schlußfigur des Ländlers“ (Wolfram) anzusehen greift zu kurz. Die Bezeichnung W. ist zwar relativ jung (spätes 18. Jh.), bezieht sich jedoch auf die zweifellos viel ältere Figur bzw. Ausführungsform des „walzens“ (= drehen). Sofern sie also auf vergleichbare Bewegungsabläufe verweist, ist sie vorerst von anderen Namen für ungeradtaktige Volkstänze wie Dreher , Weller, Spinner oder Schleifer nicht zu trennen. Diese sind in Mitteleuropa und darüber hinaus – ähnlich wie die im Barock zum französischen Hoftanz stilisierte provenzalische Volte – seit dem 15. Jh. (v. a. durch Verbote) greifbar, in ihren unterschiedlichen Ausführungen aber nicht genauer bekannt (z. B. drehen und hüpfen). Mit seinen je acht Takten Dreh- und Rundtanz ist auch so der heute (2006) noch beliebte obersteirische Haxenschmeißer (anderswo als Schwedischer bekannt) als ein Nachfahre erkennbar. Die wiederholten Verbote von Drehtänzen (explizit des „Walzens“ in Salzburg 1671 u. 1736) hatten wohl stets „moralische“ Gründe (enge Umfassung des Paars, Küssen, Hochheben der Tänzerin, unabsichtliches [beim Drehen] und absichtliches Anheben der Röcke u. ä.).
Spätestens gegen 1600 setzte ein gewisses höfisches Interesse (parallel zu sog. Wirtschaften etc.) an solchen Tänzen ein. Sie figurieren dann unter den gleichbedeutenden Sammelbezeichnungen frz. Allemande , ital. (Ballo) Tedesco und dt. Deutscher (Tanz) . Von frz. Seite wurde das Tanzen in enger Haltung, mit verschlungenen Figuren und Hüpfschritten als „typisch deutsch“ angesehen. Das wurde von der dt. Frühromantik des 18. Jh.s als Ausdruck nationalen Wesens aufgegriffen (z. B. Goethe 1774) und trug – nach wie vor unter dem Oberbegriff Deutscher und im gesamten süddeutschen Raum – die Akzeptanz des (hier entsprechend „züchtigeren“) Walzens im bürgerlichen Gesellschaftstanz.
In diesem Zuge, aber auch im Vorfeld der spezifischen Form des Wiener W.s sind die in den 1780er Jahren in Wien einsetzenden Drucke von Ländlerischen (Tänzen) von J. B. Vanhal (1787), W. A. Mozart (1791), F. Kauer (1795), J. G. Lickl (1798) u. a. zu sehen: Sie belegen nicht nur das vonseiten des Hofes (Josephinismus) geförderte Interesse der Wiener Gesellschaft an Vergnügungen der ländlichen Bevölkerung, sondern lassen auch eine zunehmende bürgerlich-städtische Differenzierung von ländlerisch und walzerisch innerhalb des Deutschen erkennen, während die ländlichen Tanzträger selbst diese Unterscheidung nicht mitmachten. Dies ist in Einsendungen zu den Volksmusiksammlungen unter Erzhg. Johann und der Gesellschaft der Musikfreunde (Volksliedsammlung) mehrfach belegt und unter dem Gesichtspunkt allein der Nutzung durchaus verständlich. Die Differenzierung ist jedoch zunehmend sowohl choreographischer als auch musikalischer Natur: bei den ländlerischen Formen dominiert nach wie vor die Verschiedenartigkeit von Tanzfiguren (darunter auch solche des Hebens und Hüpfens) und ist die Begleitmusik einfacher (Double-artige Umspielungsfiguren von Akkordfolgen zu einfachen Fundamentbässen, jedoch unterschiedlich „verrissene“ Rhythmik). Die walzerische Ausführung hingegen besteht allein aus dem Drehen des Paares um die eigene Achse (wohl jetzt endgültig zu einem geschliffenen, jedenfalls niedrigen Sechserschritt nach links oder rechts) bei gleichzeitiger Vorwärtsbewegung und womöglich Umrundung des Tanzplatzes nach rechts; gegenüber dieser Einfachheit ist die Begleitmusik anspruchsvoller: sie lässt der Melodik mehr Raum, bevorzugt sog. Gitarrenbässe als Begleitung, differenziert den Rhythmus jedoch nur innerhalb eines Takts (8 oder 16 pro Periode), indem dem stark betonten Abtakt zwei ebenso stark gespreizte Taktteile folgen (der zweite verfrüht, der dritte verspätet; erinnert also an die Längung des zweiten Taktteils in der ehemaligen Sarabande). Wenn Mozart das walzerische Idiom in allen drei Da Ponte-Opern (1786/90) als Verweise auf Stubenmädchen einsetzte, nutzte er es nicht nur zur sozial-gesellschaftlichen Darstellung (wie bekanntlich das Menuett für das Höfische und den Deutschen für das Bäurische in Don Giovanni), sondern liefert er auch einen wertvollen Anhaltspunkt für die Chronologie der Entwicklungen in der 2. Hälfte des 18. Jh.s. Doch sind die Versuche, eine W.-Mode der Zeit auch auf die Bühne zu bringen, nicht unbedingt von Wien ausgegangen (vgl. André-Ernest-Modeste Grétrys Air pour valser im Ballett zu Colinette à la cour, Paris 1782; V. Martín y Solers W. in seiner Una cosa rara, Wien 1786).
Immerhin lässt sich bei Mozart die somit bereits grundgelegte weitere musikalische Stilisierung gut nachvollziehen: die Aneinanderreihung von je einem halben oder ganzen Dutzend gleichartigen Tänzen gehört zu den Selbstverständlichkeiten traditioneller Aufzeichnungen (Zyklus), ebenso die größtmögliche Differenzierung der einzelnen Satzglieder, während deren Planung nach Tonarten ebenso als Zeichen von Stilisierung und gehobenerem Anspruch zu werten ist wie der Einschub von Trios und v. a. das Anhängen einer zunehmend langen und zur Tanzbegleitung nicht mehr geeigneten Coda (z. B. Sechs dt. Tänze KV 509, 1787; Sechs dt. Tänze mit Trios KV 536, 567). Damit erhält der Zyklus eigenes kompositorisches Gewicht. Nicht nur J. Haydn, der ansonsten in seinen Tänzen durchwegs einfacher blieb als Mozart, griff diese Tendenz auf (z. B. Dt. Tänze Hob. IX:12 u. 13, 1792), sondern auch andere Komponisten (z. B. St. Ossowsky 1789; ein gewisser Plüharsch ca. 1800, ein L. Scherf 1806). Nicht selten wurde die Coda für eigenständige Schilderungen (z. B. einer Battaglia oder Jagd) genutzt. Bereits um 1800 scheint eine Coda für W. üblich gewesen zu sein (C. M. v. Weber, Allemandes/W. 1801; F. J. Freystädtler 1808; J. N. Hummel 1808 u. a.).
Mit der Beschleunigung des Tanzes dürfte zusammenhängen, dass die Bündelung von W.n zu sechs tendierte (z. B. Ph. J. Riotte 1804; A. M. Gyrowetz 1806; L. v. Call 1806, K. Kreutzer 1808 u. a.). Obwohl eine derartige Rahmenbildung bereits für die ältere Aufzugssuite und auch in Divertimenti eine Rolle gespielt hatte, wurde es offenbar zunächst nicht als vorrangig angesehen, der abschließenden Coda auch eine Introduktion gegenüberzustellen. Als eigentliche Auslöser dafür dürften eher praktische Momente anzusehen sein, die bereits den traditionellen Eingang, Anstrich oder Tusch volkstümlicher Tanzmusikanten (z. B. sog. Linzer Geiger) hervorgebracht hatten: neben der Überprüfung der Stimmung des Instruments v. a. die Funktion der Ankündigung eines neuen oder anderen Tanzes. Sie konnten daher auch in stilisierter Form alle Abstufungen von einigen Takten bloßer Begleitfiguren (Charakterisierung des Tanzes) bis zu Fanfarenmelodik (Ankündigung) und schließlich zu breit ausgearbeiteten Abschnitten aufweisen. Dem Vorbereitungscharakter kommt jedenfalls die größere Bedeutung zu als der Möglichkeit, dazu bereits zu tanzen; im Extremfall können Einleitungen sogar geradtaktig sein. Es wird somit kein Zufall sein, dass die frühesten gedruckten Tanzsammlungen mit Introduktion und Coda von einem Komponisten stammen, der engen Kontakt zu „Linzer“ bzw. oberösterreichischen Landla-Geigern hatte: J. B. Schiedermayr (XI Dt. mit Introduktion und Coda 1807; 11 Redout-Dt. mit samt Trios, mit Introduktion und Coda 1808; vgl. auch Fr. Schuberts Zwölf Wiener Dt., D 128, 1812). In den ersten drei Dezennien des 19. Jh.s weisen Zyklen von Deutschen und Ländlern sogar öfter Introduktionen und Coda (Finale) auf als W., d. h. wohl, dass dieser Rahmen von jenen übernommen wurde.
Das erste Beispiel nach dem Muster Einleitung – W.-Kette – Coda anzugeben, fällt daher schwer. (Aber sicher war es nicht, wie oft zu lesen, Webers Rondo brillant Aufforderung zum Tanze von 1819, das einerseits nicht nur W. enthält und andererseits eben in Rondoform gehalten ist.) Auch fand eine rasche oder gar allgemeine Übernahme der Prinzipien nicht statt. Immerhin hat z. B. Ferdinand Gruber um 1825 die Einleitungstakte auf zehn bis 14 erhöht, sie aber nicht extra bezeichnet. Demgegenüber sah M. Pamer in volkstümlicher Tradition zwar gelegentlich einige Einleitungs- und/oder Abschlusstakte vor, verzichtete aber auf eine ausgesprochene Coda. Seine – mehrmals explizit als Wiener bezeichneten – W. bestehen jedoch gelegentlich nicht mehr aus 8-, sondern schon aus 16-taktigen Teilen, seine Trios sind noch gleich lang und kontrastlos. Das von der handwerklichen und im volkstümlichen Bereich selbstverständlich weiterlebenden Tanzpraxis allmählich weg führende zyklische Prinzip, welches sowohl rein musikalische als auch praktische Momente verschiedener Nutzungen verbindet, ausgewogen umgesetzt und damit endgültig jenen zwischen Tanz- und Konzertmusik vermittelnden Typus Wiener W. festgelegt zu haben, ist erst das Verdienst seiner Großmeister im Vormärz (Biedermeier): J. Lanner (s. Abb.) und J. Strauß (Vater). Beide knüpften um 1820 v. a. bei Pamer an. Bei Lanner wurde die Introduktion erst nach 1830 zur Norm, die wohl mit Rücksicht auf die Coda vorgenommene Reduktion der eingeschobenen Tänze von sechs auf fünf könnte auf Strauß zurückgehen. Trotz ihres zunehmenden Anspruchs hat diese Form (der Ausdruck Wiener W. meint auch in der Einzahl stets den Gesamtzyklus) den Kontakt zur Tanzpraxis nie ganz verloren, doch wird die Musik je nachdem unterschiedlich ausgeführt (Rubati, Dynamik etc.); der Ausdruck Konzert-W. ist also nicht notwendig, ja selten zutreffend.
Neben der zyklischen Entwicklungslinie gab es selbstverständlich stets und auf allen Ebenen auch Einzeltänze (z. B. John Field, Walze, tirée d’un rondo 1811; Schubert ab 1812; Weber, W. im Freischütz 1821; an letztere beiden anknüpfend F. Chopin 1827 und R. Schumann ab 1829). Diese Form, in Verbindung mit der in gleichem Maße ausgeweiteten, schließlich an die der Symphonik angeglichenen Orchestertechnik des Wiener W.s, hat denn erst Eingang in andere Gattungen, v. a. in Oper und Ballett, schließlich auch Solokonzert und Symphonik gefunden.
In England war der W. bereits gegen 1790 aufgegriffen, aber nicht immer enthusiastisch begrüßt worden (eine der frühesten systematischen Beschreibungen erschien 1816 in London). Eine ähnlich starke Modeerscheinung wie in Wien scheint er zuerst in Paris geworden zu sein; hier wurde die abermals als eindeutig „deutsch“ angesehene Erscheinung um 1800, v. a. durch Anknüpfung an frühere Formen nationalisiert. Nach der ersten Wiener Modewelle des späten 18. Jh.s erlebte der W. eine zweite, von den Begleitveranstaltungen zum Wiener Kongress (1814/15) ausgehende und daher auch die Höfe erreichende nahezu gesamteuropäische Verbreitung. Zweifellos hängt damit die heutige Assoziation des W.s mit Österreich und dessen Lebensgefühl im Ausland zusammen. Im Inland (nach Wiener Vorbild auch in anderen größeren Städten) blieb der W. eine bevorzugte Tanzform, das 19. Jh. wird speziell in Wien als „Jh. des W.s“ bezeichnet. Auf dieser Basis ist die skizzierte Stilisierung zu verstehen, die mit der enormen quantitativen Produktion von Tanzmusikern sowie Nutzung in unzähligen Lokalen (Casinos, Kaffeehäuser, Parks, Vergnügungsetablissements; Sophiensäle) und Veranstaltungen (Redouten) einherging und bis zu heutigem Klischee-haftem Gebrauch (v. a. in den Neujahrskonzerten) führte. Größte Bedeutung hat(te) der W. für die Entwicklung der österreichischen (Wiener) Operette.
Neben Auswanderern brachten v. a. auch sog. Nationalsänger den W. nach Amerika. Von dort kehrte ab 1874 eine langsame, aber gleitend „gegen den Takt getanzte“ Art als Boston (valse) nach Europa zurück. Daraus wurde in den frühen 1920er Jahren als Turniertanz der sog. English Waltz oder Langsame W. Dieser behält trotz der etwas abweichenden Begleitung den ineinandergreifenden Grundschritt des Wiener W.s bei, ist aber durch eine stärkere Hoch-Tief-Bewegung des Fußes (Ferse-Spitze) gekennzeichnet und wird wiederum durch Figuren erweitert.
Literatur
MGG 9 (1998); R. Flotzinger in ÖMZ 30 (1975); C. Sachs, Eine Weltgesch. des Tanzes 1933; R. Wolfram, Die Volkstänze in Österreich u. verwandte Tänze in Europa 1951; R. Flotzinger in MozartJb 2001 (2003); R. Witzmann, Der Ländler in Wien 1976.
MGG 9 (1998); R. Flotzinger in ÖMZ 30 (1975); C. Sachs, Eine Weltgesch. des Tanzes 1933; R. Wolfram, Die Volkstänze in Österreich u. verwandte Tänze in Europa 1951; R. Flotzinger in MozartJb 2001 (2003); R. Witzmann, Der Ländler in Wien 1976.
Autor*innen
Rudolf Flotzinger
Letzte inhaltliche Änderung
9.112022
Empfohlene Zitierweise
Rudolf Flotzinger,
Art. „Walzer‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
9.112022, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e62f
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.