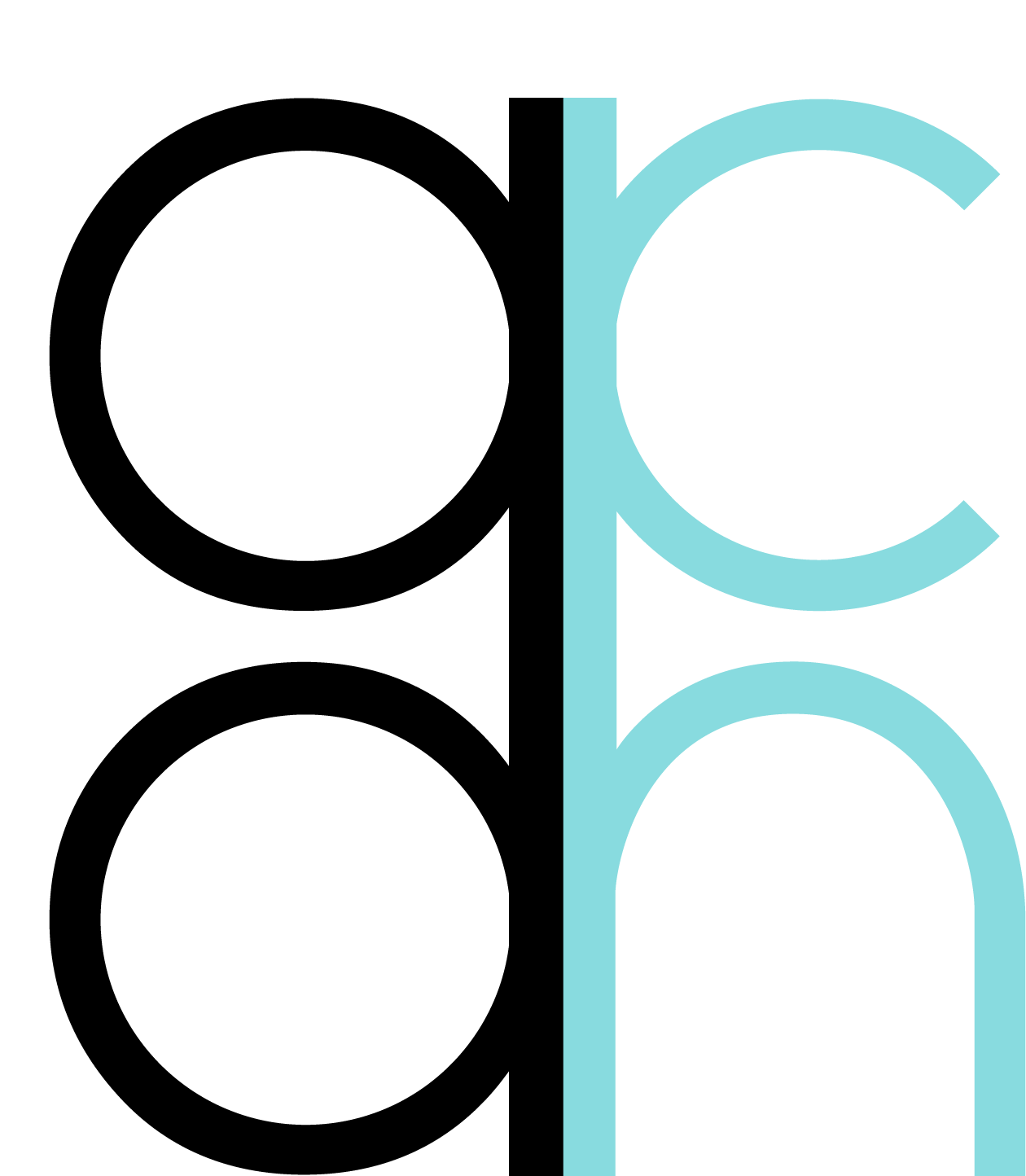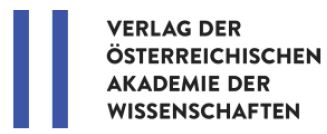Zensur
Polizeiliche Maßnahme bzw. Polizeibehörde zur Vorkontrolle von Veröffentlichungen (Drucken).
Z. als einseitig-hoheitliches Instrument tritt in feudal-absolutistischen bzw. totalitären Regimen auf, wurde bzw. wird in gewisser Weise immer noch auch durch die Kirche ausgeübt (Index-Listen verbotener Bücher), ist aber auch als Selbst-Z. der Medien Kennzeichen einer toleranten demokratischen Gesellschaft. Mit der Entwicklung des Buchdruckes zu einem Massenmedium zu Beginn der Neuzeit, erschien staatlicherseits eine Vorkontrolle der Druckwerke notwendig, um die Verbreitung von Schriften, die den inneren Frieden bzw. die Regierung gefährden könnten, im Vorfeld abzufangen (Bauernkriege, Reformation). Bereits 1522 gab es eine erste Z.-Verordnung für den Buchhandel in den österreichischen Ländern, die je nach politischer Lage unterschiedlich streng gehandhabt wurde.V. a. Maria Theresia [I] verstärkte die Kontrolle durch die Z. (Gründung der Bücherrevisions-Kommission 1752), Joseph II. lockerte sie vorerst (Z.-Freiheit 1781), doch folgte der Errichtung der Polizeihofstelle 1793 eine Verschärfung. Neben Druckwerken (Bücher, Zeitungen, Flugblätter) wurden nun Theater, Schulen, Kirchen, in der Zeit der Französischen Revolution bzw. im Vormärz auch persönliche Schriftstücke wie Briefe, von der Z. nach „staatsfeindlichen“ bzw. „sitten-“ und „religionsgefährdenden“ Äußerungen durchsucht, wobei die Definition dieser Begriffe oft der Willkür der Zensoren oblag. Die Wiener Volkskomödien (v. a. J. N. Nestroy wurde wegen Verstößen gegen das Z.-Gesetz mehrmals inhaftiert) und Volkssänger-Texte wurden oft in ihrer Originalversion von der Z. verboten, sodass die mündlich tradierte Form von der Druckversion differiert; Musik selbst war von der Z. weniger betroffen, waren doch viele der Z.-Beamten des Notenlesens unkundig, sodass oftmals „versteckte Botschaften“ (wie Luthers Choral Ein feste Burg oder gar die Marseillaise) die Z. ohne Beanstandung passierten („Den Musikern kann doch die Censur nichts anhaben – Wenn man wüsste, was Sie bei Ihrer Musik denken!“ notierte F. Grillparzer in L. v. Beethovens Konversationsheft). Unter dem Spitzelsystem des Regimes von C. W. L. Fürst Metternich erreichte die Z. in Österreich ihren Höhepunkt. Durch die Revolution 1848 abgeschafft, führte der Neoabsolutismus unter K. Franz Joseph eine Vor-Z. v. a. auf Zeitungen und Zeitschriften ein (z. B. ab 1870 auf Schriften der Arbeiterbewegung); auch die gezielte Vergabe von Konzessionen und Einhebung von Kautionen kam einer Z. gleich.
Von den Zensoren wurden die Werke in 4 Kategorien eingeteilt: 1) imprimatur bzw. admittur (Werk durfte alleine oder als Wiederabdruck in Zeitungen erscheinen), 2) transeat (Werk wurde zugelassen, darf aber nicht in Zeitungen wiedergegeben werden bzw. durch Leihbibliotheken einem größeren Leserkreis zugänglich gemacht werden), 3) erga schedam bzw. missis deletis Werke enthielten problematische Passagen und mussten genau kontrolliert werden, d. h. konnten nur unter Bewilligung des Zensors an Handelsleute und Gelehrte weitergegeben werden) und 4) damnatur bzw. non admittur (Werke wurden verboten und kamen auf eine Index-Liste).
Während des Ersten Weltkriegs wachte ein Kriegsüberwachungsamt über die Einhaltung der Z.-Vorschriften. Auch im Ständestaat (Faschismus) wurde, um dem Umgreifen des Nationalsozialismus Herr zu werden, die Z. wieder eingeführt (traf jedoch auch kommunistische und sozialdemokratische Schriften) bzw. wurde durch gezielte Lizenzvergabe und die Amtliche Nachrichtenstelle die öffentliche Meinung gesteuert und kontrolliert. Besonders rigoros wurde die Z. im Nationalsozialismus gehandhabt, die mittels Geheimer Staatspolizei (GESTAPO) alle Meinungsäußerungen der Bürger kontrollierte. 1945–53 wurden durch die Österreichische Z.-Stelle das öffentliche Leben wie auch Briefe durch die Alliierten kontrolliert. Seit 1955 gibt es keine Z.-Behörde in Österreich mehr, doch ist Vor- und Nachkontrolle der Medien üblich bzw. haben sich die Medien einer freiwilligen Selbstkontrolle verschrieben. Verbote von Theaterstücken oder Druckwerken wurden seither zwar fallweise ausgesprochen, jedoch ausschließlich aufgrund einer Verurteilung durch ein unabhängiges österreichisches Gericht.
Literatur
Czeike 5 (1997); A. M. Hanson, Die zensurierte Muse 1987; ÖL 1995; MGÖ 2 (1995).
Czeike 5 (1997); A. M. Hanson, Die zensurierte Muse 1987; ÖL 1995; MGÖ 2 (1995).
Autor*innen
Elisabeth Th. Hilscher
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2006
Empfohlene Zitierweise
Elisabeth Th. Hilscher,
Art. „Zensur‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2006, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e79d
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.