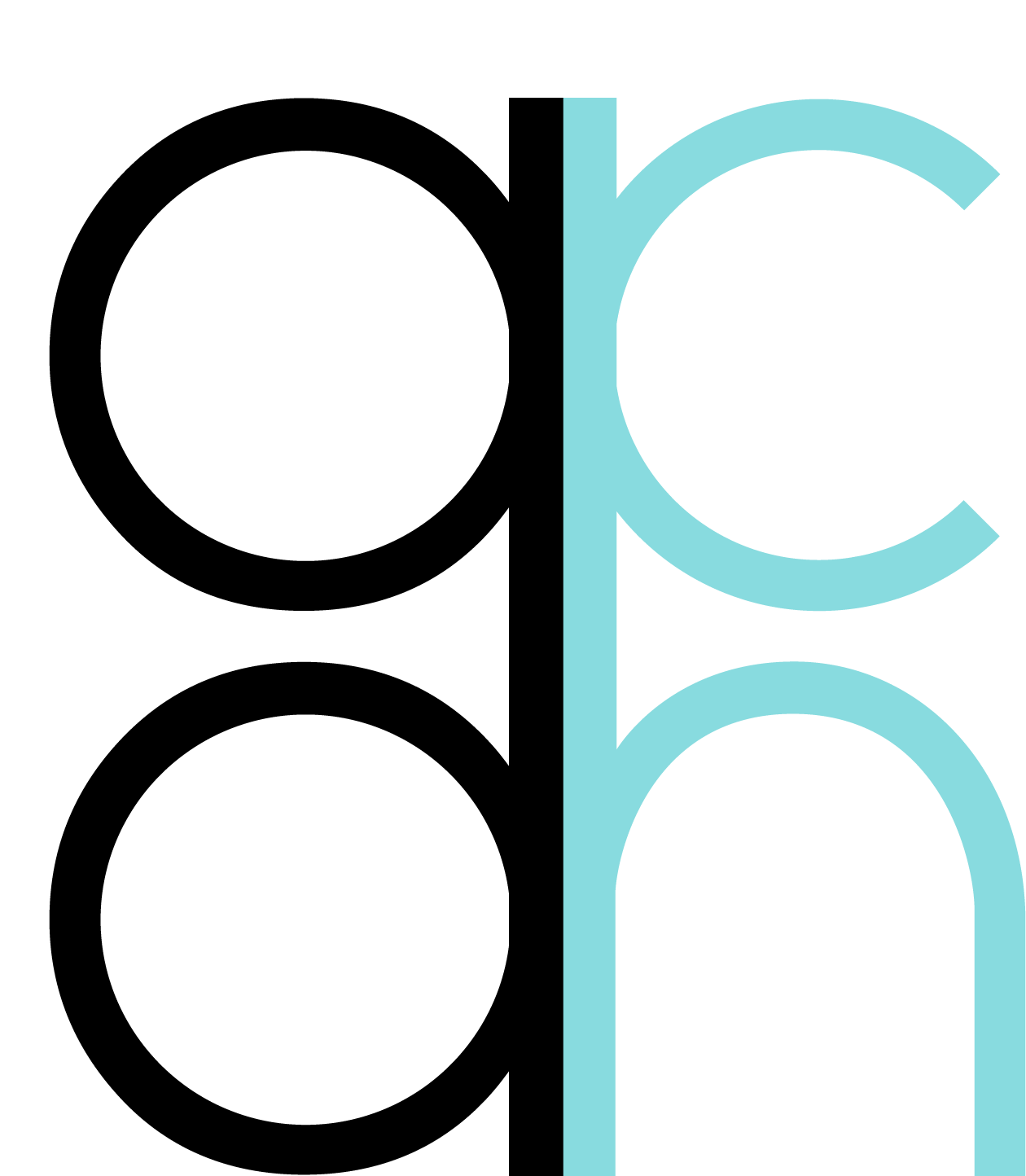Ausdruck
Im Allgemeinen sicht- oder hörbares Zeichen innerer Vorgänge, speziell auf die Musik angewendet, damit ein wichtiger Begriff der Ästhetik. Das Sprechen von musikalischem A. sucht der Verhältnisbestimmung zwischen einem akustisch Gegebenen und dessen geschichtlich wandelbarer ästhetischer Bedeutung gerecht zu werden. Bereits im Hinblick auf die Musik des 16. und 17. Jh.s könnte man mithilfe des Begriffs ein beabsichtigtes, anschaulich werdendes Moment des Bedeutens dingfest machen: Zwischen der Figurenlehre der „musica poetica“ und der musikalischen Deklamationskunst der „seconda prattica“ wird dabei die nachahmende Darstellung von Gefühlen und Seelenzuständen mit der Sprache als Vermittlerin von Wort- und Textinhalten verbunden. In der zweiten Hälfte des 18. Jh.s entsteht in Reaktion auf die zunehmend als stereotyp empfundene imitatio des Vokabulars von Figuren- und Affektenlehre eine Musik, die sich durch dynamische und Bewegungsanalogien auch dem Duktus der Wortsprache anzunähern bestrebt ist. Dem tönenden Material wird zugetraut, einen grammatikalisch und syntaktisch eigenständigen Sinn artikulieren zu können. Nicht nur die Ästhetik als Disziplin der Erfahrung vom sinnlichen Wahrnehmen, sondern auch die Musik zeigt sich in dieser Zeit als Gegenstand der Selbstgesetzgebung vernünftig handelnder Subjekte entdeckt: A. wird als Möglichkeit des Künstlers verstanden, „seine Ichheit in der Musik herauszutreiben“ (Christian Friedrich Daniel Schubart), als „successiver Ausbruch der Gefühle“ (Heinrich Christoph Koch). Der zunehmenden Aufmerksamkeit der Kunstbetrachtung für das schöpferische Individuum genügen aber auch die Ansprüche einer nachaufklärerischen Empfindungsästhetik bald schon nicht mehr. In den Mittelpunkt der romantischen Musikanschauung Wilhelm Heinrich Wackenroders, Ludwig Tiecks und E. Th. A. Hoffmanns tritt um 1800 der grundlegende Anspruch, dass musikalische Form statt der bloßen Erscheinung eines Gedankens oder eines Gefühls selbst Gedanke sei und sich „selber poetisch kommentieren“ könne (L. Tieck). Das Nachahmungsprinzip findet sich nunmehr durch einen metaphysischen Anspruch des Bedeutens ersetzt: Musik wird zum A. begriffsloser Transzendenz. Das Künstler-Subjekt erscheint als Medium eines Anspruchs, dem es (in bewusster Dialektik zum dichterischen Wort) um die Unverwechselbarkeit einer autonomen musikalischen Sprache zu tun ist. Aus dem Geist der Musik erfundene Programme (Hector Berlioz), das „Poetische“ (R. Schumann) oder eine „dichterische Absicht“ (Rich. Wagner) treten dabei an, ein als erstarrt empfundenes überliefertes Formenrepertoire zu entgrenzen. In Kompositionslehrbüchern, die die früheren Handwerkslehren ablösen, zeigen sich Bauformen nur mehr als schematische Grundrisse erklärt, denen der Schüler das Bemühen um eine Befreiung vom „quadratischen“ Gleichmaß innerhalb der Syntax und einer musterhaft eingesetzten Harmonik entgegenzusetzen hat. Form wird so zunehmend als vom musikalischen A. abziehbare eigenständige Kategorie der Satzgestaltung wahrgenommen, während die thematische Arbeit zum wesentlichen künstlerischen Bedeutungsträger aufsteigt. Das Bewusstsein für einen abstrakten Formenkanon ermöglicht dabei die Vorstellung von künstlerischem „Fortschritt“ durch gesuchte Abweichungen innerhalb einer Melodiebildung, die als Zeugnis subjektiven A.s zum unangefochtenen Träger musikalischer Expressivität wird. Die hierdurch entfesselte Wechselwirkung von Materialerschöpfung und Materialerweiterung nimmt im Deutschland des 19. Jh.s unter dem Einfluss der hegelianischen Geschichtsphilosophie Gestalt an: als „stets waltendes Prinzip geschichtlichen Fortgangs“ (F. Brendel, Die Geschichte der Musik 2 [21855], 230). In solchem Sinne bildet auch für Rich. Wagner die Trennung zwischen einem poetischen „Inhalt“ und den als einengend empfundenen tradierten „Form“-Vorgaben die Voraussetzung für eine Forderung nach „unbegränztestem A.“ und der „schrankenlosesten Behandlung“ der Melodie (Rich. Wagner, Gesammelte Schriften 7 [1914], 118 u. 159).Parallel hierzu wandelt sich der Begriff des A.s immer deutlicher von einer werk- zu einer vortragsästhetischen Kategorie. Solches geht mit der Vorstellung einher, dass die notierte Komposition nicht nur eine anwendungsbezogene Vorlage für die musikalische Praxis darstelle, sondern dass ihr Text als expressive, Bedeutung ausprägende Struktur zu verstehen wäre, deren akustische Darstellung weniger eine realisierende als eine interpretierende Funktion wahrnehme. Bei Heinrich Christoph Koch findet sich um 1800 der Begriff A. noch als rein werkästhetische Bestimmung, indem er als „A. der Empfindungen“ zum „eigentlichen Endzweck der Tonkunst“ erklärt wird (Musikalisches Lexikon 1802, 184). Gustav Schilling hebt 1835 dagegen bereits die Differenz zwischen werkästhetischer und vortragsästhetischer Dimension hervor: „Jedes Tonstück soll sowohl A. haben, als auch mit A., d. h. so vorgetragen werden, dass die darin zu Grunde gelegte und ausgeführte Idee wirklich zur Wahrnehmung gebracht wird“ (Artikel Espressione, in Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften 2 [1835], 627). Bei Hugo Riemann neigt sich das Begriffsverständnis am Ende des 19. Jh.s schließlich gänzlich zugunsten einer Kategorie des Vortrags. Riemann versteht unter A. allein die „feinere Nuancierung im Vortrage musikalischer Kunstwerke“, welche die Notenschrift nicht im Einzelnen „auszudrücken“ vermag, d. h. die Verlangsamung und Beschleunigung, dynamische Schattierung und Akzentuierung durch die Art des Anschlags (Tasteninstrumente), Strichs (Streichinstrumente) oder Ansatzes (Bläser und Sänger) (Musik-Lexikon 51900). Eine Bewegungssteigerung mit aufsteigender Melodik, anwachsender Lautstärke und zunehmender Beschleunigung bestimmt Riemann als „natürlich“ verknüpfte und lässt Abweichungen hiervon lediglich als Ausnahme von der selbstgesetzten Regel gelten. Eine solche Hierarchie wird mithin durch eine ähnliche Dialektik des musikalischen Bedeutens geprägt wie jene zwischen „Form“ und „Inhalt“ in den deutschen Kompositionslehren des 19. Jh.s.
Deutliche regionale Eigentümlichkeiten gegenüber dieser Traditionsbildung zeigt die Entwicklung in Österreich. So verweist hier nicht nur die erheblich verzögerte Rezeption der Philosophie des Deutschen Idealismus’ durch die kulturpolitische Zensur zwischen Josephinismus und Metternich-System in der ersten Jh.hälfte, sondern v. a. die weiterhin nicht durch Ästhetiken, sondern durch Handwerkslehren (von J. G. Albrechtsberger bis S. Sechter) geprägte Musiktheorie auf eine „geistige Scheidewand“ zu Deutschland (R. Zimmermann, Über den Antheil Wiens an der deutschen Philosophie, in: Die feierliche Inauguration des Rectors der Wiener Universität 1886, 28). Vor diesem Hintergrund lässt sich das Erscheinen von E. Hanslicks Vom Musikalisch-Schönen (1854) im Hinblick auf die A.s-Ästhetik als Symptom einer eigentümlichen lokalen Situation erklären. In Hanslicks Schrift findet sich eine eindeutige Abgrenzung gegenüber der landläufigen Begriffsanwendung von musikalischer Empfindung und Gefühl insofern, als die Form für ihn keine vom poetischen Inhalt abhängige Größe vorstellt, sondern diesen Inhalt selbst ausbildet. Die musikalische Form wird mithin selbst als „Logos“ bestimmt, als„von innen heraus gestalteter Geist“, was freilich a priori keine „Unterschätzung des Sinnlichen“ in der Musik beinhaltet. Hanslick avanciert mit seiner wirkungsreichen Schrift bald zum musikpolitischen Symbol im Parteienstreit der „Formalästhetik“ (für die man auch J. Brahms vereinnahmt) mit der „Inhaltsästhetik“ der „Neudeutschen Schule“ (um Wagner und F. Liszt), der sich freilich mehr mit philosophisch-ästhetischen Normen als mit wissenschaftlichen Tatsachen beschäftigt. Eine Folge dieser Polarisierung ist, dass man einen weiteren wesentlichen Markstein der österreichischen Musikästhetik, F. v. Hauseggers 1885 bereits unter stark veränderten kulturgeschichtlichen Bedingungen entstehende Schrift Musik als A., ausschließlich als Anti-Hanslick und vermeintliches Bekenntnis eines „Wagnerianers“ gelesen hat. Hausegger bemüht sich, Wagners geschichtsphilosophische Produktionsästhetik aus dem Kunstwerk der Zukunft physiologisch-empirisch zu begründen und zu einer umfassenden Genealogie des musikalischen A.s zu erweitern. Seine These freilich, dass A. keine Gefühle darstellen könne, sondern diese vielmehr selbst die Existenzbedingung von Musik begründeten – Musik „bedeutet nicht bloss, sie ist“ (F. Hausegger, Unsere deutschen Meister 1901, 123) –, steht der Hanslickschen Polemik gegen eine „verrottete Gefühlsästhetik“ weniger fern, als man annehmen könnte. Hausegger trennt zwar innerhalb der Bestimmung von Musik als A. psychischer Erregungszustände zwischen dem impulsartig erlebten und einem künstlerisch anschaulich gemachten Wahrnehmungsphänomen, welches Hanslick dagegen als unlösbare Identität begreift: „Als Inhalt hat man die Natur des Impulses aufzufassen; die Form bedingt seine Macht über das Mittel” (Musik als A., 198). Dieser Unterschied hängt aber v. a. mit dem hier produktions-, dort werkästhetischen Ausgangspunkt ihres jeweiligen Denkens zusammen. Weder Hauseggers A.s- noch Hanslicks Formbegriff dienen einer dialektischen Vermittlung metaphysischen oder „poetischen“ Bedeutens. Hausegger wie Hanslick lassen so in der Vorstellung, dass Musik Leidenschaften und Affekte „in abstracto“, nur ihrer Form nach „ohne Stoff“ ausdrücke, den Einfluss A. Schopenhauers erkennen. Hausegger übernimmt etwa Schopenhauers Begriff des universalen „Willens“, um den A. des künstlerischen Subjekts von dessen biographischer Individualität ablösen zu können. Seine Betrachtung legt dafür allerdings keinen metaphysischen, sondern einen psychologischen und anthropologischen Maßstab an. (Mit dem Begriff des „Kunstwollens“ beschreiben ähnlich auch die Wiener Kunsthistorische Schule Alois Riegls und G. Adler, Hanslicks Schüler und Nachfolger an der Wiener Univ., aus empirischer Forschung gewonnene, verallgemeinerbare, wiewohl nicht unter ein System subsumierte Kunstäußerungen aller Epochen.) Kaum zufällig ist daher Hauseggers geistige Nähe zur Psychophysik Ernst Machs, der auch Adlers Denken nahesteht. Hauseggers „Drang nach A.“ (Musik als A., 170) erweist sich mit dem subjektiven Bewusstsein nur insofern verbunden, als dieses die Aufgabe der Übertragung des im Unbewussten bereits Vorgestalteten in die sinnliche Realität zu erfüllen hat. Ähnlich wie bei Mach wird auch für Hausegger das „Ich [...] nur in seiner Thätigkeit“ von einem „in beschränkten Vorstellungskreisen waltenden Schein-Ich nicht mehr vernommen“ (Das Jenseits des Künstlers 1893, 146). Die Skepsis gegenüber einer Subjektivität, die sich lediglich als„vorübergehende Verbindung von wechselnden Elementen“ erweist, bestimmt ähnlich auch Machs radikale Lehre vom „unrettbaren Ich“ (Die Analyse der Empfindungen 41903, 278f.).
Daher kann Hauseggers Lehre auch nicht einfach im Hinblick auf einen homogenen „Standpunkt des Subjekts“ gedeutet werden, der dem musikalischen Material vermittelnd gegenübersteht (H. Riemann, Die Elemente der musikalischen Ästhetik 1900, 67). Deutlich wird dies etwa, wenn man Hauseggers geistigen Einfluss auf den musikalischen Expressionismus in Österreich betrachtet. A. Schönbergs Aufgabe der Tonalität um 1910 verfolgte das Ziel, einen abgegriffenen Struktur- und Formenkanon durch Rückführung auf seine elementaren Funktionen (etwa der Ausbildung von Proportions- oder Spannungsverhältnissen) unter rein musikalischen Gesichtspunkten mit neuem Sinn zu erfüllen. Eine solche Absicht weist Ähnlichkeiten zum phänomenalistischen Denken Hauseggers auf: Schönberg spricht von einer in ihre „Triebe“ „hineinhorchenden“ Kunst (Stil und Gedanke, 51) und wird zugleich vom „Zwang einer unerbittlichen, aber unbewußten Logik“ (Harmonielehre 31922, 499) getragen. Die protokollarische Exaktheit der künstlerischen Gestaltung versteht sich dabei bereits selbst als A. des Inneren eines Künstlers und wird diesem nicht erst dialektisch vermittelt. Schönberg teilt Hauseggers Idee, dass der künstlerische A. eine kritische Gegeninstanz zur Funktionalisierung des Sprachlichen als Mittel rein zweckgerichteter Kommunikation (F. Hausegger, Musik als A., 92ff.) in „abnormen Gesellschaftsverhältnissen“ sei (F. Hausegger, Gedanken eines Schauenden 1903, 276). Er hat den Gedanken der Befreiung von den als einengend empfundenen Fesseln einer rationalen Vermittlung zwischen Gegenstand und Bedeutung darüber hinaus jedoch erheblich radikaler begriffen als dieser. In seiner Umsetzung nimmt er keine Rücksicht mehr auf Hauseggers Anspruch an „die Einheit und Schönheit der Form“ (F. Hausegger, Musik als A., 198), die er als Relikt überständiger Konvention empfindet. Noch in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg mit ihrer nachhaltigen Erschütterung der bestehenden soziokulturellen Strukturen und einer verstärkten Ausrichtung an Funktionalismus und Sachlichkeit, einer Zeit mithin, die sich „dem objektivierten A. zugewendet“ hat (H. Curjel, Vermischte Schriften 1966, 153), hielten Schönberg und seine Schüler an ihrem auf Autonomie und Logik gründenden emphatischen Bekenntnis zum A. fest. R. Kolisch benennt diesen Anspruch Schönbergs mit dem Begriff des Wiener Espressivo, das als „spezifische Art von Expressivität“ nicht das bloße A.-Geben anstrebe, sondern vielmehr „vor allem in dem Element der Konstruktion“ bestehe (R. Kolisch, Zur Theorie der Aufführung, 35f.). Da „der (jeweilige) A. [...] objektiver Bestandteil der Komposition“ selbst ist, benötigt er keine von außen an ihn herangetragene „Objektivierung“ (R. Kolisch, zit. nach: R. Kapp, Rudolf Kolisch, 109). Der werkästhetische Ansatz Hanslicks und der produktionsästhetische Hauseggers werden in Schönbergs „Espressivo“-Verständnis als zwei einander ergänzende Auffassungsweisen der Kunst begreifbar. Es verdeutlicht sich mit diesem eigentümlichen Anspruch des „fortwährenden A.sgebots“ (A. Schönberg, Harmonielehre, 7) ein metaphysik- und systemskeptischer Zug innerhalb der österreichischen Moderne.
Literatur
MGG 1 (1994); H. Danuser in NHdb 11 (1993), 43–51; M. Schmidt in StMw 46 (1997); H. Grimm in H.-W. Heister et al. (Hg.), [Fs.] G. Knepler 1993; R. Kapp in Österr. Musiker im Exil 1990; A. Forchert in H. Danuser et al. (Hg.), [Fs.] C. Dahlhaus 1988; R. Kapp in ÖMZ 42 (1987); R. Flotzinger in O. Wessely (Hg.), [Kgr.-Ber.] Bruckner Linz 1984, 1986; R. Kolisch, Zur Theorie der Aufführung 1983; C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik 1978; H. Haak in R. Stephan/S. Wiesmann (Hg.), Die Wiener Schule in der Musik des 20. Jh.s 1986; F. v. Hausegger, Die Musik als A. 21887; E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen 1854.
MGG 1 (1994); H. Danuser in NHdb 11 (1993), 43–51; M. Schmidt in StMw 46 (1997); H. Grimm in H.-W. Heister et al. (Hg.), [Fs.] G. Knepler 1993; R. Kapp in Österr. Musiker im Exil 1990; A. Forchert in H. Danuser et al. (Hg.), [Fs.] C. Dahlhaus 1988; R. Kapp in ÖMZ 42 (1987); R. Flotzinger in O. Wessely (Hg.), [Kgr.-Ber.] Bruckner Linz 1984, 1986; R. Kolisch, Zur Theorie der Aufführung 1983; C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik 1978; H. Haak in R. Stephan/S. Wiesmann (Hg.), Die Wiener Schule in der Musik des 20. Jh.s 1986; F. v. Hausegger, Die Musik als A. 21887; E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen 1854.
Autor*innen
Matthias Schmidt
Letzte inhaltliche Änderung
18.2.2002
Empfohlene Zitierweise
Matthias Schmidt,
Art. „Ausdruck‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
18.2.2002, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001fa89
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.