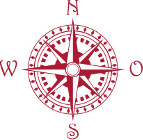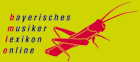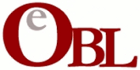Hummel,
Familie
Johann Nepomuk:
* 14.11.1778 Pressburg (Bratislava),
† 17.10.1837
Weimar/D.
Pianist und Komponist.
H. erhielt frühzeitig Unterricht von seinem Vater Johannes (Johann, Joannes; * 31.5.1754
Unterstinkenbrunn/NÖ, † 20.12.1828
Jena/D), der u. a. Orchestergeiger
in Wien und Pressburg sowie Musikdirektor am
Militärstift von Warberg/D gewesen war.
1786 wurde H. Schüler W.
A. Mozarts in Wien. H. begann seine Karriere als pianistisches Wunderkind.
Unter Mozarts Leitung konzertierte er erstmals 1787 in
Dresden/D; gemeinsam mit dem Vater
unternahm er 1788–93 Konzertreisen, u. a. nach Prag, durch Deutschland, Dänemark,
Großbritannien und die
Niederlande. Nach Wien
zurückgekehrt, setzte er seine Studien bei J. G.
Albrechtsberger (Kontrapunkt) und A. Salieri (Vokalkomposition, Ästhetik und Musikphilosophie) fort. Der möglicherweise stattgefundene Orgelunterricht
durch J. Haydn (in dessen Londoner „Salomon-Konzerten“ er
1792 mitgewirkt hatte) ist nicht ausreichend belegt. Auf Haydns Empfehlung
wurde H. jedenfalls 1804 von Fürst Nikolaus II. unter dem Titel eines
„Concertmeisters“ in der Esterházyschen Hofkapelle in
Eisenstadt
angestellt, wo er bald als faktischer Nachfolger Haydns tätig war, da dieser das
Kapellmeisteramt, das er nominell noch innehatte, nicht mehr aktiv ausüben konnte. Unter H.s Federführung erlebte die Hofmusik eine zweite, „silberne“ Glanzperiode, deren
musikhistorischer Höhepunkt im September 1807 die durch H. vermittelte UA der
C-Dur-Messe (op. 86) von L. v.
Beethoven in der Eisenstädter Bergkirche bildete. Für den Esterházyschen Hof war H. hauptsächlich als Komponist von Kirchenmusik tätig. (Seine vier später veröffentlichten Messen sind sämtlich bereits in Eisenstadt entstanden.) Ein zentrales Wirkungsfeld jedoch – der Eisenstädter Hof von Nikolaus II. war in enger
Verbindung mit Wiener Theatern – war das eines Theaterkapellmeisters und -komponisten, der in Eisenstadt zeitgenössisches Wiener (überwiegend Singspiel-)Repertoire zu betreuen hatte. H. schied 1811 in Unfrieden aus dem Esterházyschen Dienstverhältnis. Er begab sich
zurück nach Wien, wo er vom Unterrichten lebte und seine Laufbahn als Komponist von
Klaviermusik weiter verfolgte. 1811–15 gab er eine eigene Publikationsreihe für
Liebhaber, das Répertoire de Musique (des Dames) heraus. Im Frühjahr 1816 unternahm er eine Tournee nach Prag,
Berlin und
Leipzig/D. Nach einem zweijährigen
Aufenthalt als Hofkapellmeister in
Stuttgart/D (1816–18) wurde H. im
Februar 1819 zum Hofkapellmeister in Weimar berufen, wo er bis zu seinem Tod dieses Amt
bekleidete. Während dieser Tätigkeit bemühte sich H. um eine eingehende organisatorische
Reform der Institution. Das Amt ließ ihm Zeit für ausgedehnte Konzerttourneen nach
Russland (1822, als Begleiter der Großherzogin Maria Pawlowna),
Paris (1825), den Niederlanden
(1826) und Polen (1828). 1827 begab er sich gemeinsam mit F. Hiller nach Wien an Beethovens Totenbett und nahm an dessen Begräbnis teil. Während dieses Aufenthalts lernte er auch Fr. Schubert kennen,
der ihm ursprünglich seine drei letzten Klaviersonaten widmen wollte (posthum ging die Widmung schließlich 1838 an R.
Schumann). 1830 sah er noch einmal Paris und nach 40 Jahren erstmals
wieder London, wo er 1833 die Deutsche Opernsaison am King’s Theatre leitete. Im Sommer 1831 leitete H. außerdem (mit André Hippolyte Chelard [1789–1861]) das Thüringer
Musikfest in Erfurt/D.
Seine letzte Tournee 1834 nach Wien fand nur mehr laue Aufnahme. Zu seinen Schülern
zählen J. Benedict, F. Hiller und Adolph Henselt (1814–89). Seit dem 16.5.1813 war H. mit E. Röckel verheiratet. Der
überwiegende Teil des Nachlasses befindet sich im Goethe-Museum in
Düsseldorf/D. Der Schwerpunkt von H.s Schaffen liegt in der Klaviermusik; H. bildet eine musikgeschichtliche Brücke zwischen Mozart und F. Chopin, d. h. zwischen der Klaviermusik der Wiener Klassik und dem virtuosen Klavierstil des 19. Jh.s. In der Geschichte des Klavierspiels nimmt H. einen zentralen Platz ein. Die mit über 2200 Notenbeispielen ausgestattete dreibändige Klavierschule (1828) dokumentiert pädagogisches Geschick und steht ebenbürtig neben anderen Unterrichtswerken der Zeit. Das früher häufig geäußerte Urteil, H. sei es nur um äußere Brillanz, oberflächliche Ornamentik und formale Glätte zu tun gewesen, ist im Sinne einer musikgeschichtlichen Richtungsentscheidung zu differenzieren.
Gedenkstätten
Denkmal in Bratislava (Staré Mesto, Hviezdoslavovo námestie 192/10, s. Abb.); Gedenktafel in Bratislava (Staré Mesto, Klobučnícka 2, s. Abb.).
Denkmal in Bratislava (Staré Mesto, Hviezdoslavovo námestie 192/10, s. Abb.); Gedenktafel in Bratislava (Staré Mesto, Klobučnícka 2, s. Abb.).
Ehrungen
Ehrenmitglied versch. Gesellschaften: der Société Academique des enfants d’Apollon in Paris 1825, der Société de Musique in Genf 1825, der GdM in Wien 1826, der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in Rotterdam/NL 1830, der Maatschappy van Verdiensten in Amsterdam 1831, der Royal Philharmonic Society in London 1834 und der Maatschappy tot Bevordering der Toonkunst in Amsterdam 1835; Ritter der Ehrenlegion in Paris 1827; Orden vom Weißen Falken in Weimar 1832; Vorsteher des Thüringisch-Sächsischen Musikvereins; Gründung der Hummel-Gesellschaft-Weimar 1878.
Ehrenmitglied versch. Gesellschaften: der Société Academique des enfants d’Apollon in Paris 1825, der Société de Musique in Genf 1825, der GdM in Wien 1826, der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in Rotterdam/NL 1830, der Maatschappy van Verdiensten in Amsterdam 1831, der Royal Philharmonic Society in London 1834 und der Maatschappy tot Bevordering der Toonkunst in Amsterdam 1835; Ritter der Ehrenlegion in Paris 1827; Orden vom Weißen Falken in Weimar 1832; Vorsteher des Thüringisch-Sächsischen Musikvereins; Gründung der Hummel-Gesellschaft-Weimar 1878.
Werke
Kl. solo: Sonaten, Etüden, Variationen (s. Tbsp.), Tänze; Kammermusik: 3 Streichquartette, 3 Sonaten f. Kl. u. V. Klaviertrios, Klavierquintett, Septette mit Klavier; Serenaden; Solokonzerte für Kl., Trp., Mandoline, V. u. Kl.; Tänze für den Apollo-Saal; Opern und Singspiele; Ballette und Pantomimen; Kirchenmusik (u. a. 5 Messen, Te Deum); Oratorium; weltliche Kantaten; Lieder; Chöre.
Kl. solo: Sonaten, Etüden, Variationen (s. Tbsp.), Tänze; Kammermusik: 3 Streichquartette, 3 Sonaten f. Kl. u. V. Klaviertrios, Klavierquintett, Septette mit Klavier; Serenaden; Solokonzerte für Kl., Trp., Mandoline, V. u. Kl.; Tänze für den Apollo-Saal; Opern und Singspiele; Ballette und Pantomimen; Kirchenmusik (u. a. 5 Messen, Te Deum); Oratorium; weltliche Kantaten; Lieder; Chöre.
Schriften
Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, 3 Bde. 1828.
Ausführliche theoretisch-practische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, 3 Bde. 1828.
Literatur
NGroveD 8 (1980); K. Benyovsky, J. N. H. 1934; M. Kroll, J. N. H.: a musician’s life and world 2007; K. Benyovsky in Burgenländische Heimatbll. 21 (1961); J. Harich in Burgenländische Heimatbll. 21 (1961); D. Zimmerschied, Die Kammermusik J. N. H.s 1966; [Kat.] J. N. H. Eisenstadt 1978 1978; H. R. Jung (Hg.), [Kgr.-Ber.] J. N. H. Weimar 1978, [o. J.]; H. Schmid (Hg.), J. N. H. Ein Komponist zur Zeit der Wiener Klassik 1987; D. Zimmerschied, Thematisches Verzeichnis der Werke von J. N. H. 1971; J. Sachs in Notes 30 (1973/74); Trauungsbuch der Pfarre St. Josef ob der Laimgrube (Wien VI) 1810–14, fol. 72; Taufbuch der Pfarre Gaubitsch/NÖ 1738–84, fol. 115; www.mgg-online.com (3/2023); oxfordmusiconline (3/2023).
NGroveD 8 (1980); K. Benyovsky, J. N. H. 1934; M. Kroll, J. N. H.: a musician’s life and world 2007; K. Benyovsky in Burgenländische Heimatbll. 21 (1961); J. Harich in Burgenländische Heimatbll. 21 (1961); D. Zimmerschied, Die Kammermusik J. N. H.s 1966; [Kat.] J. N. H. Eisenstadt 1978 1978; H. R. Jung (Hg.), [Kgr.-Ber.] J. N. H. Weimar 1978, [o. J.]; H. Schmid (Hg.), J. N. H. Ein Komponist zur Zeit der Wiener Klassik 1987; D. Zimmerschied, Thematisches Verzeichnis der Werke von J. N. H. 1971; J. Sachs in Notes 30 (1973/74); Trauungsbuch der Pfarre St. Josef ob der Laimgrube (Wien VI) 1810–14, fol. 72; Taufbuch der Pfarre Gaubitsch/NÖ 1738–84, fol. 115; www.mgg-online.com (3/2023); oxfordmusiconline (3/2023).
Sein Sohn
Eduard Joseph (Edward, Edouard): * 9.5.1814 Wien, † 11.3.1892 [nicht 1893] Troy, New York/USA. Komponist, Pianist, Pädagoge. Als älterer Bruder des späteren Malers Carl H. (* 31.8.1821 Weimar, † 16.6.1906 Weimar) in Wien, Stuttgart und Weimar aufgewachsen, erhielt E. H. seine musikalische Ausbildung beim Vater sowie 1832–34 in Wien bei C. Czerny und I. v. Seyfried und machte eine Buchhändlerlehre bei T. Haslinger. Nach seiner Rückkehr nach Weimar konzertierte er 1836/37 bei Konzerten seines Vaters oder führte dessen Werke in anderweitigen Kontexten auf. Zw. 1837/39 verweilte er in London, wo er u. a. eine Matinee unter der Patronage von Mitgliedern des britischen Königshauses und der Esterházy-Familie in den Hanover Square-Rooms veranstaltete. Ab spätestens 1838 war er als Privatlehrer für Klavier tätig. Anlässlich einer Opernaufführung 1839 hielt er sich kurzzeitig in Weimar auf, kehrte anschließend jedoch vorübergehend nach London zurück. Abermals nach Weimar gezogen, heiratete er am 15.2.1841 die Tochter des Architekten Auguste Coudray (* 8.9.1816 Weimar, † 22.4.1844 Weimar), und lebte zu der Zeit als Privatmann. 1844 folgte er einem Engagement als Musikdirektor an das Stadttheater in Augsburg/D und wenige Monate später (als Nachfolger von Johannes Dürrner [1810–59]) an das Theater zu Ansbach/D. 1845 zog E. H. nach Regensburg/D, wo er in Zeitungen als Klavierlehrer und Pianist annoncierte. Dort erfolgte am 15.3.1846 seine zweite Eheschließung mit der Patrimonialrichters- und Spitalkastnerstochter Friederike Antonia Aign (* 15.2.1829 [Ort?], † ?), bei der u. a. der Musikalien- und Instrumentenhändler Johann Kaneider (ca. 1793–1875) Trauzeuge war. Anlässlich einer E. H. gewidmeten Benefizveranstaltung in Münster/D 1852, bei der G. F. Treitschkes (1776–1842) Singspiel Der politische Zinngießer gegeben wurde, steuerte E. H. eine von ihm komponierte Einlage bei. Im Februar 1853 verlegte er seinen Wohnsitz erneut in den Süden Englands, diesmal nach Bath, wo er wie auch in Cheltenham, Weston-super-Mare und Clifton (Bristol) dem Adel und Bürgertum Klavierunterricht erteilte. Zumindest in Bath und Weston-super-Mare bot zeitgleich seine Gattin Sprachunterricht an. Laut Presse lebte E. H. um 1872 in Bradford/GB, ließ sich jedoch 1873/74 in beengten finanziellen Verhältnissen in Wiesbaden/D nieder, wo er weiterhin pädagogischen Tätigkeiten nachging (bis 1881/82). Dazwischen verreiste er im September 1877 für einen kurzzeitigen Aufenthalt abermals nach England (Torquay?). Danach übersiedelte er nach Amerika zu seinem Sohn Alphons (* ca. 1846 [Ort?], † nach 1918 Huntington, New York/USA), der u. a. 1910 in Argyle, New York lebte. Bei den E. H. zugeschriebenen Kapellmeister-Stationen Troppau, Brünn und Wien handelt es sich um eine Verwechslung mit J. F. Hummel. E. H.s Teilnachlass befindet sich ebenfalls im Goethe-Museum in Düsseldorf.
Werke
Opern (Alor oder die Hunnen vor Merseburg 1843); Lieder (An die Liebe in A-Dur o.J.); Chöre (Nah und fern in treuen Bunde in Es-Dur mit Orch. 1830); Duette (Mein Bohemund o selig’ Wiedersehen mit Orch. ca. 1843); Märchen (Die Liebesprobe 1847); Tänze (Le pandour rondoletta mazourka 1853, Gavotte Liebesglück 1880, Walzer-Rondo Der lustige Postillon 1880); Bearbeitungen (Variations brilliants sur un Thême favorit de l’opera „I Montecchi e Capuletti“ de Vincenzo Bellini 1837, Fantasia sur un air de l’opéra „The gipsy’s warning“ de Julius Benedict 1838); Klavierwerke (u. a. Le Séjour à Londres ca. 1840); Messen (Messa solenne ma breve 1884); Märsche (Schützenmarsch 1840); Einlage Flug von Sehnsucht zu G. F. Treitschkes Singspiel Der politische Zinngießer 1852.
Opern (Alor oder die Hunnen vor Merseburg 1843); Lieder (An die Liebe in A-Dur o.J.); Chöre (Nah und fern in treuen Bunde in Es-Dur mit Orch. 1830); Duette (Mein Bohemund o selig’ Wiedersehen mit Orch. ca. 1843); Märchen (Die Liebesprobe 1847); Tänze (Le pandour rondoletta mazourka 1853, Gavotte Liebesglück 1880, Walzer-Rondo Der lustige Postillon 1880); Bearbeitungen (Variations brilliants sur un Thême favorit de l’opera „I Montecchi e Capuletti“ de Vincenzo Bellini 1837, Fantasia sur un air de l’opéra „The gipsy’s warning“ de Julius Benedict 1838); Klavierwerke (u. a. Le Séjour à Londres ca. 1840); Messen (Messa solenne ma breve 1884); Märsche (Schützenmarsch 1840); Einlage Flug von Sehnsucht zu G. F. Treitschkes Singspiel Der politische Zinngießer 1852.
Literatur
M. Kroll, J. N. H.: a musician's life and world 2007, 246; Allg. musikalische Ztg. 21.9.1836, 8, 28.8.1839, 7; Der Wanderer 27.6.1838, 4; NZfM 7.4.1837, 3; AmZ 11.9.1844, 620; Neues Fremden-Bl. 3.12.1873, 18; Ost u. West. Bll. f. Kunst, Literatur u. geselliges Leben 19.10.1839, 364; Musical News 6.6.1896, 542; Regensburger Ztg. 7.11.1845, 1228, 4.11.1846, 1234; Regensburger Wochenbl. 24.3.1846, 147; Münsterischer Anzeiger 31.8.1852, [53]; Passauer Tagbl. 22.1.1875, [72]; Bath Chronicle and Weekly Gazette 10.2.1853, 2, 11.11.1858, 4; Trowbridge Chronicle 20.7.1872; Taufbuch der Dompfarre St. Stephan (Wien I) 1812–15, fol. 139; wikipedia.org/Eduard_Hummel (11/2022); www.ancestry.ca (1/2022); www.familysearch.org (11/2022); www.geni.com (11/2022); www.bmlo.lmu.de (11/2022); www.worldcat.org (1/2023); opac.rism.info (1/2023); kalliope-verbund.info (2/2023); Mitt. Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg/D (12/2022); eigene Recherchen (Dt. Bühnenjb.er; Adressbücher der Stadt Wiesbaden/D; anno.onb.ac.at; digipress.digitale-sammlungen; zeitpunkt.nrw; britishnewspaperarchive).
M. Kroll, J. N. H.: a musician's life and world 2007, 246; Allg. musikalische Ztg. 21.9.1836, 8, 28.8.1839, 7; Der Wanderer 27.6.1838, 4; NZfM 7.4.1837, 3; AmZ 11.9.1844, 620; Neues Fremden-Bl. 3.12.1873, 18; Ost u. West. Bll. f. Kunst, Literatur u. geselliges Leben 19.10.1839, 364; Musical News 6.6.1896, 542; Regensburger Ztg. 7.11.1845, 1228, 4.11.1846, 1234; Regensburger Wochenbl. 24.3.1846, 147; Münsterischer Anzeiger 31.8.1852, [53]; Passauer Tagbl. 22.1.1875, [72]; Bath Chronicle and Weekly Gazette 10.2.1853, 2, 11.11.1858, 4; Trowbridge Chronicle 20.7.1872; Taufbuch der Dompfarre St. Stephan (Wien I) 1812–15, fol. 139; wikipedia.org/Eduard_Hummel (11/2022); www.ancestry.ca (1/2022); www.familysearch.org (11/2022); www.geni.com (11/2022); www.bmlo.lmu.de (11/2022); www.worldcat.org (1/2023); opac.rism.info (1/2023); kalliope-verbund.info (2/2023); Mitt. Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg/D (12/2022); eigene Recherchen (Dt. Bühnenjb.er; Adressbücher der Stadt Wiesbaden/D; anno.onb.ac.at; digipress.digitale-sammlungen; zeitpunkt.nrw; britishnewspaperarchive).
Autor*innen
Gerhard J. Winkler
Karoline Hochstöger
Karoline Hochstöger
Letzte inhaltliche Änderung
2.6.2023
Empfohlene Zitierweise
Gerhard J. Winkler/Karoline Hochstöger,
Art. „Hummel, Familie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
2.6.2023, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d268
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.
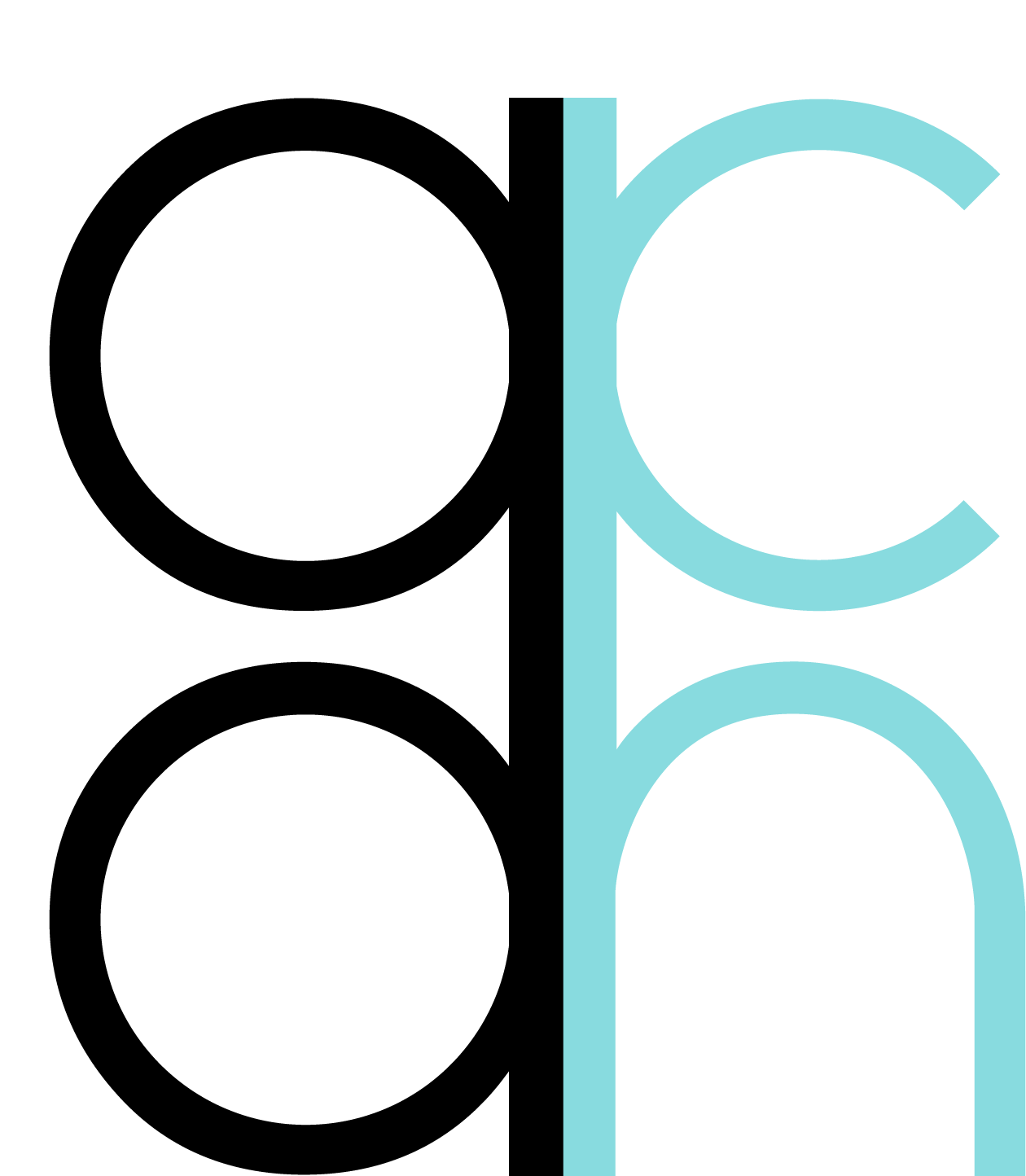


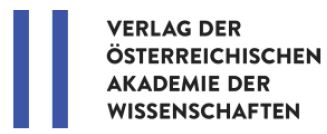




![Eduard Joseph Hummel (Aquarell von Henry Hawkins [1838])© Gemeinfrei, via Gemeinfrei, via Wikipedia Eduard Joseph Hummel (Aquarell von Henry Hawkins [1838])© Gemeinfrei, via Gemeinfrei, via Wikipedia](/ml/image/Hummel_Eduard.jpg)