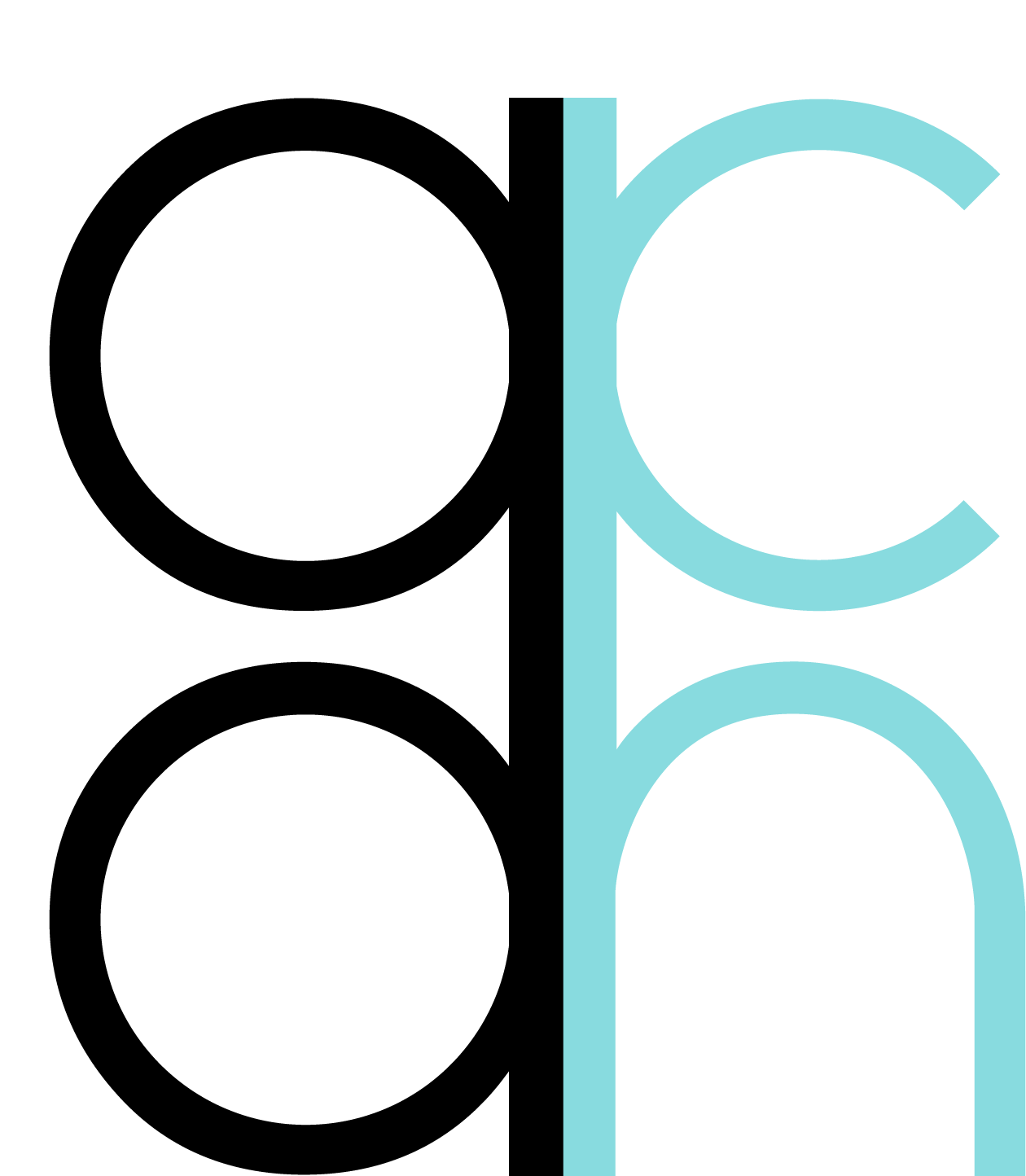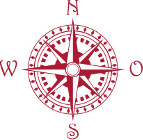Klavichord
(Clavichord)
Vermutlich das älteste Tasteninstrument mit Saiten (lat. clavis = Taste und chorda = Saite). Im Gegensatz zum Cembalo, bei dem die Saiten mit einem Federkiel oder einem Plektrum aus Metall, Leder oder Kunststoff angezupft werden bzw. zum Hammerklavier (Klavierbau), bei dem die Saiten mittels Hämmern angeschlagen werden, erfolgt beim K. die Tonerzeugung mittels einer am Hinterende der Taste angebrachten sog. Tangente – einem schmalen senkrechten Plättchen aus gehämmertem Messing- oder Eisenblech. Diese berührt beim Betätigen der Taste die Saite (aus Eisen oder Messing), definiert dabei ihre klingende Länge und versetzt sie gleichzeitig durch den Berührungsimpuls in Schwingung. Die Mehrzahl der Instrumente war doppelchörig, d. h. mit zwei gleich hoch gestimmten Saiten pro Ton ausgestattet. Der links von der Tangente befindliche Teil der Saiten wird durch eine Dämpferleiste oder einen eingeflochtenen Tuchstreifen abgedämpft. Da der Finger direkt mit dem Saitenchor verbunden ist, kann nicht nur laut und leise gespielt, sondern der Ton auch nach dem Anschlag moduliert werden: das K. ist das einzige Tasteninstrument, bei dem ein Vibrato möglich ist. Diese sog. „Bebung“ sowie das „Tragen der Töne“ (ein beim Fortschreiten in einer langsamen Passage erfolgtes behutsames Nachdrücken) sowie der mit über 30 messbaren Partialtönen unvergleichliche Obertonreichtum (Klangfarbe) machen das K. zum empfindsamsten aller Saitenklavierinstrumente.Man unterscheidet gebundene und bundfreie K.e. Bis Ende des 17. Jh.s wurden in der Regel alle K.e. so gebaut, dass zwei bis vier Tangenten auf ein gemeinsames Saitenchor einwirkten. Die Abstände der Tangenten entsprachen denen der „Bünde“ einer Laute oder Gambe, woraus sich auch die Bezeichnung „gebundenes K.“ ableitet. Ab dem 17. Jh. wurden zweifach gebundene K.e bereits als „bundfrei“ bezeichnet, wenn alle diatonischen Töne der Untertasten über ein eigenes Saitenchor verfügten, d. h. die chromatischen Halbtöne an ihren zugehörigen Hauptton gebunden waren (cis an c, gis an g, b an h etc.), während alle d und a sowie auch die Basstöne ungebunden waren. Als „völlig bundfrei“ wurden ab dem 18. Jh. K.e bezeichnet, bei denen alle Töne über ein eigenes Saitenchor verfügten; diese bildeten in Österreich aber in der Spätzeit generell die Ausnahme.
Die Entwicklung der besaiteten Tasteninstrumente erfolgte in der Mitte des 14. Jh.s von Westeuropa aus. Es wird angenommen, dass mit den ältesten Bezeichnungen eschequier, exaquier, chekker, scachordium, Schach(t)brett, manicordio, monachordio, u. a. in den meisten Fällen ein K. gemeint war (Ripin 1995).
Die bisher früheste bekannte Erwähnung des neuen und bis heute gültigen Namens findet sich in dem im Dezember 1396 in Wien verfassten Testament des Johannes von Zwickau, worin dieser sein „clavicordium“ dem Sohn des Niclas Perkchofer vermachte (WStLA Hs 285/1, fol. 16r; Koster 2002). In den österreichischen Erblanden und im Umfeld der Wiener Artistenfakultät lässt sich eine sehr frühe Rezeption und Entwicklung von K. und Cembalo nachweisen (1397 wird H. Poll aus Wien als Erfinder eines neuen Instruments genannt, das er „clavicembalum“ nannte, Strohm 1991). 1418 wird den Mönchen des Stiftes Seckau das Spielen des K.s erlaubt (zwischen 1387 und 1413 sind mehrere Studenten aus Seckau an der Wiener Univ. inskribiert). Ab 1422 ist Johannes Keck (1399–1450) zunächst als Student, nach 1429 als Magister regens und bis 1435 als Prof. in Wien tätig. Die in einer Abschrift bei Martin Gerbert überlieferte Grundrisszeichnung (s. Abb. 1) eines K.s aus seinem De cantu et musica sacra (Textkommentar dazu in: Introductorium musicae) von 1442 gehört neben dem etwa zeitgleich entstandenen Traktat des Henri Arnaut de Zwolle (ca. 1400–66) zu den frühesten Konstruktionsdarstellungen überhaupt. Eine weitere frühe Darstellung findet sich im sog. Kuttenberger Canzionale (Hussiten). 1438 und 1442 finden sich Ausgaben „pro clavicordio“ in den Rechnungsbüchern des Stiftes Klosterneuburg.
Der 1436 in Königsberg in Franken geborene Johannes Müller – nach seinem Geburtsort latinisiert „Regiomontanus“ genannt – kam 1450 vierzehnjährig an die Wiener Univ., wo er bis 1461 tätig war (Zinner 1938). Aus dieser Zeit (ca. 1458) stammt ein in der Stadtbibliothek Nürnberg/D aufbewahrtes Manuskript, worin erstmals die relative Verkürzung der Saitenmensuren im Bass beschrieben wird, wie sie später bei K.en mit mehr als drei Oktaven Tonumfang zwingend notwendig wird (Meyer 1996, Neske 1997, Koster 2002).
Das K. nahm gerade am Beginn seiner Entwicklung einen sehr hohen Stellenwert ein. Dies zeigt sich u. a. darin, dass es anfangs fast ausschließlich in geistlichem Kontext, in ikonographischen Quellen meist von Engeln gespielt, vorkommt. Ein auffallend großes Instrument ist in einem 1488–90 illuminierten Graduale aus der Bibliothek des ungarischen Königs Matthias Corvinus (1443–90) dargestellt (Fontana 2001). Eine der frühesten profanen Darstellungen findet sich auf einem Holzschnitt von Hans Burgkmair von 1516, der K. Maximilian I. (1459–1519) als „Weißkunig“ in seiner Musikkammer darstellt, wobei als einzige Tasteninstrumente ein Orgelpositiv (Orgel) und ein großes K. zu sehen sind (Abb. 2).
Über Erscheinungsformen, Eigenheiten und Gebrauch der Saitenklaviere der Frühzeit sind wir auf spärliche ikonographische und schriftliche Quellen angewiesen. Aufgrund technologischer Gegebenheiten und Sachzwänge lässt sich vermuten, dass die Mehrzahl aller besaiteten Tasteninstrumente etwa bis zur Mitte des 15. Jh.s in Oktavlage gebaut wurde. Hauptindiz dafür ist bei K.en und Spinetten bzw. Virginalen die Tatsache, dass die Klaviatur fast die gesamte vordere Breite des Instruments einnimm t(Ripin 1977, Huber 1992). Über die Entwicklung der Klaviaturumfänge sind wir neben den theoretischen Schriften auf Schlussfolgerungen anhand erhaltener Kompositionen (z. B. Trienter Codices, Buxheimer Orgelbuch) sowie auf ikonographische Quellen angewiesen. Obwohl bei Johannes Regiomontanus bereits der Umfang von G–f 2 vorkommt, stellt eine um 1500 in Ofen/Buda (Budapest) aufgezeichnete Orgeltabulatur (Tabulatur) noch eine Tastatur mit dem Umfang H–h2 dar.
Im 16. Jh. büßte das K. seine musikalische Vorrangstellung weitgehend ein und diente vorwiegend als preisgünstiges und praktisches Übungsinstrument für den Organisten. 1584 verzeichnet das Inventar des Stiftsorganisten von Kremsmünster „2 Clavicordi, darzue ein Pedall“. 1591 wird die Anschaffung eines zweiten Pedal-K.s des Orgelbauers Georg Hacker aus Steyr erwähnt (Kellner 1956). K.- und Cembalobau standen in enger Verbindung mit dem Beruf des Orgelbauers, der im süddeutsch-österreichischen Raum als „Orgel- und Instrumentmacher“ bezeichnet wurde, wobei unter Instrument stets ein Saitenklavier zu verstehen ist. Es ist vermutlich auf die Wirren der Reformationszeit und des Dreißigjährigen Krieges sowie auf die im Südosten des Reiches gegebene ständige Bedrohung bzw. Besetzung durch die Türken zurückzuführen, dass in unserem Raum aus dem 16. Jh. kein einziges und aus dem 17. Jh. kein zweifelsfrei datierbares K. erhalten geblieben ist. (Das K. von Johann Baumgartner, Bozen 1683, Prag/Národní muzeum, hat kein originales Namensschild).
Die wenigen signierten und datierten österreichischen K.e stammen aus dem 18. Jh. Viele von ihnen weisen in Klaviaturumfang (mit kurzer oder kurzer gebrochener Oktav), Saitenlängen, Bindungssystem und Gehäusekonstruktion Baumerkmale auf, die ein Instrument bisweilen um ein bis zwei Generationen älter erscheinen lassen (z. B. A. Römer, Graz 1774, Wien/KHM/SAM 740 mit dem Umfang C/E–d3). Das Bindungssystem zeigt häufig eine modifiziert mitteltönig orientierte Temperatur (Stimmung), wie sie auch in kleineren Orgeln bis ins frühe 19. Jh. in Gebrauch war. Die großen bundfreien K.e, die ab der Mitte des 18. Jh.s in Norddeutschland und Skandinavien bevorzugt wurden, bildeten in Österreich die Ausnahme. Ein solches bundfreies Instrument (F1–f3) baute um 1794 der aus Böhmen stammende Orgelbauer J. Bohák für J. Haydn (London/Royal College of Music). Saiten in 4’-Lage zur Aufhellung der Basslage wurden nur vereinzelt gebaut (Ferdinand Hofmann, Wien ca. 1790–95, Wien/Haydn-Haus; Johann Georg Klöckner, Pressburg 1808, Bratislava/Slovenské národné múzeum). Die überwiegende Zahl der hier gebauten K.e dürfte in Mittellage und Diskant mit Eisen besaitet gewesen sein, mit Basssaiten in blankem oder ab der Mitte des 18. Jh.s auch mit übersponnenem Messingdraht.
Zu Beginn des 19. Jh.s wurde das K. vom Hammerklavier verdrängt. Teils aus Liebhaberei, teils aufgrund ökonomischer Sachzwänge oder für pädagogische Zwecke blieb v. a. im Norden und Osten der Monarchie (heute Tschechien, Slowakei, Ungarn) ein kleiner Interessentenkreis dem subtilen, inzwischen als altmodisch angesehenen Tasteninstrument verbunden. So empfiehlt D. G. Türk in seinem Lehrbuch im Klavierspielen (Wiener Ausgabe von 1803) das K. anstelle des Fortepiano für den Unterricht von Kindern. Und noch 1831 forderte das Direktorium der städtischen Musikschule in Buda (Ofen) die dringende Reparatur der 11 K.e, die seit der Schulgründung 1777 als einzige Unterrichtsmittel für die Clavierausbildung zur Verfügung standen. Das späteste bekannte traditionell gebaute Instrument (F1–f3, gebunden) wurde 1839 von K. Kunz in Jaroměř/Böhmen gebaut. Anhand erhaltener Instrumente sind außer den bereits genannten Instrumentenmachern neben F. Hofmann, E. Klingler und J. Bohak in Wien, C. M. Gschwandtner (Schwandtner), G. Mitterreiter, F. X. Schwarz und A. Römer in Graz, Ch. Egedacher in Salzburg, J. A. Fuchs in Innsbruck, Johann Georg Klöckner und Johannes Vierengel (1710–1756) in Pressburg aus der ehemaligen Donaumonarchie etwa 10 weitere Meister namentlich als K.-Bauer nachweisbar.
Literatur
K. Birsak in Salzburger Museum Carolino Augusteum. Jahresschrift 34/1988 (1990); D. BoalchMakers of the Harpsichord and K. 1440–1840, 31995; G. Le Cerf/E.-R. Labande (Hg.), Les Traités d’Henri-Arnaut de Zwolle et de divers Anonymes (MS B. N. latin 7295), 1932 (Nachdruck 1972); B. Čížek, [Kat.] Klavichordy v Českých Zemích [Instrumente im Nationalmuseum – Museum der Tschechischen Musik in Prag] 1993; B. Brauchli, The Clavichord 1998; Beiträge v. E. Fontana, W. Strohmayer u. E. Szòràdovà in A. Huber (Hg.), Das österr. Cembalo 2001; M. Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum 1784; U. Henning, Musica Maximiliana 1987; Hopfner 1999; A. Huber in W. Salmen (Hg.), Musik und Tanz zur Zeit Kaiser Maximilian I. 1992; A. Huber in [Kat.] Die Klangwelt Mozarts. KHM Wien 1991; A. Huber in M. Nagy (Hg.), [Fs.] J. Mertin 1994; Kellner 1956; J. Koster in Clavichord International 4/5 (2000); J. Koster in Early Keyboard Journal 2002; Ch. Meyer, Mensura Monochordi: La Division du Monochorde (IXe–XVe siècles) 1996; MGG 2 (1995) [Clavichord]; I. Neske, Die Hss. der Stadtbibliothek Nürnberg 4 (1997); E. Ripin in E. Ripin (Hg.), Keyboard Instruments 1977; G. Stradner, Musikinstrumente in Grazer Slgn. 1986.
K. Birsak in Salzburger Museum Carolino Augusteum. Jahresschrift 34/1988 (1990); D. BoalchMakers of the Harpsichord and K. 1440–1840, 31995; G. Le Cerf/E.-R. Labande (Hg.), Les Traités d’Henri-Arnaut de Zwolle et de divers Anonymes (MS B. N. latin 7295), 1932 (Nachdruck 1972); B. Čížek, [Kat.] Klavichordy v Českých Zemích [Instrumente im Nationalmuseum – Museum der Tschechischen Musik in Prag] 1993; B. Brauchli, The Clavichord 1998; Beiträge v. E. Fontana, W. Strohmayer u. E. Szòràdovà in A. Huber (Hg.), Das österr. Cembalo 2001; M. Gerbert, Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum 1784; U. Henning, Musica Maximiliana 1987; Hopfner 1999; A. Huber in W. Salmen (Hg.), Musik und Tanz zur Zeit Kaiser Maximilian I. 1992; A. Huber in [Kat.] Die Klangwelt Mozarts. KHM Wien 1991; A. Huber in M. Nagy (Hg.), [Fs.] J. Mertin 1994; Kellner 1956; J. Koster in Clavichord International 4/5 (2000); J. Koster in Early Keyboard Journal 2002; Ch. Meyer, Mensura Monochordi: La Division du Monochorde (IXe–XVe siècles) 1996; MGG 2 (1995) [Clavichord]; I. Neske, Die Hss. der Stadtbibliothek Nürnberg 4 (1997); E. Ripin in E. Ripin (Hg.), Keyboard Instruments 1977; G. Stradner, Musikinstrumente in Grazer Slgn. 1986.
Autor*innen
Alfons Huber
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Alfons Huber,
Art. „Klavichord (Clavichord)‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x00028306
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.