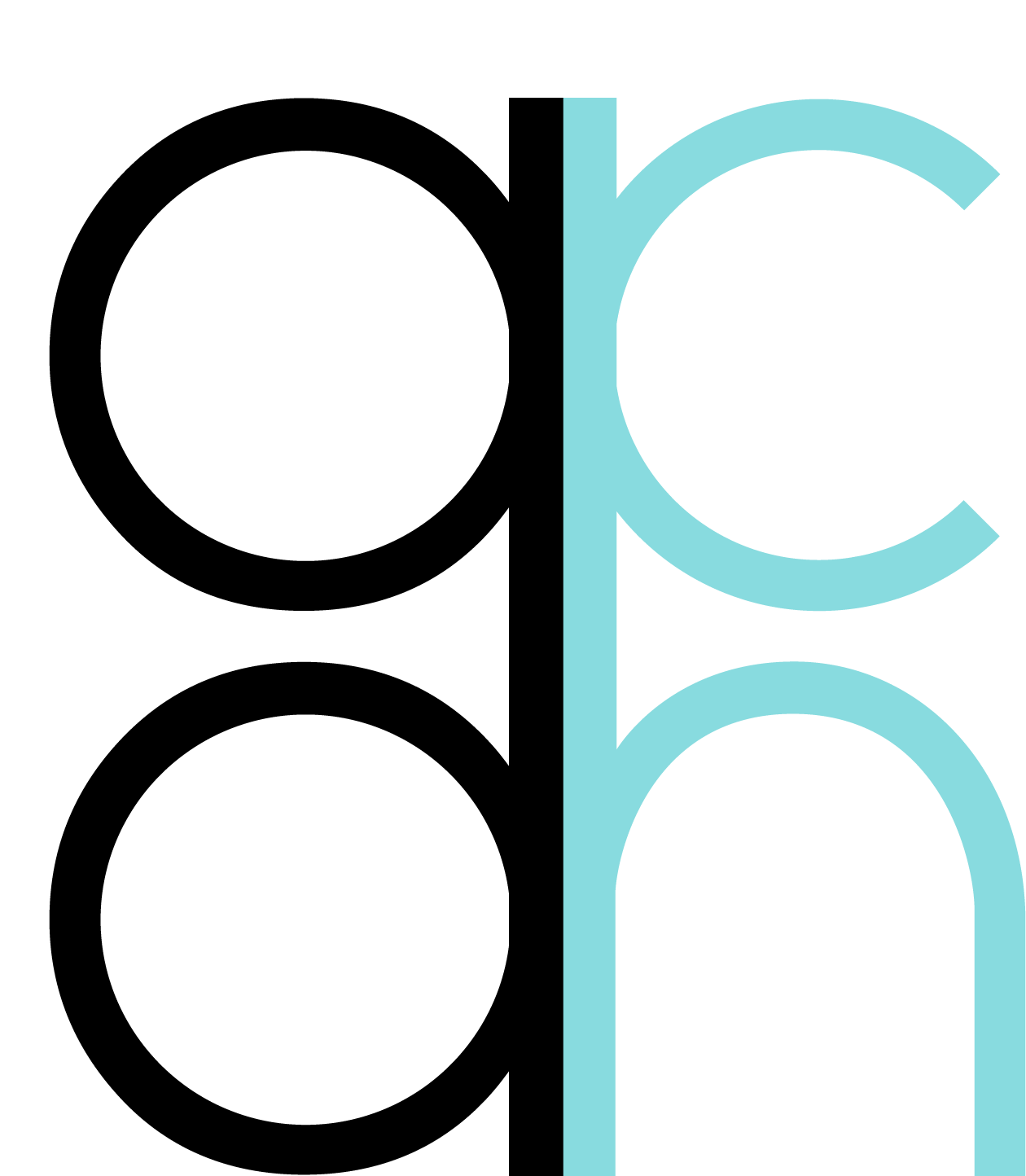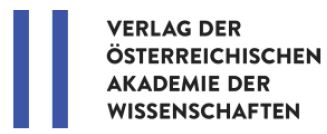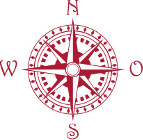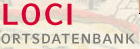Baden bei Wien
Traditionelle Kurstadt an der sog. Thermenlinie in Niederösterreich. Erste musikhistorisch relevante Erwähnung am 30.11.1373 in Zusammenhang mit einer Grundstücksschenkung an den Augustinerkonvent für „ein gesungen vigili“ und tags darauf „ein gesungen sel mezz“ zu einem Jahrestag.1720 wird Ignaz Vizthumb in B. geboren, der in L. Mozarts Tagebuch anlässlich der großen Parisreise als „Mr. Vicedom, musicien“ auftauchen wird. Seit 1751 reiche Theatertradition, die bis zur heutigen „Operettenmetropole“ reicht. Besondere Bedeutung des Theaters im 18. und 19. Jh., bedingt durch die Nähe zur Residenzstadt, einerseits als Sprungbrett für junge Talente, andererseits als Bühne, die Wiener Erfolge raschest möglich nachspielt und auf der namhafte Künstler Rollen vor Publikum erproben, bevor sie sich der internationalen Kritik stellen (M. Jeritza, Franz Völker, S. Kurz, L. Slezak).
1773 erster Besuch W. A. Mozarts mit dem Vater, 1774 zweiter Kurzbesuch mit dem Grafen Thun; 1789–91 zahlreiche Besuche Mozarts bei seiner die Kur gebrauchenden Frau Constanze. In der Nacht vom 16. auf den 17.6.1791 Komposition der Motette Ave verum corpus KV 618. Zwei Besuche Chr. W. Glucks 1781 und 1787 sind verbürgt. J. Haydn wohnt im Februar 1800 der Testamentseröffnung nach seiner Frau in B. bei.
1805–35 ist B. kaiserliche Sommerresidenz. Der Hof und alle wichtigen Persönlichkeiten (oder die sich dafür halten) sind in B., natürlich auch die wichtigsten Musiker wie z. B. F. Ries, A. Salieri, J. N. Hummel, L. A. Kozeluch, A. Diabelli, C. Czerny, M. Teyber, J. L. Eybler, Carl Friedrich Zelter, Felix Mendelssohn Bartholdy, A. Hüttenbrenner, Xaver Schnyder v. Wartensee, Fr. Schubert (Orgelfuge D 952, s. Abb.), C. M. v. Weber, Joh. Strauß Vater (Souvenir de B. op. 38; Mein schönster Tag in B. op. 58), J. Lanner (Schwechat-Ländler, op. 32; B.er Ringeln, op. 64). Der Wichtigste unter ihnen: L. v. Beethoven, der 1801–25 insgesamt 17-mal in B. weilt. Während dieser Aufenthalte arbeitete er an wichtigen Werken: Symphonien 3, 6 und 9 (s. Abb.); Messe in C op. 86, Missa solemnis op. 123; Wellingtons Sieg op. 91, Klavierkonzert Nr. 5 op. 73; Streichquartette op. 74, op. 130, op. 132; Klaviersonaten op. 81a, op. 90.
Zahlreiche in B. geborene Musiker machten große Karrieren: A. Huber-Haradauer, K. Canzi, L. Edler v. Meyer, C. Umlauf, R. Papier, E. Werba, E. Melkus.
Ab 1828 ist L. Köchel 10 Jahre als Erzieher der Kinder Erzhzg. Karls in dessen Villa Weilburg tätig, 1833 verbringt der russische Komponist Michael Glinka einige Wochen in B. 1835 verstirbt W. Müller, Schöpfer zahlreicher Schauspielmusiken für F. Raimund und J. Nestroy in B., und in den Revolutionswirren von 1848 fliehen u. a. C. Haslinger und R. G. Kiesewetter aus Wien in die vergleichsweise ruhige Stadt B.
1850 weilt der Geigenvirtuose Henri de Vieuxtemps vorübergehend in B. In der Aufbruchsstimmung der 1860er Jahre entstehen auch in B. Chor- und Orchestervereinigungen, die teilweise noch heute existieren.
1870 kommt erstmals der Klaviervirtuose A. Grünfeld nach B., wo er 40 Jahre treuer Gast bleibt. Grünfeld schreibt in B. an mehreren seiner Strauß-Walzer-Paraphrasen. 1885 ist C. Komzák, nachmaliger Kurkapellmeister, erstmals in B. Komzáks bekannteste Komposition ist der Walzer Badener Madln. Nach Komzáks tragischem Unfalltod 1905 bewirbt sich, nur ein halbes Jahr vor seinem Welterfolg mit der Lustigen Witwe, F. Lehár um die Kurkapellmeisterstelle, wird aber abgelehnt. 1894 übersiedelt R. Genée, Operettenkomponist und -librettist nach B., stirbt aber bald darauf (s. Abb.) 1897 ziehen C. Zeller und K. Millöcker nach B., um hier einen beschaulichen Lebensabend zu verbringen. Zeller stirbt 1898, Millöcker 1899. Ab 1905 kommt C. M. Ziehrer fast jährlich nach B., in den Sommermonaten 1909 sind E. Strauß und O. Straus hier. In den Jahren des Ersten Weltkrieges wird es sehr ruhig. Unmittelbar nach dem Krieg, 1919, sind W. Kienzl und R. Stolz in B.; ein Aufenthalt P. Mascagnis 1925, in dessen Verlauf er eine Aufführung seiner Cavalleria rusticana dirigiert, wird zum Medienereignis.
Anlässlich groß angelegter Beethovenfeiern zum 100. Todestag wird im Kurpark der „Beethoventempel“ eröffnet. 1928 ist ein erster Aufenthalt G. Adlers verbürgt. Er wird 1941 nächtens heimlich am B.er Jüdischen Friedhof beigesetzt werden.
1940 verlegt der Komponist von Operetten und Wienerliedern, H. Strecker, seinen Wohnsitz nach B., desgleichen M. Schönherr 1944. Beide verbringen einen schönen Lebensabend in B. Seit den 1980er Jahren ist H. Erbse Wahlbadener.
Literatur
A. Willander, Das Kirchenmusikarchiv der Stadtpfarrkirche St. Stephan zu B. Diss. Wien 1972; A. Willander, B. bei Wien 2007; Th. Frimmel in A. Sandberger (Hg.), Neues Beethoven-Jb. 1930; H. Rollett, Neue Beiträge zur Chronik der Stadt B. 1890.
A. Willander, Das Kirchenmusikarchiv der Stadtpfarrkirche St. Stephan zu B. Diss. Wien 1972; A. Willander, B. bei Wien 2007; Th. Frimmel in A. Sandberger (Hg.), Neues Beethoven-Jb. 1930; H. Rollett, Neue Beiträge zur Chronik der Stadt B. 1890.
Autor*innen
Alfred Willander
Letzte inhaltliche Änderung
15.9.2021
Empfohlene Zitierweise
Alfred Willander,
Art. „Baden bei Wien‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.9.2021, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001f7a9
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.