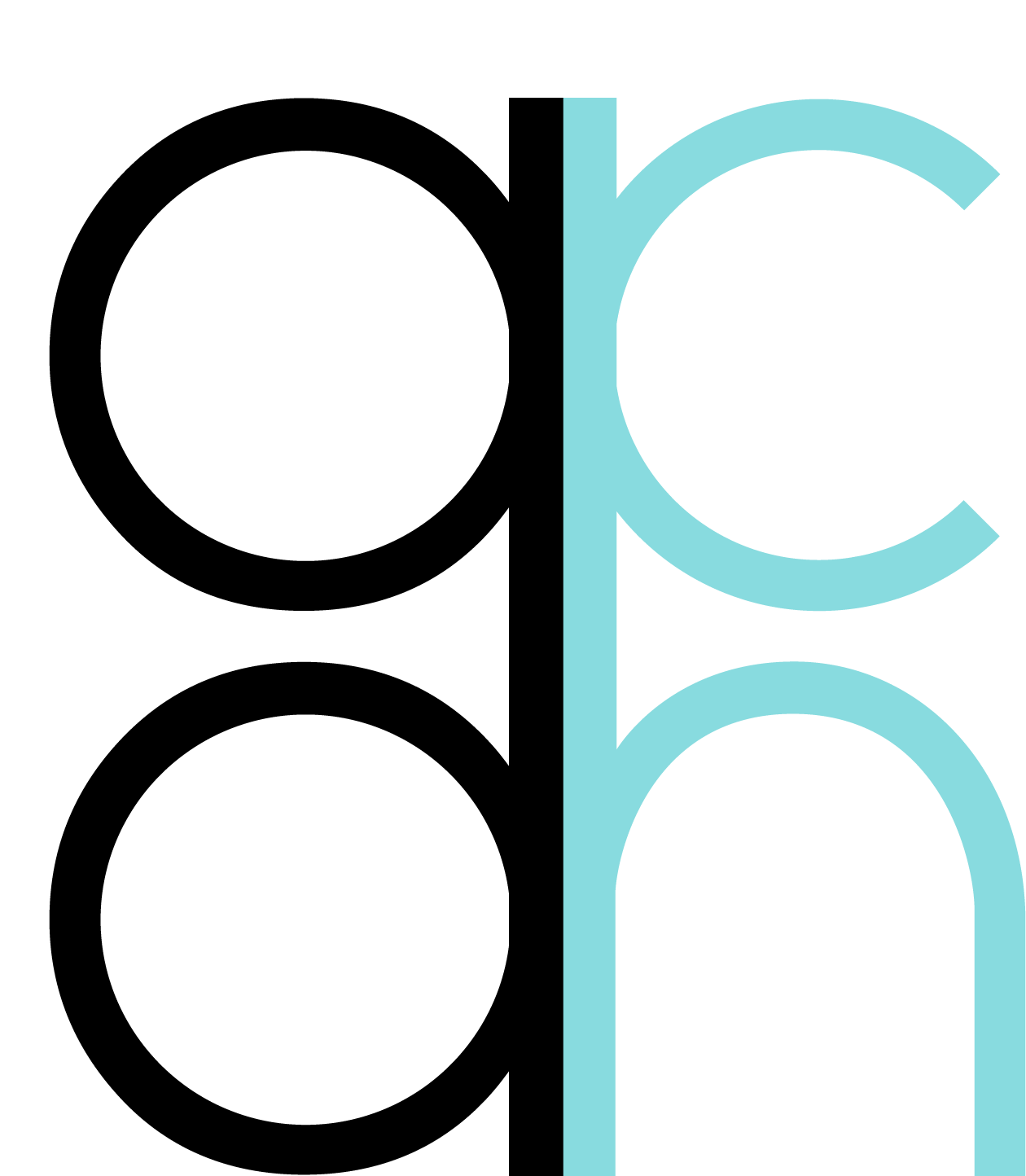Musikästhetik
Behandelt die Musik im Rahmen philosophischer oder psychologischer Theorien, sehr oft unter dem Aspekt des „Schönen“ und/oder der „Wahrnehmung“ (Ästhetik). Verglichen mit Deutschland kann man in Österreich nur in den seltensten Fällen von einer ausgeprägten M. sprechen. Das hängt mit der Entwicklung der österreichischen Philosophie zusammen. Deren empirische Ausrichtung erlaubte es – im Unterschied zum deutschen Idealismus – nicht, von obersten Sätzen/Wahrheiten auszugehen und von daher die Welt der Erscheinungen zu begreifen. Dadurch fehlt ihr aber notwendigerweise der Systemcharakter. Es empfiehlt sich daher, neben explizit musikästhetischen Werken auch praktische Lehrwerke, Musikkritiken, literarische Werke, Briefe, Tagebücher etc. einzubeziehen, die neben ihrem eigentlichen Zweck auch über das ästhetische Denken ihres Autors Aufschluss geben.Zu den zentralen ästhetischen Begriffen des 18. Jh.s zählt der Geschmack. Nach J. J. Fux (Gradus ad parnassum, 1725) besitzt ihn jener Komponist, der sich maßvoll dem Neuen nähere, ohne das Alte preiszugeben, Unwürdiges (speziell in der Kirchenmusik) vermeide und es verstehe, auch den Kenner zufrieden zu stellen. Anders als dann am Ende des Jh.s die Genieästhetik mit ihrem Postulat der Originalität begreift Fux ganz in der Tradition barocker Nachahmungsästhetik die Befolgung handwerklicher Regeln – und nicht deren Überschreitung – als Voraussetzung vollkommener Kunst. Fux behandelt auch die Affektenlehre, wonach es Aufgabe des Komponisten sei, seine Zuhörer zu „rühren“. Er unterscheidet dabei strikt zwischen Kirchen-, Kammer- und Theatermusik, nur bei den letzten beiden sei es erlaubt, auch starke Leidenschaften hervorzurufen. Anders als etwa der Hamburger Musikdirektor Johann Mattheson (1681–1764) ging Fux noch vom Primat der mathematischen Begründbarkeit von Musik aus, gab also der ratio den Vorrang gegenüber dem sensus.
Eine Generation später verwarf L. Mozart (Versuch einer gründlichen Violinschule, 1756) jegliche mathematische Spekulation und vertrat – ähnlich wie in Deutschland Johann Joachim Quantz in seiner Flöten- (1752) und C. Ph. E. Bach in seiner Klavierschule (1753–62) – zwei für das Zeitalter der Empfindsamkeit typische Gedanken: dass sich der Spieler in den Affekt, den er beim Hörer erreichen will, zunächst selbst versetzen muss und dass Natürlichkeit und Einfachheit barocken Prunk zu ersetzen habe. Gleichzeitig wird das barocke Festhalten an der Einheit eines Affekts innerhalb eines Stücks durch die freie Wahl wechselnder Empfindungen abgelöst. Noch gilt aber die Vokalmusik als paradigmatische Musikgattung, an der sich die Instrumentalmusik zu orientieren habe.
Geschmack und Rührung sowie eine nationale Charakterisierung der Musik sind auch die Themen eines anonymen Artikels im Wienerischen Diarium (Von dem Wienerischen Geschmack in der Musik, 1766). Aufgabe der Musik sei es, „zu gefallen, zu bewegen, zu rühren und Vergnügen zu schaffen“. Der Artikel erschien als Reaktion auf deutsche Polemiken gegen die italienische Musik, zu der auch die Wiener gerechnet wurde (etwa G. Ch. Wagenseil, aber auch J. Haydn) und die als modisch, brillant, ja bizarr beschrieben wurde und das Erhabene, Würdige deutscher Musik vermissen lasse. Dahinter stand die Auseinandersetzung zwischen einer galanten, melodiebetonten bzw. einer gelehrten, polyphonen Schreibweise. Der Autor befürwortete eine Verbindung beider und propagierte damit – wie Mattheson und Quantz – einen vermischten Stil als anzustrebenden Universalstil.
Mit dem Aufstieg des Bürgertums (bürgerliche Musikkultur) stieg auch der Bedarf an ästhetischen Schriften belehrenden Charakters. Eine solche verfasste der Arzt und Philosoph A. W. Smith (Fragmente über die praktische Musik, 1787). Empfindungen zu erregen, definiert auch er als Hauptzweck der Musik. Ebenso finden sich bei ihm – in offensichtlicher Anlehnung an die französischen Enzyklopädisten – die aufklärerischen Forderungen nach Einfachheit, Deutlichkeit, Natürlichkeit und Singbarkeit, die er durch das Virtuosentum gefährdet sieht. Wegen ihrer sowohl medizinischen als auch ethischen Wirkung schlägt er die Musik auch als Mittel nationaler Erziehung vor.
Im frühen 19. Jh. setzte die Kanonisierung der eben zu Ende gegangenen Epoche als „Klassik“ ein. Dabei stand die spätere Fixierung auf die drei Wiener Klassiker noch keineswegs fest. I. v. Mosel etwa gab einerseits in seiner Opernästhetik (Versuch einer Aesthetik des dramatischen Tonsatzes, 1813) Ch. W. Gluck den Vorrang vor W. A. Mozart, da Ersterer kein Gesangsvirtuosentum ohne innere, dramatische Begründung dulde, andererseits sah er das klassische „Ebenmaß“ bereits bei L. v. Beethoven verletzt.
Fehlten zunächst auch größere musikästhetische Werke österreichischer Provenienz, die einige Resonanz hätten finden können, so kann man wohl von einer Rezeption ausländischer, v. a. deutscher Publikationen (etwa von Christian Daniel Friedrich Schubart, Ferdinand Hand, Gustav Schilling u. a.) ausgehen. Ebenso dürfte verschiedentlich die Rolle der Musik in der Philosophie Immanuel Kants und des deutschen Idealismus (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling) bekannt gewesen sein. Von Schelling und Schlegel beeinflusst zeigte sich etwa Franz Ficker (1782–1849), Prof. für Ästhetik an der Univ. Wien. Ganz im Sinne der romantischen Metaphysik der Tonkunst definiert er diese als „die subjektivste Kunst, die Kunst durch unartikulirte Töne unmittelbar Gefühle, mittelbar die ewige Idee des Schönen, die Ahnung des Höchsten und Heiligsten in der Zeit darzustellen“ (Aesthetik oder Lehre vom Schönen und von der Kunst in ihrem ganzen Umfange, 1830). Für das Aesthetische Lexikon des Prager Schriftstellers Ignaz Jeitteles (1783–1843) verfasste E. v. Lannoy die Musikartikel. Die Symphonie sieht er etwa als „Triumph der reinen, d. h. der Instrumentalmusik“ und verurteilt dementsprechend programmmusikalische Tendenzen. Für eine Autonomie der Musik trat auch F. Grillparzer ein. Diese habe sogar in der Oper eine gewisse Berechtigung, weshalb Grillparzer G. Rossini höher schätzte als Gluck. Als Klassizist gab er Mozart den Vorzug vor Beethoven, der die Grenzen der Kunst und damit des Schönen überschritten hätte. Im Gegensatz zur idealistischen Philosophie und zu den Romantikern (vgl. R. Schumann) plädierte er für Spezialästhetiken, um die besonderen Bedingungen musikalischer Kunst zu verdeutlichen, und wünschte sich entsprechend ein Gegenstück zu „Lessings Laokoon: Rossini, oder über die Grenzen der Musik und Poesie“.
Eine solche Spezialästhetik für Musik verfasste dann E. Hanslick (Vom Musikalisch-Schönen, 1854). Dabei war sein Ausgangspunkt, wie frühe Kritiken zeigen, durchaus hegelianisch, d. h. er verstand die Aufgabe der Musik durchaus im Dienste außermusikalischer, auch politischer Ideen. Mit seiner Wende zur absoluten Musik verband sich dann aber ein Verständnis von M., das insofern an den Naturwissenschaften – und nicht mehr an der Philosophie – orientiert war, als es induktiv, d. h. im Ausgang von den konkreten Kunstwerken, die Gesetze des Schönen finden wollte und diese nicht mehr deduktiv wie die idealistische Ästhetik postulierte. Hanslick konzentrierte sich dabei ausschließlich auf die Objektseite eines Musikwerks und bezog das wahrnehmende Subjekt (anders als der Prager Philosoph B. Bolzano) nicht mit ein, da er die Beziehung zwischen beiden für wissenschaftlich nicht erfassbar hielt. Deshalb lehnte er die Gefühlästhetik ab, da sie keinen zwingenden Kausalzusammenhang zwischen einem musikalischen Reiz und einer durch ihn ausgelösten Stimmung herstellen könne. Zwangsläufig führte dies Hanslick zu einer Konzentration auf die formalen Qualitäten von Musik. Ähnliches leistete für die allgemeine Ästhetik Hanslicks Freund R. Zimmermann, der auch für die Tilgung von Resten „romantischer“ Musikanschauung in der Tradition der Sphärenharmonie (Harmonikale Forschung) – Musik als Ausdruck des Unendlichen – in der Erstauflage von Hanslicks Buch den Anstoß gab.
Dem deutschen Idealismus und insbesondere Hegel verpflichtet blieb dagegen Hanslicks Prager Freund A. W. Ambros (Die Grenzen der Musik und Poesie, 1856): Musik sei eine „poetische, der Idee dienende Kunst“. Diese Idee müsse allerdings aus den Stimmungen, die die Tonverbindungen hervorrufen, selbst verständlich sein, ohne dass ein äußeres Programm herangezogen werde. Ähnlich argumentierte auch F. P. Graf Laurencin. Ein Befürworter der Programmmusik war dagegen der Grazer F. v. Hausegger, der im Gegensatz zu Hanslick postulierte: „Das Wesen der Musik ist Ausdruck“. Gerade das, was Hanslick unmöglich schien – die Bestimmung des Kausalverhältnisses zwischen musikalischem Reiz und ausgelöstem Gefühl –, hielt Hausegger unter Berufung auf Charles Darwin und Herbert Spencer für möglich, und indem er die musikalischen Elemente physiologischen Gesetzen unterworfen sah, gelangte er zu einer psychophysischen Erklärung von Musik.
Auf universitärer Ebene kam es unter Hanslicks Schüler und Lehrstuhlinhaber G. Adler zu massiven Vorbehalten gegen die Ästhetik insgesamt. Zwar wies Adler der M. in seiner frühen Grundsatzschrift (Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, 1885) noch wichtige Aufgaben im Rahmen der systematischen Musikwissenschaft zu: sie solle nämlich die von der Historie einerseits sowie von den Naturwissenschaften andererseits festgestellten musikalischen Gesetze und Normen vergleichen und daraus die „Kriterien des musikalisch Schönen“ bzw. des Kunstwerks bestimmen. Zu diesem Zweck hält er auch – im Gegensatz zu Hanslick – die Berücksichtigung des „appercipirenden Subjects“ für unerlässlich. Hier wird der Einfluss der neueren psychologischen Ästhetik, wohl auch der seines Philosophie-Lehrers F. Brentano deutlich. In der Folge rückte allerdings unter Adler die musikhistorische Forschung ins Zentrum der Musikwissenschaft v. a. in der ihn und seine Schule kennzeichnenden Form der Stilkritik, und die Ästhetik wurde als unwissenschaftlich abgetan. In Adlers Institut wurde sie – von Adler wenig geschätzt – von M. Dietz und R. Wallaschek vertreten, von Letzterem dezidiert in der psychologischen Variante (Psychologische Ästhetik [1917], 1930).
Größte Wirkung auch auf österreichische Komponisten (G. Mahler, A. Schönberg) hatte ab der Mitte des 19. Jh.s die Philosophie A. Schopenhauers (Die Welt als Wille und Vorstellung, 1819). Das hat unmittelbar mit der herausragenden Stellung der Musik in dessen Willensmetaphysik zu tun. Während nämlich die übrigen Künste nur ein Abbild der Ideen/Vorstellungen repräsentierten, die ihrerseits nur Objektivationen des Willens als des Urgrundes der Welt seien und bereits den drei Grundfunktionen (Zeit, Raum, Kausalität) unterliegen, sei die Musik ein „Abbild des Willens selbst“, das der Komponist gewissermaßen als Werkzeug des Willens unbewusst schaffe. Bei Mahler wird er zum „Instrument, auf dem das Universum spielt“. Bei Schönberg ist er „der Ausführende eines ihm verborgenen Willens, des Instinkts, des Unbewussten in ihm“ (Harmonielehre, 1911). Nicht nur mit seinen musikphilosophischen Gedanken (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872; Rich. Wagner), sondern allgemein mit seinen lebens- und kulturphilosophischen Reflexionen beeinflusste F. Nietzsche eine Reihe von Komponisten (u. a. Mahler, R. Strauss, Also sprach Zarathustra).
Darüber hinaus blieb die ganze romantische Musikästhetik, die speziell die Instrumentalmusik zum Medium des Unaussprechlichen erklärt hatte (vgl. E. T. A. Hoffmann, Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder), als „Künstlerästhetik“ aktuell. Schönberg sah den Zweck der Musik darin, „sich durch die Mystik mit dem Weltall in Verbindung zu setzen“ (Das Verhältnis zum Text, 1912). Diesem Zweck dienten auch die neuen Kunstmittel (Atonalität). Kriterien wahrer Kunst seien Vornehmheit, Ungewöhnlichkeit, Wahrhaftigkeit, Intensität, nicht mehr jedoch die Schönheit (Harmonielehre, 1911). In der Zwölftontechnik mit ihrer Möglichkeit, immer dichtere musikalische Zusammenhänge herzustellen, sah man Analogien mit weltanschaulichen, naturphilosophischen, ja mystischen Bereichen. Schönberg rekurrierte u. a. auf die Korrespondenzlehre des schwedischen Naturforschers und Mystikers Emmanuel Swedenborg, A. v. Webern verglich die Zwölftonreihe mit Goethes Urpflanze, aus deren Metamorphose alle pflanzlichen Erscheinungsformen sich entwickelten. Metaphysische Reste finden sich aber auch bei einzelnen Vertretern der Musiktheorie (H. Schenker, E. Kurth), wegen ihrer Auffassung eines hinter dem eigentlichen Werk liegenden Ursatzes (Schenker) bzw. einer energetischen Kraft (Kurth) auch als „Spannungsästhetiker“ bzw. „Energetiker“ bezeichnet (Schäfke).
J. M. Hauer wiederum bemühte die antike Sphärenharmonie: „Die Töne mit ihren Obertönen sind Sonnen mit ihren Planeten“ (Szmolyan, 1965). Mit seinen späteren Zwölftonspielen wollte er dann eine vollkommen gesetzmäßige, entsubjektivierte Kunst schaffen und verließ damit den Bereich romantischer Kunstauffassung. Auf den übersteigerten Subjektivismus in Romantik und Expressionismus reagierten auch die Komponisten des Neoklassizismus (Klassizismus, F. Busoni, E. Krenek). Der Zusammenhang mit lebensreformerischen, gegen die bürgerliche Weltauffassung gerichteten Bemühungen spielte allerdings bei den Komponisten in Deutschland (Paul Hindemith) und Frankreich (Darius Milhaud, Francis Poulenc) eine größere Rolle als in Österreich.
Die Entwicklung des musikästhetischen Denkens in Österreich lässt sich durchaus mit jener in Europa, speziell mit der in Deutschland vergleichen. Mitunter verspätet oder vereinfacht finden sich auch hierzulande die wichtigsten Phasen musikästhetischen Räsonnierens seit dem 18. Jh.: von der bis in die Antike zurückreichenden Auffassung von Musik als „tönender“ Mathematik, über die barocke Affektenlehre mit ihrem Ausdruck typisierter Affekte (Fux), über die mehr subjektive Kategorie der Rührung und weiterer aufklärerischer Gebote wie Einfachheit und Natürlichkeit (L. Mozart, Smith) bis zur romantisch-idealistischen Anschauung von Musik als Ausdruck begriffsloser Transzendenz. Letztere, vermittelt durch eine Schopenhauer- und Rich. Wagner-Rezeption, bestimmte v. a. die Künstlerästhetik (Mahler, Schönberg, in dieser Hinsicht auch Hauer). Auf diese übersteigerte metaphysische Überfrachtung reagierten dann die Vertreter des Neoklassizismus mit ihrem Rückgang auf vorromantische musikalische Formen. Verhielten sich die österreichischen Autoren bei dieser Entwicklung mehr rezeptiv, so können sie bei der Formulierung einer klassizistisch-formalistischen Musikästhetik seit der Mitte des 19. Jh.s mehr Originalität beanspruchen (Hanslick, Grillparzer). Spuren dieser radikalen Autonomieästhetik finden sich bei den Philosophen L. Wittgenstein und K. Popper, eine große Rolle spielte sie dagegen bei dem musikalisch stark in Wien sozialisierten Th. W. Adorno. In trivialisierter Form (ästhetischer Vorrang der klassischen Instrumentalmusik = „Hanslickiade“) erreichte diese dann den Status einer bis heute nachwirkenden „bürgerlichen“ Musikauffassung.
Literatur
MGG 6 (1997); C. Dahlhaus, Musikästhetik 1967; E. Fubini, Gesch. der Musikästhetik 1997; C. Dahlhaus, Klassische und romantische Musikästhetik 1988; C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik 1978; R. Schäfke, Gesch. der Musikästhetik in Umrissen 1934, 21964; St. L. Sorgner/O. Fürbeth (Hg.), Musik in der dt. Philosophie 2003; B. Boisits in K. Acham (Hg.), Gesch. der österr. Humanwissenschaften 6 (2004); K. Blaukopf, Pioniere empiristischer Musikforschung 1995; R. Flotzinger in Ch. Asmuth et al. (Hg.), Philosophischer Gedanke und musikalischer Klang. Zum Wechselverhältnis von Musik und Philosophie 1999; MGÖ 2 u. 3 (1995); J. J. Fux, Gradus ad Parnassum 1725 (NA, hg. v. A. Mann in Sämtliche Werke, VII/1 [1967], dt. v. L. Mizler 1742, Reprint 1974); R. Flotzinger in Jb. der Österr. Ges. zur Erforschung des Achtzehnten Jh.s 9 (1994), 1995; L. Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule 1756 (Reprint 1995); Von dem Wienerischen Geschmack in der Musik in 26. Beilage (Gelehrte Nachrichten) zum Wienerischen Diarium 18.10.1766; R. Haas in E. H. Müller (Hg.), [Fs.] J. Biehle 1930; R. Hirschfeld in Beilage (Jubiläums-Festnummer) der Wr. Ztg. 8.8.1903; N. Tschulik in StMw 30 (1979); A. W. Smith, Philosophische Fragmente über die praktische Musik 1787; I. Fuchs in StMw 42 (1993); I. v. Mosel, Versuch einer Aesthetik des dramatischen Tonsatzes 1813 (NA, hrsg. v. E. Schmitz 1910); I. v. Mosel in Allgemeine Wr. Musik-Zeitung 3 (1843), 561; Th. Antonicek in ÖMZ 49 (1994); F. Ficker, Aesthetik oder Lehre vom Schönen und von der Kunst in ihrem ganzen Umfange 1830, 21840; I. Jeitteles, Aesthetisches Lex., 2 Bde. 1835 u. 1837; F. Grillparzer, Prosaschriften, Bd. 2: Aufsätze über Literatur, Musik und Theater. Musikalien, hg. v. A. Orel 1925; E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen [1854] (NA hg. v. D. Strauß 1990); F. P. Graf Laurencin, Dr. Eduard Hanslick’s Lehre vom Musikalisch-Schönen. Eine Abwehr 1859; A. W. Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie 1856, 21872; F. v. Hausegger, Die Musik als Ausdruck 1885, 2. erw. Aufl. 1887; F. v. Hausegger, Gedanken eines Schauenden. Gesammelte Aufsätze, hg. v. S. v. Hausegger 1903; R. Flotzinger in MusAu 6 (1986); G. Adler in VfMw 1 (1885); R. Wallaschek, Ästhetik der Tonkunst 1886; R. Wallaschek, Psychologische Ästhetik, hg. v. O. Katann 1930; E. W. Partsch in StMw 36 (1985); A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 1819 (= Sämtliche Werke, hg. v. W. Freiherr v. Löhneysen, Bd. 1 u. 2, 1986); A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, 2 Bde. 1851 (= Sämtliche Werke, Bd. 4 u. 5); F. Nietzsche in G. Colli/M. Montinari (Hg.), Kritische Studienausgabe 1 (21988); G. Mahler, Briefe, hg. v. H. Blaukopf 21996; C. Floros, Gustav Mahler 1 (1977); A. Schönberg, Harmonielehre 1911; A. Schönberg, Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik 1976; A. Webern, Der Weg zur Neuen Musik 1960; W. Szmolyan, Josef Matthias Hauer 1965; H. Schenker, Neue musikalische Theorien und Phantasien, 3 Bde. 1906–35; E. Kurth, Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Eine Einführung in Bachs melodische Polyphonie 1917; E. Kurth, Bruckner 1925; Ch. Landerer in MusAu 20 (2001).
MGG 6 (1997); C. Dahlhaus, Musikästhetik 1967; E. Fubini, Gesch. der Musikästhetik 1997; C. Dahlhaus, Klassische und romantische Musikästhetik 1988; C. Dahlhaus, Die Idee der absoluten Musik 1978; R. Schäfke, Gesch. der Musikästhetik in Umrissen 1934, 21964; St. L. Sorgner/O. Fürbeth (Hg.), Musik in der dt. Philosophie 2003; B. Boisits in K. Acham (Hg.), Gesch. der österr. Humanwissenschaften 6 (2004); K. Blaukopf, Pioniere empiristischer Musikforschung 1995; R. Flotzinger in Ch. Asmuth et al. (Hg.), Philosophischer Gedanke und musikalischer Klang. Zum Wechselverhältnis von Musik und Philosophie 1999; MGÖ 2 u. 3 (1995); J. J. Fux, Gradus ad Parnassum 1725 (NA, hg. v. A. Mann in Sämtliche Werke, VII/1 [1967], dt. v. L. Mizler 1742, Reprint 1974); R. Flotzinger in Jb. der Österr. Ges. zur Erforschung des Achtzehnten Jh.s 9 (1994), 1995; L. Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule 1756 (Reprint 1995); Von dem Wienerischen Geschmack in der Musik in 26. Beilage (Gelehrte Nachrichten) zum Wienerischen Diarium 18.10.1766; R. Haas in E. H. Müller (Hg.), [Fs.] J. Biehle 1930; R. Hirschfeld in Beilage (Jubiläums-Festnummer) der Wr. Ztg. 8.8.1903; N. Tschulik in StMw 30 (1979); A. W. Smith, Philosophische Fragmente über die praktische Musik 1787; I. Fuchs in StMw 42 (1993); I. v. Mosel, Versuch einer Aesthetik des dramatischen Tonsatzes 1813 (NA, hrsg. v. E. Schmitz 1910); I. v. Mosel in Allgemeine Wr. Musik-Zeitung 3 (1843), 561; Th. Antonicek in ÖMZ 49 (1994); F. Ficker, Aesthetik oder Lehre vom Schönen und von der Kunst in ihrem ganzen Umfange 1830, 21840; I. Jeitteles, Aesthetisches Lex., 2 Bde. 1835 u. 1837; F. Grillparzer, Prosaschriften, Bd. 2: Aufsätze über Literatur, Musik und Theater. Musikalien, hg. v. A. Orel 1925; E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen [1854] (NA hg. v. D. Strauß 1990); F. P. Graf Laurencin, Dr. Eduard Hanslick’s Lehre vom Musikalisch-Schönen. Eine Abwehr 1859; A. W. Ambros, Die Grenzen der Musik und Poesie 1856, 21872; F. v. Hausegger, Die Musik als Ausdruck 1885, 2. erw. Aufl. 1887; F. v. Hausegger, Gedanken eines Schauenden. Gesammelte Aufsätze, hg. v. S. v. Hausegger 1903; R. Flotzinger in MusAu 6 (1986); G. Adler in VfMw 1 (1885); R. Wallaschek, Ästhetik der Tonkunst 1886; R. Wallaschek, Psychologische Ästhetik, hg. v. O. Katann 1930; E. W. Partsch in StMw 36 (1985); A. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung 1819 (= Sämtliche Werke, hg. v. W. Freiherr v. Löhneysen, Bd. 1 u. 2, 1986); A. Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, 2 Bde. 1851 (= Sämtliche Werke, Bd. 4 u. 5); F. Nietzsche in G. Colli/M. Montinari (Hg.), Kritische Studienausgabe 1 (21988); G. Mahler, Briefe, hg. v. H. Blaukopf 21996; C. Floros, Gustav Mahler 1 (1977); A. Schönberg, Harmonielehre 1911; A. Schönberg, Stil und Gedanke. Aufsätze zur Musik 1976; A. Webern, Der Weg zur Neuen Musik 1960; W. Szmolyan, Josef Matthias Hauer 1965; H. Schenker, Neue musikalische Theorien und Phantasien, 3 Bde. 1906–35; E. Kurth, Grundlagen des linearen Kontrapunkts. Eine Einführung in Bachs melodische Polyphonie 1917; E. Kurth, Bruckner 1925; Ch. Landerer in MusAu 20 (2001).
Autor*innen
Barbara Boisits
Letzte inhaltliche Änderung
14.3.2004
Empfohlene Zitierweise
Barbara Boisits,
Art. „Musikästhetik‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
14.3.2004, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001da79
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.