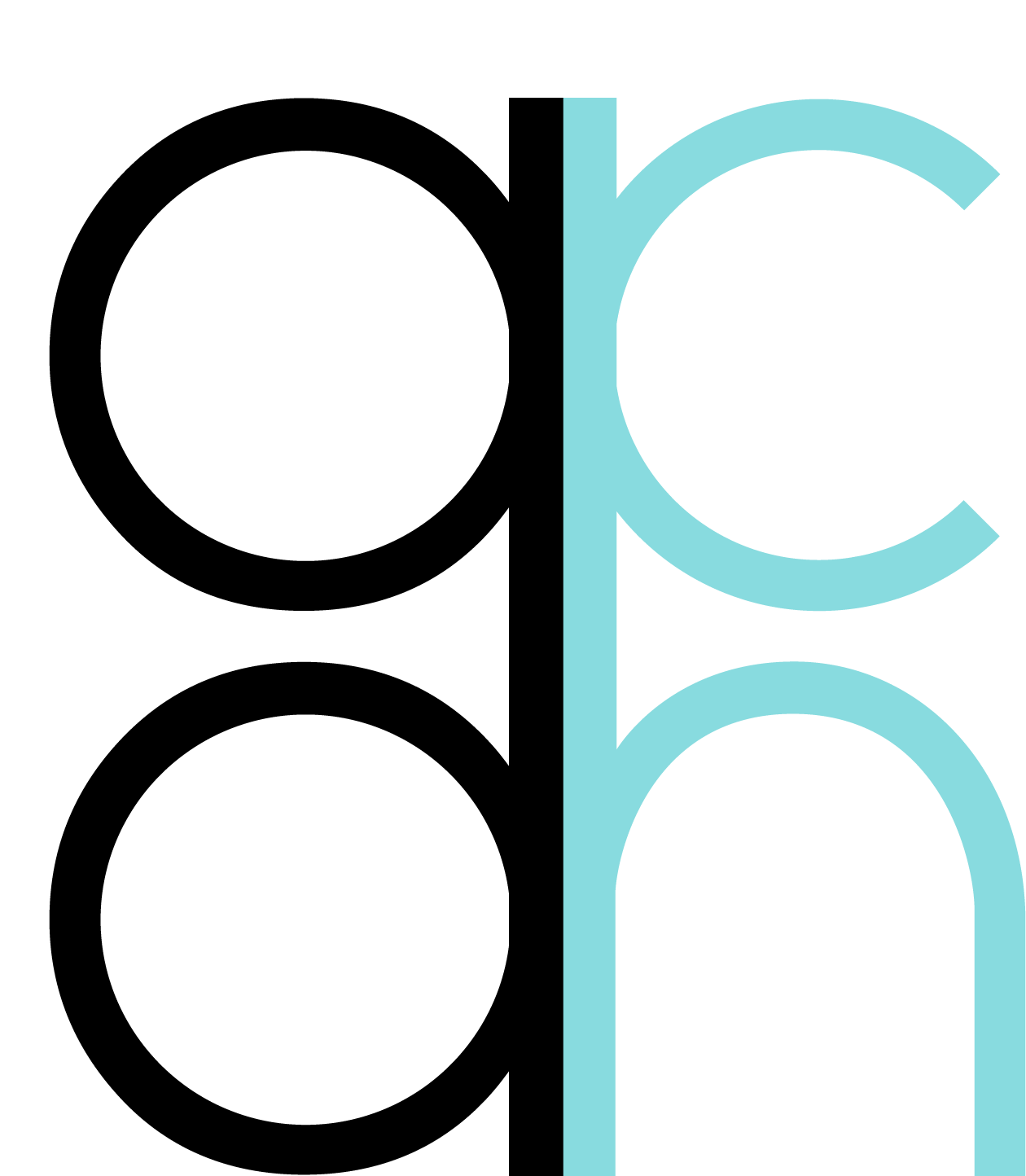Variation
Veränderung (lat. variatio) einer melodisch oder harmonisch feststehenden Gestalt als epochen- und stilübergreifendes Kompositionsprinzip und im engeren Sinn als eigenständige, an ein (präexistentes) Thema gebundene Form. Jenseits der pädagogisch brauchbaren Unterscheidung von Figural- und Charakter-V. lassen sich historisch und systematisch differenzieren: c. f.-V. (über einen Choral oder ein Lied, dieser Typus noch bei J. Haydn, V.en über die Kaiserhymne im Streichquartett Hob. III:77, oder bei Fr. Schubert); Ostinato-V. (über Bass- oder Harmonieformeln wie Passamezzo antico und moderno, Romanesca, Folia, Ruggiero sowie als Chaconne und Passacaglia); harmoniekonstante V. (Generalbass-V.); Melodie-V.; freie Fantasie-V.;
Reihen-V. (Zwölfton-V.).Im Mittelalter treten variative Verfahren in der Tanzmusik, in instrumentalen Bearbeitungen vokaler Sätze (Robertsbridge-Codex, Codex Faenza, Buxheimer Orgelbuch), in der Isorhythmie, aber z. B. auch im Lied Untarn slaf des Mönchs von Salzburg auf.
In der österreichischen Barockmusik sind die Hauptvertreter der z. T. von Italien (Girolamo Frescobaldi, B. Pasquini) beeinflussten V. P. Peuerl, W. Ebner, J. J. Froberger (Partita auff die Mayerin mit acht V.en, davon eine chromatische), H. I. F. Biber (Violinsonate, Rosenkranz-Sonaten) und A. Poglietti (Rossignolo 1677). Die sog. V.s-Suite, eine Sonderform der Suite, bei der alle oder einzelne Tanzsätze ein gemeinsames Kopfmotiv aufweisen und auch sonst motivisch voneinander abgeleitet sind, ist zwar nicht im süddeutsch-österreichischen Raum entstanden, jedoch hier von den genannten Komponisten (und früh [1609] von J. Thesselius) besonders gepflegt worden.
In der 2. Hälfte des 18. Jh.s sind in Wien über 100 V.en nachweisbar; die vor und um 1800 herrschende Mode, als deren Repräsentant J. Gelinek gelten kann, wurde schon von Zeitgenossen (Charles Burney, Jérôme-Joseph de Momigny) kritisiert. Von der Massenproduktion heben sich z. B. Sätze von L. Kozeluch und J. B. Vanhal (Thème avec VII Variations caracteristiques, ca. 1805) ab. Innovativ wirkte J. Haydn, der an C. Ph. E. Bach anknüpfte und häufig V.s-Sätze in zyklischen Kammermusikwerken und Symphonien einbaute. Eine besondere, der Rondoform nahestehende Spielart sind Haydns Doppel-V.en über zwei „Themen“ (meist harmonisch unterschiedliche Modelle). W. A. Mozart setzte sich zwar in seinen Streichquartetten mit J. Haydn auseinander, fand aber einen anderen Zugang zur V.s-Form, der sich besonders in den Klavier-V.en sowie den Divertimenti und Serenaden genetisch und phänomenologisch bemerkbar macht: die Improvisation. Sie steht mit der barocken Technik des „Doppelgerüsts“ (Diskant-Bass-Stimmzüge) in engem Zusammenhang. Die von Mozart in den Klavier-V.en bevorzugte formale Anlage (in der Mitte eine Moll-V., als vorletzte eine Adagio-V., kadenzartige Schluss-V. mit Taktwechsel, manchmal Refrainbildung) wurde u. a. von J. N. Hummel, J. Wölfl, E. A. Förster und F. X. Süßmayr rezipiert.
In L. v. Beethovens Schaffen wird die V. geradezu zum Vehikel neuer Ausdrucksmöglichkeiten. Während am Anfang traditionelle V.en über beliebte Themen stehen, treten nach 1800 Experimente (vgl. die „ganz neue Manier“ in op. 34 und den Eroica-V.en op. 35 über eigene Themen) hinzu, werden mit barocken Satztechniken vermittelt und erreichen in den Diabelli-V.en op. 120 und in den späten Streichquartetten eine von der durchaus vorhandenen Sinnlichkeit abstrahierende Vergeistigung (vgl. die „subthematischen“ Beziehungen zwischen op. 120 und der Arietta aus der Klaviersonate op. 111).
Abgesehen von ihrem musikalischen Gehalt sind V.en über beliebte Melodien (wie W. J. Tomascheks über O du lieber Augustin) oder die zahlreichen Veränderungen über die Volkshymne, u. a. von C. Czerny (op. 73 und 123) und das Orgelwerk von S. Sechter, auch als Beitrag zur österreichischen Identität anzusehen. Zu A. Diabellis 1824 gedrucktem Vaterländischem Künstlerverein ließen sich außer Beethoven 50 Komponisten einladen, die das damalige Musikleben Wiens repräsentierten. Die Sammlung ist weniger künstlerisch denn als sozialgeschichtliche Momentaufnahme des Biedermeier wertvoll. Aus dem Rahmen fällt der c-Moll-Walzer von Fr. Schubert. Dieser entwickelte in späteren Werken bzw. Sonatensätzen ein eher lyrisch kreisendes als dramatisch zielgerichtetes Prinzip des Variierens (z. B. in mehreren Klaviersonaten, im Forellenquintett oder im Streichquartett Der Tod und das Mädchen). Virtuos gehalten sind die Flöten-V.en über das Lied Trockne Blumen, während Schubert etwa in der sog. Wandererfantasie oder im V.s-Satz der Klaviersonate D 845 neue formale Lösungen anstrebte. – Mit der Gattung der Fantasie überschneidet sich das virtuose Hexameron (1837) nach dem Marsch aus Vincenzo Bellinis I Puritani, ein Gemeinschaftswerk von F. Liszt, S. Thalberg, J. P. Pixis, H. Herz, C. Czerny und F. Chopin. Czerny verfasste auch eine Anleitung zum Phantasieren (Wien 1836) mit einem Kapitel und Beispielen zur V.
J. Brahms schuf selbständige V.en über Themen von R. Schumann, G. F. Händel und J. Haydn (apokryph). Eine Summe seiner Werke, die er von der Fantasie-V. abgrenzte und in denen nach eigenen Bemerkungen der Bass als satztechnisches Fundament dient, zog er in der Passacaglia der 4. Symphonie (Vorbild für die 2. Symphonie von A. Zemlinsky und A. v. Weberns op. 1).
G. Mahler, der z. B. im langsamen Satz der 4. Symphonie kunstvolle Doppel-V.en schrieb, arbeitete generell, und besonders ausgeprägt ab der 8. Symphonie, mit Varianten; Th. W. Adorno verglich diese Kompositionstechnik mit dem Episch-Romanhaften. Von noch größerer Bedeutung ist die sog. Variantentechnik im Gesamtwerk A. Zemlinskys, das in dieser Hinsicht zwischen Mahler und A. Schönberg steht: nach Becher (1999) begegnen hier Themen-, Motiv-, akzessorische, assoziative, Baukasten-, Metamorphosen-, Charakter- und Zusammenhangsvarianten.
In Schönbergs Denken spielt die über die thematische Arbeit hinausgehende „entwickelnde V.“ eine entscheidende Rolle, und zwar unabhängig von der Tonalität (zu der Schönberg etwa in Thema und V.en für Blasorchester op. 43 [1943] zurückkam). Die Streichquartette Nr. 1 und 2 (Litanei nach Stefan George) sind tonal bzw. frei-atonal komponiert, der Zwölftonmethode folgen die V.s-Sätze der Suite op. 29 (über Ännchen von Tharau) und schon der Serenade op. 24 sowie sein Hauptwerk für Orchester, die V.en op. 31 (mit Introduktion und Finale). Alban Berg integrierte die V.s-Form nicht nur in Instrumentalwerke (Kammerkonzert, Violinkonzert), sondern auch in seine Opern Wozzeck (I/4: Passacaglia) und Lulu (III/1: konzertante Choral-V.en). A. Webern, der sich 1932 zur V.en-Form als einer „Vorläuferin der Komposition in zwölf Tönen“ äußerte und sich für die Einheit als Resultat von Variantenbildung interessierte, hat mit dem klar strukturierten 3. Satz der V.en für Klavier op. 27 und den V.en für Orchester op. 30 exemplarische Zwölftonwerke geschaffen. In mittelbarem Zusammenhang mit der Wiener Schule stehen H. Eislers Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben (1940).
An dem Projekt Diabelli 81, das der Musikverlag Doblinger 1981 ausschrieb, beteiligten sich 17 zeitgenössische Komponisten aus Österreich: G. Kühr, G. Schedl, H. Lauermann, I. Eröd, C. Bresgen, G. Amann, E. Urbanner, E. Vogel, G. E. Winkler, G. Neuwirth, H. Eder, M. Rot, J. Takács, P. Kont, G. Wimberger, R. Schollum, H. Kann. Dass – von Gelegenheitswerken abgesehen – (entwickelnde) V., auch in Verbindung mit seriellen Techniken zu neuen semantischen Aussagen führen kann, wird z. B. im Œuvre F. Cerhas (u. a. Netzwerke, Oper Baal) deutlich.
Literatur
MGG 13 (1966); NGroveD 26 (2001); E. R. Sisman, Haydn and the Classical V. 1993; G. Scholz in MusAu 2 (1979); Beiträge v. N. Schwindt, V. Giglberger, A. Raab u. M. Raab in Musiktheorie 17 (2002); R. Flotzinger in Beethoven-Studien 1970; R. Flotzinger in Mitt. d. Int. Stiftung Moz. 23 (1975), H. 3–4; W. Kinderman, Beethoven’s Diabelli V.s 1987; SchubertL 1997; M. J. E. Brown, Schubert’s V.s 1954; W. Frisch, Brahms and the Principle of Developing V. 1984; Th. W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik 1960; Ch. Becher, Die Variantentechnik am Beispiel Alexander Zemlinskys 1999; M. Angerer in C. Ottner (Hg.), [Kgr.-Ber.] Kammermusik zw. den Weltkriegen. Wien 1994, 1995; W. Budday in Mf 50 (1997); H.-D. Klein in Anzeiger der phil-hist. Kl. der ÖAW 131 (1994); HmT 1986; MGÖ 1–2 (1995).
MGG 13 (1966); NGroveD 26 (2001); E. R. Sisman, Haydn and the Classical V. 1993; G. Scholz in MusAu 2 (1979); Beiträge v. N. Schwindt, V. Giglberger, A. Raab u. M. Raab in Musiktheorie 17 (2002); R. Flotzinger in Beethoven-Studien 1970; R. Flotzinger in Mitt. d. Int. Stiftung Moz. 23 (1975), H. 3–4; W. Kinderman, Beethoven’s Diabelli V.s 1987; SchubertL 1997; M. J. E. Brown, Schubert’s V.s 1954; W. Frisch, Brahms and the Principle of Developing V. 1984; Th. W. Adorno, Mahler. Eine musikalische Physiognomik 1960; Ch. Becher, Die Variantentechnik am Beispiel Alexander Zemlinskys 1999; M. Angerer in C. Ottner (Hg.), [Kgr.-Ber.] Kammermusik zw. den Weltkriegen. Wien 1994, 1995; W. Budday in Mf 50 (1997); H.-D. Klein in Anzeiger der phil-hist. Kl. der ÖAW 131 (1994); HmT 1986; MGÖ 1–2 (1995).
Autor*innen
Alexander Rausch
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2006
Empfohlene Zitierweise
Alexander Rausch,
Art. „Variation‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2006, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e574
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.