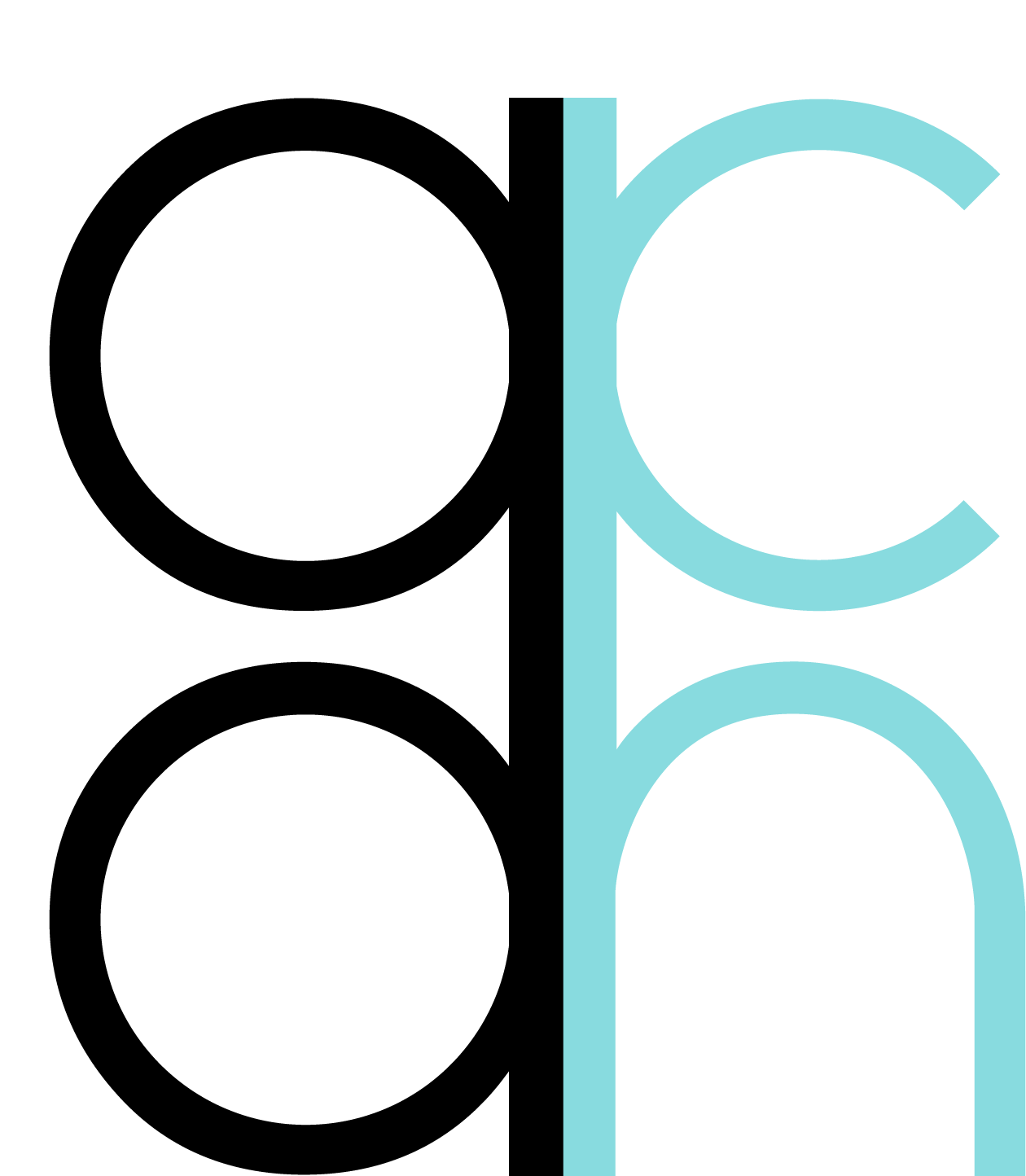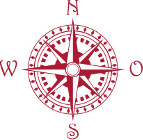Klavierbau
Verfertigung von Klavier-Instrumenten, hier im Speziellen des Typs mit Hammermechanik. Die Anfänge des österreichischen K.s sind nach wie vor nicht befriedigend geklärt. Da bisher kein Hammerklavier bekannt ist, das nachweislich in Wien bzw. in Österreich vor 1782 gebaut wurde und auch die Quellenlage keine verlässlichen Antworten erlaubt, muss die Frage, wie die Kenntnis von der 1697/98 durch Bartolomeo Cristofori in Florenz entwickelten Hammermechanik nach Wien gelangte, zunächst offen bleiben. Dieses Fehlen von Primärquellen nährte die bisher verbreitete Meinung, wonach das Klavier in Wien erst um ca. 1780 durch aus dem süddeutschen Raum zugezogene K.er im Einflussbereich von Gottfried Silbermann (1683–1753) und Johann Heinrich Silbermann (1727–1799) bzw. J. (G). A. Stein bekannt wurde. Aufgrund der engen politischen und kulturellen Verflechtungen zwischen Österreich und Oberitalien ist es hingegen wahrscheinlicher, dass Berichte über das neu erfundene Tasteninstrument direkt aus Italien zwar nach Wien gelangten, das allgemeine Interesse jedoch – abgesehen von gelegentlichen Ausnahmen – erst im letzten Viertel des 18. Jh.s erwachte.Die Schwierigkeit im Auffinden verlässlicher Quellen besteht u. a. darin, dass das „Forte-Piano“ in Wien möglicherweise bereits in der 1. Hälfte des 18. Jh.s bekannt gewesen ist, jedoch weiterhin mit dem gewohnten Namen „Cembalo“, „Flügel“ oder „Clavecin“ bezeichnet wurde. So annoncierte etwa der Augsburger Orgelmacher Johann Christoph Leo im Dezember 1725 im Wienerischen Diarium seine Ankunft in Wien und die Möglichkeit, seine neuen „Cimbalen / ohne Kiel / nebst anderen schönen Flügeln“ zu probieren. Und auch noch W. A. Mozart schreibt für seine Klavierkonzerte (außer KV 537) im Autograph Cembalo vor, obwohl damit sicher kein Kielflügel gemeint war.
Die neue Bezeichnung für das Hammerklavier findet sich in Wien erstmals 1763 in den Hofzahlamtsbüchern, wo – ein Jahr vor dem legendären Konzert J. Ch. Bachs in London – das Honorar für Johann Baptist Schmidt „für 1 Concert auf dem Fortipiano [sic!] den 13. März 763 im Burg Thor Theater, und ein mal Schlagen bey dem Holländischen Balletl“ belegt ist.
Die früher als bislang vermutete Rezeption des Hammerklaviers in Österreich findet ihre Bestätigung in einem mit „HN / 1696“ bezeichneten Cembalo, das einen Reparaturvermerk aus dem Jahr 1726 trägt. Dass damals der Umbau in einen Hammerflügel erfolgte, ist nicht zweifelsfrei beweisbar, aber auch nicht eindeutig auszuschließen (s. Abb. bei Cembalo). Das Instrument weist heute eine Stoßmechanik ohne Auslösung mit nach hinten gerichteten, hohen und schmalen Hammerköpfen auf, was einer vereinfachten Version der Cristofori-Mechanik entspricht. Stilistisch jedoch und in den meisten technischen Details knüpfen die frühen Wiener Klaviere an die süddeutsch-österreichische Cembalo- und Orgelbautradition des frühen 18. Jh.s an. Es ist eine häufig übersehene Tatsache, dass gerade die frühesten von Wiener Orgelmachern gebauten Hammerklaviere eine Stoßmechanik aufweisen und nicht die von J. A. Stein in Augsburg um ca. 1780 entwickelte Prellzungenmechanik (auch „Deutsche“ oder „Wiener Mechanik“ genannt).
Die Reise Steins 1777 nach Wien und die Präsentation seines neuen Vis-à-vis-Flügels (einem Kombinationsinstrument von Cembalo und Hammerflügel) am Kaiserhof, muss für den Wiener K. einen entscheidenden Impuls bedeutet haben. Ein wesentlicher Wirtschaftsaufschwung und Innovationsschub erfolgte durch den Abbau der restriktiven Zunftbestimmungen und Handelsschranken durch Joseph II. Dies bewog in den letzten Jahrzehnten des 18. Jh.s zahlreiche Instrumentenbauer aus dem süddeutschen und böhmischen Raum, in die Kaiserstadt an der Donau zu übersiedeln.
Der um ca. 1776 aus Württemberg zugezogene A. Walter dürfte der erste gewesen sein, der in Wien als „Pianofortemacher“ bezeichnet wurde. Er galt bis zum Ende des 18. Jh.s als der beste Wiener K.er. Von ihm erwarb um 1782 W. A. Mozart einen Hammerflügel, der sich heute im Besitz der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg befindet und zu den ältesten gesichert in Wien gebauten Klavieren gehört (s. Abb.). Allerdings wurde – möglicherweise auf Mozarts Wunsch – die ursprüngliche Dämpferhebung von Handhebeln auf Kniehebel umgebaut. Die nachweislich grundlegend veränderte Hammermechanik weist jedoch Konstruktionsmerkmale von Walters Klavieren um ca. 1800 auf. Das ursprünglich zugehörige Forte Piano Pedale ist nicht mehr erhalten.
Neben Walter lassen sich als Klaviermacher der „ersten Stunde“ F. X. Christoph, Johann Georg Volkert (Folkert) (nachweisbar zw. 1777/1804), Johann Kaspar Moyse jun. (1729–85), Gottfried Hülm (ca. 1753–96), J. G. Malleck sen., I. Kober, Ferdinand Hofmann (ca. 1756–1829) und W. Schantz nachweisen.
Die von Stein entwickelte Prellzungenmechanik fand in Wien sehr rasch Nachahmer und erfuhr hier entscheidende Verbesserungen. Die hölzernen und mit Tuch garnierten Hammerkapseln wurden ab etwa 1785 durch Messingkapseln ersetzt. Diese Johann Jakob Seidel zugeschriebene Erfindung erlaubte eine rationellere Fertigung und präzisere Hammerführung. Durch die Entwicklung der Fängerleiste (vermutlich von A. Walter) wurde das dynamische Spektrum deutlich erweitert. Erst mit diesen entscheidenden konstruktiven Verbesserungen war dieses zur sog. „Wiener Mechanik“ mutierte Hammergetriebe zu jener Expressivität und Repetierfreudigkeit fähig, mit der sie den in Westeuropa gebauten unterschiedlichen Stoßmechaniken zwar nicht an Lautstärke, aber an Ausdruckskraft und Subtilität weitaus überlegen war. Bis zum Ende des 18. Jh.s wurde der Schwerpunkt im Wiener K. auf eine leichtgängige, subtile und präzise repetierende Mechanik, eine verlässliche Dämpfung sowie auf klangliche Ausgewogenheit zwischen einer runden, farbigen Basslage und einem zeichnenden und singenden, nicht zu schwachen Diskant gelegt.
Signifikante Unterschiede in Gehäusekonstruktion, Hammerkopfform, Mensurentwicklung, Registergestaltung, Berippung etc. lassen auf eine rege Experimentierfreude und Suche nach einem neuen Klangideal schließen, das zunächst irgendwo zwischen Cembalo, Clavichord (Klavichord), Hackbrett und Harfe angesiedelt war. Es sei daran erinnert, dass das älteste Mechanikmodell Steins (im Vis-à-vis-Flügel von 1777 in der Accademia in Verona) sowie zahlreiche Hammerklaviere dieser Epoche bis hin zu den Tangentenflügeln von Späth und Schmahl in Regensburg unbelederte Hammerköpfe aufweisen, woraus ein sehr heller, cembaloähnlicher Klang resultiert. Nicht selten (bzw. fast immer bei Tafelklavieren) waren die Dämpferhebung, noch häufiger jedoch der Moderator („Pianozug“), nur mittels Handhebel oder Registerknopf zu bedienen, wodurch ein Pedalisieren im heutigen Sinn zunächst unmöglich war. Dass das Bedürfnis nach Lautstärke und Tragfähigkeit in großen Räumen noch nicht im Vordergrund stand, ist u. a. daraus ersichtlich, dass der überwiegende Teil der Hammerflügel im 18. Jh. im Originalzustand keine Deckelstützen aufwies. Man spielte vorwiegend mit geschlossenem Hauptdeckel, bei größeren Veranstaltungen wurde der ganze Deckel abgenommen.
Die Saitenmensuren der frühen, vorwiegend von Orgelmachern gebauten Hammerflügel korrespondieren in Mittellage und Diskant häufig mit den Pfeifenlängen eines 8'-Prinzipalregisters, was Rückschlüsse auf die zu vermutende Stimmtonhöhe erlaubt. Bis nach der Jh.wende wurden offensichtlich Hammerklaviere im Chorton (a1: ca. 450–460 Hz), im hohen Kammerton (a1: ca. 430–440) sowie im tiefen Kammerton (a1: 405–425 Hz) gebaut. Durch einige wenige erhaltene Orgelklaviere (z. B. von F. X. Christoph, KHM/SAM 625) und gebundene Clavichorde lässt sich nachweisen, dass auch im K. ungleichstufige, modifiziert mitteltönig orientierte Temperatursysteme in Wien länger als bisher angenommen, beibehalten wurden. Dies belegt auch das 1796 von Johann Jakob Könnicke (1756–1811) gebaute, mit sechs Manualen ausgestattete „Pianoforte pour la parfaite Harmonie“, das mit seinen 31 Tönen pro Oktav die Auseinandersetzung mit einem enharmonischen, aus 31 Großterzen aufgebauten Tonsystem von Christian Huggens (1661, P. v. Jankó) verrät (KHM/SAM 610).
Als für die Zeit der frühen Wiener Klassik typische Hammerklaviere müssen einerseits Instrumente in der Nachfolge J. A. Steins aus Augsburg angesehen werden. Dazu gehören neben F. Hofmann die aus Böhmen stammenden Brüder W. und J. Schantz, die J. Haydn in den bekannten Briefen 1788 an seinen Verleger Artaria sowie 1790 an seine Schülerin M. v. Genzinger empfahl. Andererseits sei auf die erwähnte eigenständige Wiener Tradition verwiesen, als deren bedeutendster Vertreter der aus Olmütz gebürtige I. Kober zu nennen ist, von dem auch das bisher früheste (1788) datierte in Wien gebaute Tafelklavier stammt. Als Besonderheit seiner Instrumente sind die äußerst präzise gefertigte Stoßmechanik sowie eine Rosette im lackierten Resonanzboden zu erwähnen. Ein ihm zugeschriebener Hammerflügel soll sich ursprünglich im Besitz Kaiser Josephs II. befunden haben (KHM/SAM 364).
Ein in der Villa Bertramka in Prag befindlicher Flügel, auf dem Mozart 1787 bei seinem Prager Aufenthalt im Adeligen Damenstift gespielt hat, gilt ebenfalls als Werk Kobers. Der derzeit älteste datierte Wiener Hammerflügel (noch mit hölzernen Hammerkapseln) wurde 1787 von G. Malleck gebaut (KHM/SAM 960), von dem auch die Orgeln in der Bergkirche sowie im Dom in Eisenstadt stammen. Ende des 18 Jh.s waren in Wien etwa 60 Klavier- und Orgelmacher tätig.
Der neue Aufschwung im Instrumentenbau war natürlich nicht auf die Haupt- und Residenzstadt beschränkt. So erwies sich etwa in Salzburg J. E. Schmidt, der auf Empfehlung von L. Mozart 1785 als Hoforgelbauer angestellt wurde und für M. A. Mozart und M. Haydn einen Flügel lieferte, bald als äußerst innovativer Meister. In Prag etablierten sich nach 1790 mehrere Werkstätten, von denen zunächst die von Michael Weiß (1764–1838) hervortrat. Viele ursprünglich aus Böhmen und Mähren stammende Meister übersiedelten letztlich aus wirtschaftlichen Überlegungen nach Wien. Dazu gehört etwa J. Dohnal, der mit der von C. Röllig 1795 erfundenen „Orphica“, einem tragbaren Klavierchen, das auf Ausflüge mitgenommen werden konnte, größere Bekanntheit erlangte.
Bis zur Mitte des 19. Jh.s war der Wiener K. den großen Produktionsstätten im übrigen Europa ebenbürtig, obwohl die Herstellung weiterhin vorwiegend in kleinen Manufakturen erfolgte. Die Werkstätten von F. Hofmann, der pro Woche mit acht Gesellen ein Klavier herstellte, oder jener von A. Walter (nach ca. 1800 „Anton Walter und Sohn“), der 1804 rund 20 Gesellen beschäftigte, müssen für damalige Verhältnisse als „Fabriken“ bezeichnet werden.
Zwei Schulen prägten um 1800 den Wiener K. Die eine Richtung, maßgeblich beeinflusst von Walter, bevorzugte einen kräftigen, auf Lautstärke und extrovertierte Virtuosität hin ausgerichteten Klaviertyp. Die andere Richtung, deren hellerer, zeichnender Klang von klassisch geprägten Musikern v. a. für die Haus- und Kammermusik bevorzugt wurde, geht auf N. Streicher und ihren Bruder M. A. („André“) Stein sowie auf J. Schantz zurück. Die 1794 von Augsburg nach Wien übersiedelten und bis 1802 in gemeinsamer Werkstätte arbeitenden „Geschwister Stein“ führten die Tradition ihres 1792 verstorbenen Vaters J. A. Stein fort. Neben den bereits genannten Meistern waren auch J. Brodmann, J. Jakesch, Michael Rosenberger (1766–1832) und M. Schweighofer von Bedeutung.
Der Wiener K. erlebte (parallel zur Gesamtentwicklung im süddeutschen Raum) am Beginn des 19. Jh.s, besonders nach Ende der napoleonischen Kriege, sowohl in seinem äußeren Erscheinungsbild als auch hinsichtlich der musikalischen Möglichkeiten einen ersten Höhepunkt. Mit edlen Hölzern furnierte und prächtig ausgestattete Gehäuse, verziert mit vergoldeten Applikationen und getragen von Beinen mit kunstvoll geschnitzten, teils vergoldeten, teils farbig gefassten Kapitellen in Akanthusmotiven oder als Karyatiden gestaltet, erhob die Klaviere zu repräsentativen Prunkstücken für die Musiksalons der meist aristokratischen Auftraggeber.
Gleichzeitig trug die musikalische Entwicklung auch dem Geschmack und dem Lebensgefühl des aufkommenden Bürgertums Rechnung (bürgerliche Musikkultur): die zunehmende Lautstärke und die Klangfarbenvielfalt durch den Einbau von immer mehr Mutationen machten die Klaviere zu beeindruckenden „Einmann-Orchestern“, die neben der herkömmlichen Klavierliteratur für Opern- und Orchesterbearbeitungen und andere Tongemälde herangezogen wurden (z. B. L. v. Beethovens eigene Fassung seines op. 91, Wellingtons Sieg von 1813). Zu den schon bekannten, bisher vorwiegend mittels Kniehebeln regierten Veränderungen (Dämpferhebung, Moderator) kamen hinzu: der „Fagottzug“ (surrender Klang durch eine gegen die Saiten gedrückte Papier- oder Seidenrolle), „una corda“ bzw. „due corde“ (Verschiebung), „Lautenzug“ (gegen die Saiten gedrückte mit Leder überzogene Leiste, die den Ton kurz und grundtönig machte), „Harfenzug“ (gegen die Saiten abgesenkte, mit Fransen bezogene Stoffleiste) und nicht zuletzt die imposanten, als „Janitscharen-Register“ oder „Türkische Musik“ bezeichneten Pauke, Glöckchen und Becken („Tschinellen“), welche nun mit bis zu sieben Pedalen bedient werden konnten. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass neben diesen damals wie heute seltenen und teuren, vorwiegend dem Adel vorbehaltenen Repräsentationsstücken, im bürgerlichen Wohnzimmer preiswertere Instrumente, in der Mehrzahl zunächst Tafelklaviere, dominierten. Der heimische K. dieser Zeit war bekannt dafür, dass sich auch die einfach ausgestatteten Instrumente durch eine hohe handwerkliche und klangliche Qualität auszeichneten. Der Schwerpunkt des Musikgeschehens lag im häuslichen Musizieren, was sich auch in einem charakteristischen Baudetail, dem über den Saiten angebrachten Schalldeckel oder „Staubboden“ ausdrückt, der den Klang abrunden und die Balance zwischen einem zu dominanten Bass und dem schwächeren Diskant regulieren sollte.
Der mit der industriellen Revolution einsetzende Fortschrittsgedanke schlug sich natürlich auch im Instrumentenbau nieder. Zwischen 1821 und 1843 wurden allein für den K. 53 Erfindungen zum Patent angemeldet, z. B. die Patentmechanik von J. B. Streicher, Wien 1831.
Die vom Cembalobau des 18. Jh.s übernommene und weiterentwickelte Rastenbauweise wurde allmählich durch die bis heute übliche, stabilere und unten offene Rastenkonstruktion ersetzt. Einige Klaviermacher, allen voran J. B. Streicher, zeichneten sich in der Entwicklung neuer Mechanik- oder Gehäusetypen durch regen Erfindungsgeist aus. Andere Meister, wie z. B. C. Graf, konzentrierten sich dagegen auf die Konstruktion einiger bewährter, solider Modelle, die lediglich in Ausstattung und Preis stark variieren konnten. Die ersten großen „Gewerbs-Producten-Ausstellungen“ 1835, 1839 und 1845 in Wien und Pest (Budapest) bedeuteten für die Firmen einerseits erhöhten Konkurrenzdruck, andererseits Herausforderung und Ansporn zu Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung.
Als bedeutendste Meister des Vormärz sind neben C. Graf, der 1841 seine Fabrik an C. Stein verkaufte, Steins Vetter J. B. Streicher sowie J. M. Schweighofer und I. Bösendorfer, der 1828 noch unter dem Namen Besendorfer die Werkstätte Brodmanns übernahm, zu nennen.
Die rege Nachfrage nach preisgünstigen Klavieren führte auch außerhalb Wiens zur Gründung von Werkstätten, von denen mehrere eine über den lokalen Wirkungskreis hinausgehende Bekanntheit erlangten. In Prag waren die Instrumente von Jakob Weimes (1767–1830) sehr gesucht. In Ungarn etablierten sich Anfang des 19. Jh.s in Ofen/Buda und Pest (Budapest) aber auch in anderen Landesstädten wie Kaschau (Košice/SK), Leutschau (Levoca/SK) oder Szegedin (Szeged/H) eigene, meist kleine Werkstätten, die einerseits unter dem Einfluss der Wiener Tradition standen, andererseits deren Konkurrenzdruck ausgesetzt und durch einseitige Zollschranken benachteiligt waren. Daneben sind Vendel Peter (1795–1874), Vilmos Schwab (erw. 1814–1856) und Ferenc Zobel (1793–1841) in Pest sowie Karl (Károly) Schmid (1794–1872) in Pressburg zu nennen.
Die zahlreichen erhaltenen Klaviere von J. G. Gröber, der nach seinen Wiener Lehrjahren in Innsbruck eine eigene Werkstätte eröffnete, belegen sowohl die hohe handwerkliche Qualität als auch die anhaltende Wertschätzung dieses Tiroler Meisters. Johann Frenzel in Linz war einer der ersten, der den von Jean-Henri Pape (1789–1875) 1826 in Paris patentierten Hammerfilz (anstelle der bisher üblichen Garnierung der Hämmer mit mehreren Schichten Schaf- bzw. Wildleder) einführte.
Die österreichischen Saitendrahthersteller konnten sich gegenüber ausländischen Produkten trotz deren zollfreier Einfuhr durchsetzen. Die von Martin Miller & Sohn in Wien hergestellten Klavierstahlsaiten waren in ganz Europa berühmt und wurden sogar von Broadwood für die Weltausstellung in London 1851 verwendet. Auch das von Franz Joseph Kaindel (1752–1827) und seinem Sohn Alois K. (1784–1848) in Linz sowie später von der Firma Trümpfer in Wien verfertigte Hammerleder war ein gesuchter Exportartikel.
Die durch die Revolution 1848 sich anbahnenden gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen schlugen sich allmählich auch im K. nieder. Die von Westeuropa geprägte Entwicklung zu immer größerer Lautstärke wurde jedoch von den österreichischen Meistern nur zögernd nachvollzogen. Gehäusespreizen und Rahmen aus Eisen, der von Pape erfundene Hammerfilz und Erards Repetitionsmechanik mit doppelter Auslösung wurden bis zur Mitte des 19. Jh.s von den meisten K.ern und Pianisten aus klanglichen, spieltechnischen und ökonomischen Gründen abgelehnt. Trotz dieser – aus heutiger Sicht – „Rückständigkeit“ war Österreich noch um die Mitte des 19. Jh.s ein Netto-Exportland. Dies ist vorwiegend auf die niedrigen Produktionskosten bei gleichzeitig hoher klanglicher Qualität zurückzuführen. Der Chef einer österreichischen Fabrik war zugleich ihr erster Arbeiter, was sich in ständiger Kontrolle und sorgfältiger Intonation, verbunden mit individueller Prägung auswirkte. Die v. a. in England detailliert geplante Arbeitsteilung wurde auch in Wien praktiziert, allerdings auf verschiedene kleinere Firmen aufgeteilt. Die Produktivität war jedoch nicht annähernd mit der westeuropäischer Fabriken vergleichbar: 1851 stellte die Firma Broadwood in London in einem Jahr mit 2.300 Stück beinahe die gleiche Anzahl von Klavieren her wie alle 105 Wiener Klaviermacher zusammen (2.600 Stück). Dennoch wandten sich die führenden Firmen entschieden gegen eine Ausweitung der Betriebsgröße zur Massenproduktion. L. Bösendorfer beispielsweise beschränkte die Anzahl seiner Mitarbeiter bewusst auf 120. Damit wurde allerdings der Anschluss an den Weltmarkt verpasst.
Einige K.er zeichneten sich auch durch beachtliche musikalische Fähigkeiten aus (z. B. N., A. und J. B. Streicher, C. Stein, L. Bösendorfer) und stellten ihre Instrumente z. T. selbst dem Publikum vor.
Der aufstrebende und zur Musikbegeisterung erwachende Mittelstand hatte nicht die großzügigen Wohnverhältnisse des Adels vorzuweisen, weshalb schon früh platzsparende Konstruktionen gesucht wurden. Neben den überaus zahlreich gebauten Tafelklavieren waren dies v. a. die aufrechten Pianofortes – die Vorläufer des späteren „Pianinos“. Mat. Müller schuf mit seiner „Ditanaklasis“ einen Prototyp der aufrechten Kleinklaviere (Keeß 1823). Joseph Wachtel (erw. zw. 1801/32) und Jakob Bleyer (1778–1812) gelten als Erfinder des „Pyramiden-“ und „Giraffenklavieres“. Diese beiden Meister sowie ihr späterer Kompagnon E. Seuffert, dessen Geschäftsführer F. Ehrbar nach Seufferts frühem Tod die Firma 1855 zunächst unter gleichem, dann unter eigenem Namen weiterführte, floss die langjährige Erfahrung in die Entwicklung sehr guter „Pianinos“ ein.
Ab der Mitte des 19. Jh.s begannen sich jene von Frankreich, England und Amerika geprägten Einflüsse abzuzeichnen, die letztlich zum modernen Klavier geführt haben. Dies bewirkte einen enormen Entwicklungsschub sowohl in bau- als auch in produktionstechnischer Hinsicht. Eisenspreizen und Anhängeplatten, Hammerfilze, Gussstahlsaiten mit kreuzsaitigem Bezug sowie der 1862 von F. Ehrbar in Wien erstmals verwendete Vollgussrahmen wurden in die Produktion übernommen. Der sog. „Stutzflügel“ und das Pianino verdrängten das Tafelklavier aus dem Wohnzimmer. Lautstärke und Klangvolumen setzten sich als wichtigste Qualitätskriterien durch. Nicht wenige Zeitgenossen, die noch L. v. Beethoven, J. N. Hummel und C. Czerny gehört hatten und das Hammerklavier als poetisches Kammermusikinstrument schätzten, warnten vor der Einseitigkeit dieser Entwicklung. Sie erkannten, dass mit dem Gewinn an Lautstärke ein Verlust an Klangschönheit und Kantabilität verbunden war, für die die Wiener Klaviere damals in ganz Europa berühmt waren. Die wegen ihrer Leichtigkeit und Subtilität einstmals so geschätzte „Wiener Mechanik“ konnte aufgrund der zunehmenden Masse aller bewegten Teile diese Entwicklung nicht mitmachen. Sie gilt seitdem als träge und schwergängig und wurde z. B. bei Bösendorfer ab 1906 aus der Produktion genommen.
Die österreichischen Firmen, die primär den heimischen Bedarf deckten, gerieten zunehmend durch billigere Importe aus dem Ausland (v. a. Pianinos aus Deutschland) unter Druck. Die Anzahl der Betriebe verringerte sich, während die Produktivität einzelner Unternehmen stark gesteigert werden konnte. Nach 1848 blieb in Budapest nur die Firma des tüchtigen und innovativen Meisters L. Beregszászy bestehen, dessen gewölbter „Cello“-Resonanzboden zeitweise auch von Bösendorfer übernommen wurde. Um der Konkurrenz der marktführenden Fabriken standhalten zu können, schlossen sich 1873 mehrere kleinere Betriebe zur Ersten Wiener Productiv-Genossenschaft zusammen. Nach der erstmaligen Teilnahme an der Weltausstellung 1851 in London dokumentierte der österreichische K. bei der Wiener Weltausstellung 1873 und bei der Internationalen Ausstellung für Musik und Theaterwesen 1892 seine internationale Bedeutung.
Das Klaviermachergewerbe erlebte in den 1920er Jahren noch einmal einen kurzen lokalen Aufschwung durch die volksbildnerischen Bemühungen der Arbeiterbewegung, die zu einer regen Nachfrage an platzsparenden Klavieren für Kleinwohnungen oder Vereinslokale führte, wofür zahlreiche Instrumente des 19. Jh.s abgeschnitten und zu „Stutzflügeln“ umgearbeitet wurden. Dieser Trend kam jedoch durch die Weltwirtschaftskrise und durch das Aufkommen von Schallplatte und Rundfunk bald zum Erliegen
Neben Ehrbar und Bösendorfer erlangten die Firmen Czapka (ca. 1840–1936), Dörr (1817–1936), Heitzmann (gegr. 1839) und Schweighofer's Söhne (1832–1938) größere Bedeutung, die jedoch die Wirtschaftskrise der 1920/30er Jahre nicht überlebten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg verhinderte der Import billiger Massenware aus Fernost sowie das Aufkommen elektronischer „Keyboards“ die Erholung des heimischen Marktes. Neben kleinen Reparaturbetrieben, die vereinzelt auch Kleinstserien herstellten, war Ende des 20. Jh.s in Wien von den ehemals über 200 Betrieben nur mehr die Firma Bösendorfer (mit der Produktionsstätte in Wiener Neustadt) im Neubau von Klavieren tätig.
Literatur
(Alphabetisch:) Ch. Ahrens, „... einen überaus poetischen Ton“ – Hammerklaviere mit Wiener Mechanik 1999; E. Badura-Skoda in Israel Studies in Musicology 2 (1984); R. Angermüller/A. Huber (Hg.), Mozarts Hammerflügel 2000; Beschreibung der Erfindungen und Verbesserungen, für welche in den k.k. österreichischen Staaten Patente erteilt wurden 1–3 (1841–45); K. Birsak in Salzburger Museum Carolinum Augusteum. Jahresschrift 34/1988 (1990); B. Čížek, [Kat.] 300 Jahre mit Hammerklavier Nationalmuseum Prag – Museum der tschech. Musik 1999; V. Cizek, Die Gesch. der Firma Seuffert und Ehrbar, Dipl.arb. Wien 1989; M. Cole, The Pianoforte in the Classical Era 1998; P. de Wit, Weltadressbuch der Musikinstrumentenindustrie 1929/1930, 1930; J. Fischhof, Versuch einer Gesch. des Kavierbaues 1853; Beiträge v. E. Fontana Gàt u. A. Huber in F. Hellwig (Hg.), [Fs.] J. H. Van der Meer 1987; E. Fontana in Encyclopedia of Keyboard Instruments 1 (1994) [Hungary, Piano Industry in]; L. Gall (Hg.), Clavierstimmbuch oder deutliche Anweisung wie jeder Musikfreund sein Clavier-Flügel, Fortepiano ... erhalten könne 1805; U. Goebl-Streicher in [Kat.] Beethoven und die Wiener K.er Nannette und Andreas Streicher. Beethoven Haus Bonn 1999; H. Welcker v. Gontershausen, Der Flügel oder die Beschaffenheit des Pianos in allen Formen 21856; E. M. Harding Rosamond, The Piano-Forte, traced to the great Exhibition of 1851, 21978; H. Haupt in StMw 24 (1960); F. J. Hirt, Meisterwerke des K.s 1981; Hopfner 1999; A. Huber in [Kat.] Die Klangwelt Mozarts. Kunsthistor. Museum Wien 1991; A. Huber in The Galpin Society Journal 55 (2002); St. v. Keeß (Hg.), Darstellung des Fabriks-und Gewerbswesens im österreichischen Kaiserstaate 1823; MiÖ 1989; M. Latcham in Early Music 21/1 (1993); M. Latcham in M. Lustig (Hg.), [Kgr.-Ber.] Zur Gesch. des Hammerklaviers. Michaelstein 1993 1996; M. Latcham, Stringing, Scaling and Pitch of Hammerflügel built in the Southern German and Viennese Traditions 1780–1820, 2000; V. Luithlen, [Kat.] Saitenklaviere. Slg. alter Musikinstrumente des KHM.s Wien 1966; M. Mayer, Historische Betriebsanalyse der Firma L. Bösendorfer, Diss. Wien 1989; R. Maunder, Keyboard Instruments in Eighteenth Century Vienna 1998; M. E. Nussbaumer-Eibensteiner, Johann Georg Gröber. Tiroler Klavier- und Orgelbauer 1775–1849, Dipl.arb. Innsbruck 1992; M. Novak-Clinkscale, Makers of the Piano 1700–1820, 1993; Ottner 1977; R. Prilisauer (Hg.), [Kat.] Klavierland Wien. Bezirksmuseum Mariahilf, Oktober 1980 bis Jänner 1981; St. Pollens, The Early Pianoforte 1995; S. Rampe, Mozarts Claviermusik, Klangwelt und Aufführungspraxis 1995; K. Restle, Bartolomeo Cristofori und die Anfänge des Hammerclaviers 1991; J. F. Schönfeld, Jb. der Tonkunst von Wien und Prag 1796; H. R. Scholz (Hg.), [Fs.] Fa. Ehrbar 1986; A. Streicher, Kurze Bemerkungen über das Spielen, Stimmen und Erhalten der Fortepiano 1802; E. Szórádová, Historické klavíry na Slovensku. Historical Keyboard Intruments in Slovakia 2004.
(Alphabetisch:) Ch. Ahrens, „... einen überaus poetischen Ton“ – Hammerklaviere mit Wiener Mechanik 1999; E. Badura-Skoda in Israel Studies in Musicology 2 (1984); R. Angermüller/A. Huber (Hg.), Mozarts Hammerflügel 2000; Beschreibung der Erfindungen und Verbesserungen, für welche in den k.k. österreichischen Staaten Patente erteilt wurden 1–3 (1841–45); K. Birsak in Salzburger Museum Carolinum Augusteum. Jahresschrift 34/1988 (1990); B. Čížek, [Kat.] 300 Jahre mit Hammerklavier Nationalmuseum Prag – Museum der tschech. Musik 1999; V. Cizek, Die Gesch. der Firma Seuffert und Ehrbar, Dipl.arb. Wien 1989; M. Cole, The Pianoforte in the Classical Era 1998; P. de Wit, Weltadressbuch der Musikinstrumentenindustrie 1929/1930, 1930; J. Fischhof, Versuch einer Gesch. des Kavierbaues 1853; Beiträge v. E. Fontana Gàt u. A. Huber in F. Hellwig (Hg.), [Fs.] J. H. Van der Meer 1987; E. Fontana in Encyclopedia of Keyboard Instruments 1 (1994) [Hungary, Piano Industry in]; L. Gall (Hg.), Clavierstimmbuch oder deutliche Anweisung wie jeder Musikfreund sein Clavier-Flügel, Fortepiano ... erhalten könne 1805; U. Goebl-Streicher in [Kat.] Beethoven und die Wiener K.er Nannette und Andreas Streicher. Beethoven Haus Bonn 1999; H. Welcker v. Gontershausen, Der Flügel oder die Beschaffenheit des Pianos in allen Formen 21856; E. M. Harding Rosamond, The Piano-Forte, traced to the great Exhibition of 1851, 21978; H. Haupt in StMw 24 (1960); F. J. Hirt, Meisterwerke des K.s 1981; Hopfner 1999; A. Huber in [Kat.] Die Klangwelt Mozarts. Kunsthistor. Museum Wien 1991; A. Huber in The Galpin Society Journal 55 (2002); St. v. Keeß (Hg.), Darstellung des Fabriks-und Gewerbswesens im österreichischen Kaiserstaate 1823; MiÖ 1989; M. Latcham in Early Music 21/1 (1993); M. Latcham in M. Lustig (Hg.), [Kgr.-Ber.] Zur Gesch. des Hammerklaviers. Michaelstein 1993 1996; M. Latcham, Stringing, Scaling and Pitch of Hammerflügel built in the Southern German and Viennese Traditions 1780–1820, 2000; V. Luithlen, [Kat.] Saitenklaviere. Slg. alter Musikinstrumente des KHM.s Wien 1966; M. Mayer, Historische Betriebsanalyse der Firma L. Bösendorfer, Diss. Wien 1989; R. Maunder, Keyboard Instruments in Eighteenth Century Vienna 1998; M. E. Nussbaumer-Eibensteiner, Johann Georg Gröber. Tiroler Klavier- und Orgelbauer 1775–1849, Dipl.arb. Innsbruck 1992; M. Novak-Clinkscale, Makers of the Piano 1700–1820, 1993; Ottner 1977; R. Prilisauer (Hg.), [Kat.] Klavierland Wien. Bezirksmuseum Mariahilf, Oktober 1980 bis Jänner 1981; St. Pollens, The Early Pianoforte 1995; S. Rampe, Mozarts Claviermusik, Klangwelt und Aufführungspraxis 1995; K. Restle, Bartolomeo Cristofori und die Anfänge des Hammerclaviers 1991; J. F. Schönfeld, Jb. der Tonkunst von Wien und Prag 1796; H. R. Scholz (Hg.), [Fs.] Fa. Ehrbar 1986; A. Streicher, Kurze Bemerkungen über das Spielen, Stimmen und Erhalten der Fortepiano 1802; E. Szórádová, Historické klavíry na Slovensku. Historical Keyboard Intruments in Slovakia 2004.
Autor*innen
AHu
Letzte inhaltliche Änderung
22.3.2022
Empfohlene Zitierweise
Alfons Huber,
Art. „Klavierbau‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
22.3.2022, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d49b
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.